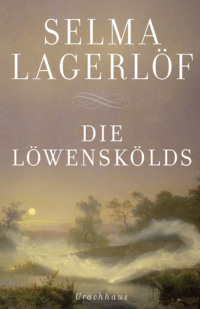Kitabı oku: «Die Löwenskölds», sayfa 11
»Ich bin noch hier und sehe mir die Rosen an, mit denen Sie den Weg zu Ihrem Hause eingefasst haben, liebe Frau Sundler, und ich überlege eben, ob dieser Sommer nicht der schönste ist, den ich je erlebt habe. Wir haben nun Ende Juli, die ganze nun vergangene Sommerszeit ist geradezu vollkommen gewesen, finden Sie das nicht auch? Sind nicht alle Tage lang und hell gewesen, länger und heller als je zuvor? Gewiss war es sehr heiß, aber niemals wirklich drückend, weil doch meistens ein frischer Luftzug wehte. Auch die Erde hat nicht unter Trockenheit zu leiden gehabt wie in andern schönen Sommern, weil fast jede Nacht etwas Regen gefallen ist. So war das Wachstum auch ganz unerhört. Haben Sie schon jemals die Bäume so üppig belaubt oder die Blumenrabatten im Garten in solcher Pracht leuchten sehen? Ach, ich möchte behaupten, die Erdbeeren seien nie so süß, der Vogelgesang nie so wohllautend und die Menschen nie so fröhlich und genussfähig gewesen wie in diesem Jahre!«
Er schwieg einen Augenblick, um Atem zu schöpfen, doch Frau Sundler hütete sich wohl, ihn durch ein Wort zu stören. Sie dachte an ihre Mutter.
Jetzt begriff sie, was diese gefühlt haben mochte, wenn der junge Baron sie in der Küche oder in der Milchkammer aufgesucht und ihr allerlei anvertraut hatte.
Der junge Geistliche fuhr fort: »Wenn ich morgens gegen fünf Uhr meinen Vorhang zurückziehe, sehe ich kaum etwas anderes als Düsternis und Gewölk. Das klatscht gegen die Fensterscheiben, das gießt aus der Dachtraufe, Gras und Blumen beugen sich nieder unter dem Platzregen. Die ganze Luft ist voller regenschwerer Wolken, die sich über den Wiesengrund hinzuschleppen scheinen. Heut ist’s aus mit dem schönen Wetter, sage ich zu mir selbst, und vielleicht ist es auch so am besten.
Und obgleich ich weiß, dass es den ganzen Tag fortregnen wird, bleibe ich doch noch eine ganze Weile am Fenster stehen und sehe zu, was noch werden wird. Und siehe, fünf Minuten nach fünf Uhr klatschen die Tropfen nicht mehr an meine Scheiben. Die Dachtraufe rieselt noch eine Weile, dann hört auch das auf. Gerade an der Stelle am Himmel, wo die Sonne stehen sollte, öffnet sich ein Wolkenspalt, und ein breiter Lichtstreifen fällt herab in die irdischen Nebel. Gleich darauf verwandeln sich diese, am Horizont aufwallend, in lichtblauen Dunst. Die Tropfen rinnen die Grashalme entlang auf die Erde, und die Blumen richten ihre ängstlich gesenkten Kelche wieder empor. Unser kleiner See, von dem ich einen schwachen Schimmer von meinem Fenster aus sehen kann und der bis jetzt ganz mürrisch dreingeschaut hat, beginnt zu glitzern, wie wenn große Scharen von Goldfischen sich unter dem Wasserspiegel angesammelt hätten. Und hingerissen von so viel Schönheit, öffne ich mein Fenster weit, atme die Luft voll schwellender Wohlgerüche von einer nie geahnten Fülle ein, und ich breche in den Ruf aus: Ach, mein Gott, du hast deine Welt viel zu schön geschaffen!«
Der junge Geistliche hielt inne, lächelte und zuckte die Schultern. Er schien anzunehmen, Thea Sundler verwundere sich über seine letzte Äußerung, und so beeilte er sich, diese zu erläutern.
»Ja«, fuhr er fort, »es ist mir ernst mit dem, was ich sagte. Ich war bange, dieser schöne Sommer könne mich verleiten, etwas Irdisches zu lieben. Wie oft habe ich das Ende dieses herrlichen Wetters herbeigewünscht, gewünscht, der Sommer möge uns Blitz und Donner, Dürre und Schwüle, Landregen und kalte Nächte bringen, wie das schon so oft in andern Jahren geschehen ist.«
Thea Sundler sog alle seine Worte in sich hinein. – Wo wollte er hin? Was wollte er damit sagen? Sie wusste es nicht, wünschte es aber fast krampfhaft, er möchte fortfahren, damit sie noch lange den Wohllaut seiner Stimme, die schönen Worte und das ausdrucksvolle Mienenspiel genießen könnte.
»Verstehen Sie mich?«, rief er aus. »Aber über Sie hat die Natur vielleicht keine Macht. Sie spricht nicht zu Ihnen mit starken, geheimnisvollen Worten. Sie fragt Sie nie, warum Sie nicht dankbar alle ihre guten Gaben genießen, warum Sie das Glück nicht ergreifen, das so erreichbar nahe liegt; warum Sie sich nicht ein eigenes Heim gründen und sich mit der Geliebten Ihres Herzens vermählen, wie alle Geschöpfe in diesem gesegneten Sommer es tun?«
Er nahm den Hut ab und strich sich mit der Hand über die Stirne.
»Der schöne Sommer«, fuhr er fort, »ist ein Bundesgenosse für Charlotte geworden. Sehen Sie, dieser Reichtum, diese Freundlichkeit, diese allgemeine Lebenslust hat mich berauscht. Ich bin umhergegangen wie ein Blinder. Charlotte hat meine Liebe und auch meine Sehnsucht, meinen Wunsch, sie zu besitzen, wachsen sehen.
Ach, Sie wissen ja nicht … Jeden Morgen gegen sechs Uhr gehe ich von dem kleinen Anbau, in dem meine Zimmer liegen, hinüber in das Haupthaus, um meinen Morgenkaffee zu trinken. Da kommt mir Charlotte in dem großen hellen Esszimmer, wo die Luft durch die offenen Fenster hereinströmt, entgegen. Sie ist fröhlich und zwitschert wie ein Vöglein, und wir trinken unseren Kaffee zusammen, wir zwei allein. Weder der Propst noch seine Frau sind dabei.
Sie glauben vielleicht, Charlotte nehme die Gelegenheit wahr, mit mir von unserer Zukunft zu sprechen. Oh, ganz gewiss nicht! Sie spricht mit mir über meine Armen, meine Kranken, sie spricht über die Gedanken in meiner Predigt, die ihr am meisten zu Herzen gegangen sind. Sie zeigt sich in allen Dingen so, wie es sich für eine gute Pfarrfrau gehört. Nur einzelne Male, ganz im Vorbeigehen, nur scherzhaft, spricht sie auch von dem Lektorat. So ist sie mir Tag für Tag lieber geworden. Wenn ich dann wieder an meinem Schreibtisch sitze, wird mir das Arbeiten schwer. Ich träume von Charlotte. Ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, wie ich mein Leben einzurichten gedenke. Nun träumte ich davon, wie meine liebe Charlotte sich von all den weltlichen Ketten loslöst und sie mir freudig in meine kleine graue Hütte folgt.«
Bei diesem Bekenntnis konnte Thea Sundler einen Ausruf nicht unterdrücken.
»Gewiss haben Sie recht«, sagte er. »Ich bin blind gewesen. Charlotte hat mich an einen Abgrund geführt. Sie hat nur einen Augenblick der Schwachheit abgewartet, um mir das Versprechen abzulocken, mich um ein Lektorat zu bewerben. Sie sah, wie dieser Sommer dazu beitrug, mich sorglos zu machen. Sie glaubte sich sicher am Ziel, und so hat sie Sie und alle die andern auf meinen Berufswechsel vorbereitet. Aber Gott hat mich beschützt.«
Noch einmal trat Karl Artur auf Thea Sundler zu. Er las vielleicht auf ihrem Gesicht, dass seine Worte ihr Freude machten, dass sie sich glücklich darüber fühlte. Aber nun schien es ihn zu reizen, dass sie sich an der durch sein Leiden hervorgerufenen Beredsamkeit erfreute. Ein schmerzlicher Zug flog über sein Antlitz.
»Glauben Sie nur ja nicht, ich freue mich über das, was Sie mir gesagt haben!«, brach er los.
Thea Sundler erschrak. Er ballte die Fäuste und schüttelte sie.
»Ich danke es Ihnen nicht, dass Sie mir die Binde von den Augen gerissen haben. Sie sollen sich nicht über das freuen, was Sie soeben gehört haben! Ich hasse Sie, weil Sie mich nicht in den Abgrund stürzen ließen. Ich will Sie nie wieder sehen.«
Er wandte sich ab und eilte den schmalen Pfad zwischen Frau Sundlers schönen Rosen hinab der Landstraße zu. Aber Thea Sundler ging in ihr Stübchen, warf sich in ihrer Zerknirschung auf den Fußboden und weinte, wie sie noch nie geweint hatte.
Im Garten der Propstei
Die kurze Strecke vom Kirchdorf bis in die Propstei nahm für jemand, der so rasch und stürmisch dahinging wie Karl Artur, nicht mehr als fünf Minuten in Anspruch. Aber während dieser fünf Minuten überlegte er sich viele strenge und stolze Gedanken, mit denen er seine Braut zu beglücken gedachte, sobald er mit ihr zusammentreffen würde.
»Ja«, murmelte er, »der rechte Augenblick ist gekommen. Nichts soll mich abhalten. Heute noch muss es zu einer Entscheidung kommen. Sie muss endlich einsehen, dass trotz aller meiner Liebe zu ihr mich nichts bewegen kann, nach den weltlichen Vorteilen zu trachten, die sie anstrebt. Ich habe keine Wahl, ich muss Gott dienen. Eher will ich sie aus meinem Herzen reißen.«
Stolze Zuversicht erfüllte ihn. Er fühlte es deutlich, heute standen ihm Worte zur Verfügung, um zu zerknirschen, zu rühren, zu überzeugen. Die heftige Gemütsbewegung hatte sein Innerstes in Wallung versetzt, und eine Tür war aufgerissen worden, die in einen Raum seiner Seele führte, in den er bisher noch nie geblickt hatte. In diesem Raum waren die Wände mit reichen Trauben und schönen Blumenranken behängt. Aber diese Trauben und Ranken waren Worte, herrliche, klare, formvollendete Worte. Er brauchte nur hinzutreten und sich ihrer zu bemächtigen. Alles dies stand zu seiner Verfügung. Es war ein Reichtum, ein unerhörter Reichtum.
Er lachte über sich selbst. Bis jetzt hatte er seine Predigt stets mit großer Mühe zusammengebracht, er hatte die Gedanken gleichsam aus seiner Seele herausquälen müssen. Und doch hatte dieser Reichtum die ganze Zeit über in ihm gelegen!
Was Charlotte betraf, so durfte es so nicht länger bleiben. Wahrhaftig, bisher war sie es gewesen, die versucht hatte, ihn zu beherrschen. Das musste anders werden. Er würde reden, sie zuhören. Er würde führen, sie folgen. Von nun an sollten ihre Blicke an seinem Munde hängen wie vorhin die der armen Organistenfrau.
Das gab natürlich Streit, aber nichts sollte ihn dazu bringen nachzugeben.
»Lieber reiße ich sie aus meinem Herzen!«, rief er aus.
Gerade als er vor der Propstei angelangt war, flog die Gittertür auf und ein eleganter, von vier Rappen gezogener Wagen fuhr heraus.
Es war ihm klar, nun hatte der Hüttenbesitzer Schagerström einen Besuch in der Propstei gemacht. Zugleich erinnerte er sich an Charlottes Äußerung bei jener Kaffeegesellschaft am Anfang des Sommers. Wie ein Blitz fuhr es ihm durch den Kopf, Schagerström sei in die Propstei gekommen, um seine Braut zur Frau zu begehren.
Das war ein unsinniger Gedanke; aber trotzdem krampfte sich ihm das Herz zusammen.
War das nicht ein ganz besonderer Blick, den der reiche Mann ihm zuwarf, als der Wagen auf die Landstraße einbog? Lag nicht eine spöttische Neugier darin und zugleich etwas wie Mitleid?
Nein, er konnte nicht zweifeln. Er hatte recht geraten. Aber das war doch ein gar zu schwerer Schlag. Sein Herz stockte, und es wurde ihm schwarz vor den Augen. Er hatte gerade noch so viel Kraft, sich bis ans Gartentor zu schleppen.
Charlotte hatte Ja gesagt. Er würde sie verlieren. Er würde vor Verzweiflung sterben.
Mitten in diesem Kummer sah er Charlotte aus dem Wohnhause treten und eilig auf ihn zukommen. Er sah die erhöhte Farbe ihrer Wangen, den Glanz ihrer Augen, die Siegermiene um den Mund. Nun kam sie, um ihm zu erklären, dass sie den reichsten Mann in Korskyrka heiraten werde.
Oh, diese Schamlosigkeit! Er stampfte mit dem Fuß auf und ballte die Fäuste. »Komm mir nicht nahe!«, rief er.
Sie blieb jäh stehen. Heuchelte sie, oder war ihr Erstaunen echt?
»Was hast du denn?«, fragte sie gänzlich unbefangen.
Er nahm seine ganze Kraft zusammen, um ihr antworten zu können.
»Das weißt du besser als ich!«, rief er. »Was hatte Schagerström hier zu tun?«
Nun begriff Charlotte. Karl Artur hatte also Schagerströms Vorgehen erraten. Sie trat dicht auf Karl Artur zu und hob die Hand auf. Beinahe hätte sie ihn geschlagen.
»So, so, also auch du glaubst, ich würde mein Wort eines Haufen Geldes wegen brechen?«
Damit warf sie ihm einen verachtungsvollen Blick zu, wandte ihm den Rücken und ging ihrer Wege.
Jedenfalls hatten ihre Worte nun seine schlimmsten Befürchtungen besänftigt. Sein Herz fing wieder an zu pochen, die Kräfte kehrten ihm zurück. Er war imstande, ihr zu folgen.
»Aber er hat doch jedenfalls um dich angehalten?«, sagte er. Sie würdigte ihn keiner Antwort. Ihr Rücken und ihr Nacken steiften sich, und sie setzte ihren Weg fort. Aber sie ging nicht ins Haus zurück, sondern bog in einen schmalen Pfad ein, der durch allerlei Buschwerk in den Garten führte.
Karl Artur fühlte, dass sie ein Recht hatte, verletzt zu sein. Hatte sie Schagerström abgewiesen, so hatte sie etwas wirklich Großartiges getan. Er versuchte, sich zu entschuldigen.
»Du hättest sein Gesicht sehen sollen, als er an mir vorbeifuhr. Er sah nicht aus, als hätte er einen Korb bekommen.« Da richtete sie sich nur noch trotziger auf und beschleunigte ihre Schritte. Sie brauchte keine Worte zu verlieren. Ihre Haltung sagte deutlich genug: »Komm mir nicht nahe! Ich will allein sein!«
Aber er, der jetzt immer mehr die Treue und Aufopferung ihrer Handlungsweise begriff, folgte ihr immerzu.
»Charlotte«, sagte er, »meine geliebte Charlotte!«
Sie ließ sich nicht rühren. Unentwegt schritt sie die Gartenwege entlang.
Ach, dieser Pfarrgarten, dieser Pfarrgarten! Charlotte hätte ihre Schritte nach keinem Ort richten können, der reicher an süßen Erinnerungen gewesen wäre.
Der Garten war in altfranzösischem Stil angelegt, mit vielen sich kreuzenden Wegen, die alle mit mannshohen Syringenhecken eingefasst waren. Da und dort befanden sich schmale Öffnungen in diesen Hecken, durch die man in kleine enge Lauben mit einer einzigen Moosbank oder auf grüne Rasenflächen, in denen ein einsamer Rosenbusch stand, gelangte. Es war kein sehr großer Garten. Er war auch vielleicht nicht einmal schön; aber welch ein wunderbarer Zufluchtsort war er für solche, die sich allein zusammenfinden wollten!
Während Karl Artur Charlotte nacheilte, die ihm nicht den mindesten Blick gönnte, wachte die Erinnerung an alle die Stunden in ihm auf, da sie als eine zärtliche Geliebte hier mit ihm gewandelt war. Stunden, die nun nie wiederkehren würden.
»Charlotte!«, stieß er noch einmal hervor mit einer Stimme, die vor Kummer bebte.
Es musste etwas in seiner Stimme gelegen haben, das sie zum Nachgeben zwang. Sie wandte sich zwar nicht um; aber die trotzige Haltung verschwand. Sie blieb stehen und beugte den Kopf so weit zurück, dass er beinahe ihr Gesicht sehen konnte.
Da war er auch schon neben ihr, schloss sie in seine Arme und küsste sie.
Dann zog er sie mit sich in eine der Lauben mit einer Moosbank darin. Dort fiel er vor ihr auf die Knie und erging sich in Bewunderung ihrer Treue, ihrer Liebe, ihres Heldenmutes.
Sie schien erstaunt über sein Feuer, sein Entzücken. Fast misstrauisch hörte sie ihm zu. Und er wusste wohl, warum. Er war ihr gegenüber immer etwas abweisend gewesen; hatte sie ihm doch die Welt und ihre Verlockungen verkörpert, gegen die er auf seiner Hut sein musste!
Aber in diesem holden Augenblick, wo er wusste, dass sie seinetwegen der Versuchung eines großen Reichtums widerstanden hatte, brauchte er sich keinen Zwang aufzuerlegen. Sie wollte ihm von der Werbung Bericht erstatten, aber er hörte kaum zu und unterbrach sie immer wieder durch seine Küsse.
Als sie ausgeredet hatte, musste er sie abermals unzählige Male küssen, und schließlich saßen sie ganz still nebeneinander.
Wo waren nun die strengen, stolzen Worte, die er ihr hatte sagen wollen? Vergessen – ausgewischt aus der Erinnerung. Er bedurfte ihrer nicht mehr. Nun wusste er, dass das geliebte Mädchen niemals eine Gefahr für ihn bedeuten könnte. Sie war keine Sklavin des Mammons, wie er gefürchtet hatte. Welchen Reichtum hatte sie heute verschmäht, um ihm treu zu bleiben!
Wie sie so in seinen Armen lag, spielte ein leichtes Lächeln um ihre Lippen. Sie sah sehr glücklich aus, glücklicher als je zuvor. Woran dachte sie? Vielleicht sagte sie in diesem Augenblick zu sich selbst, sie begehre nichts als seine Liebe allein, vielleicht gab sie den Gedanken an das Lektorat auf, das beinahe die Ursache der Trennung für sie geworden wäre.
Sie sagte nichts, aber er lauschte ihren Gedanken.
»Lass uns nur bald zusammenkommen! Ich stelle keine Bedingungen, ich will nichts als deine Liebe!«
Aber sollte er sich an Edelmut von ihr übertreffen lassen? Nein, er wollte ihr die größte Freude bereiten. Er wollte ihr zuflüstern, jetzt, da er ihre Gesinnung kenne, werde er es auch wagen. Jetzt wolle er versuchen, sich und ihr einen anständigen Lebensunterhalt zu verschaffen.
Wie süß war doch dieses Schweigen! Ob sie wohl hörte, was er zu sich selber sagte? Hörte sie das Versprechen, das er ihr gab?
Er machte eine Anstrengung, seine Gedanken in Worte zu kleiden.
»Ach, Charlotte!«, begann er. »Wie soll ich dir je vergelten können, was du um meinetwillen verschmäht hast?«
Ihr Haupt lehnte an seiner Schulter, und so konnte er ihr Gesicht nicht sehen.
»Mein Liebster«, hörte er sie erwidern, »ich bin gar nicht bange. Ich weiß, du wirst mir vollen Ersatz dafür bieten.«
Ersatz – was meinte sie damit? Wollte sie sagen, sie begehre als Ersatz nichts als seine Liebe? Oder meinte sie etwas anderes. Weshalb hielt sie den Kopf gesenkt? Warum sah sie ihm nicht ins Auge? Hielt sie ihn für eine so ärmliche Partie, dass sie Ersatz heischte, weil sie ihm treu geblieben war? Er war ja doch Geistlicher und Doktor der Philosophie und der Sohn angesehener Eltern, hatte immer versucht, seine Pflichten zu erfüllen, war im Begriff, sich einen Namen als Prediger zu machen, und hatte einen tadellosen Lebenswandel geführt. Glaubte sie wirklich, es sei eine gar so große Entsagung gewesen, Schagerström abzuweisen?
Nein, natürlich dachte sie gar nicht an so etwas. Er musste ruhig sein, mit Sanftmut und Milde ihre Gedanken zu erforschen suchen.
»Was verstehst du unter Ersatz? Ich habe dir ja doch gar nichts zu bieten.«
Da schmiegte sie sich dichter an ihn, sodass sie ihm ins Ohr flüstern konnte: »Du hast eine viel zu geringe Meinung von dir selbst, mein Geliebter. Du kannst sowohl Dompropst als auch Bischof werden.«
Da riss er sich so heftig von ihr los, dass sie fast gefallen wäre.
»Also, weil du Schagerström abgewiesen hast, soll ich Dompropst oder Bischof werden, das erwartest du nun von mir?«
Sie sah verwirrt zu ihm empor, als erwache sie aus einem Traum. Ja, gewiss, sie hatte geträumt, hatte im Schlaf gesprochen und im Schlaf ihre geheimsten Gedanken verraten. Sie erwiderte nichts. Glaubte sie, diese Fragen bedürften keiner Antwort?
»Ich frage dich, ob du meinst, ich solle Dompropst oder Bischof werden, weil du Schagerström abgewiesen hast?«
Nun stieg ihr die Röte in die Wangen. Aha, das Löwensköldsche Blut kam in Wallung! Doch noch immer würdigte sie ihn keiner Antwort.
Aber Antwort wollte er haben, Antwort musste er haben. »Hörst du nicht? Ich frage dich, ob du erwartest, dass ich Dompropst oder Bischof werden soll, weil du Schagerström abgewiesen hast?«
Sie warf den Kopf in den Nacken, ihre Augen blitzten. Im Ton tiefster Verachtung warf sie ihm hin: »Selbstverständlich!«
Nun stand er auf. Er wollte nicht länger neben ihr sitzen.
Sein Schmerz über ihre Antwort war grenzenlos, aber er wollte das einem solchen Geschöpf, wie diese Charlotte es war, nicht zeigen. Doch wollte er sich auch nichts vorzuwerfen haben. Er machte noch einen Versuch, freundlich mit diesem verlorenen Weltkind zu sprechen.
»Liebe Charlotte, ich kann dir für deine Aufrichtigkeit nicht dankbar genug sein. Jetzt weiß ich, dass dir die äußere Stellung alles bedeutet. Ein tadelloser Wandel, ein treues Bestreben, in Christi, meines Meisters, Fußstapfen zu wandeln, hat für dich keinen Wert.«
Schöne und friedliche Worte. Er erwartete ihre Antwort mit Spannung.
»Lieber Karl Artur, ich glaube schon, dass ich deinen Wert richtig schätzen kann; auch wenn ich nicht vor dir katzbuckle wie die Weiber in der Gemeinde.«
Diese Antwort erschien ihm als richtige Grobheit, ihr Ärger machte sich Luft.
Charlotte stand auf, um ihrer Wege zu gehen. Aber er fasste sie am Arm und hielt sie fest. Diese Unterredung musste zu Ende geführt werden.
Charlottes Äußerung über die Weiber in der Gemeinde hatte ihm Frau Sundler in Erinnerung gebracht. Er dachte an das, was sie ihm berichtet hatte, und dadurch wurde sein Zorn aufs Neue angefacht. Es kochte in ihm.
Die Gemütsbewegung riss die Tür in seiner Seele auf, die in den Raum führte, worin die großen, starken Worte als Trauben an Ranken hingen. Nun begann er, streng und ermahnend zu ihr zu reden. Er warf ihr ihre Weltliebe vor, ihren Hochmut, ihre Eitelkeit.
Aber Charlotte hörte ihm nicht lange zu.
»So minderwertig ich auch bin, so habe ich doch Schagerström abgewiesen«, erinnerte sie ihn in sanftem Ton.
Er entsetzte sich über ihre Schamlosigkeit.
»Großer Gott, was ist das für ein Weib!«, brach er los. »Hat sie doch soeben erst bekannt, dass sie Schagerström nur abgewiesen hat, weil sie sich mehr davon versprach, mit einem Bischof verheiratet zu sein als mit einem Hüttenbesitzer!«
Während dieses ganzen Auftritts sprach in seiner Seele eine leise, besänftigende Stimme. Diese flüsterte ihm zu, er möge sich in Acht nehmen. Ob er denn noch nie bemerkt habe, dass Charlotte Löwensköld eine von denen sei, die es verschmähen, sich zu rechtfertigen? Wenn jemand schlecht von ihr denke, so versuche sie es nie, ihm diese üble Meinung zu nehmen.
Aber Karl Artur hörte nicht auf diese leise besänftigende Stimme. Er glaubte ihr nicht. Charlotte enthüllte mit jedem Wort neue Tiefen der Niedertracht. Man musste nur ihre Antwort hören!
»Lieber Karl Artur, reite doch nicht immer auf dem herum, dass ich sagte, du solltest höher hinauf. Es war doch nur Scherz. Ich glaube ja gar nicht, dass du es jemals zum Dompropst oder Bischof bringen kannst.«
War er schon vorher verletzt, empört, so musste vor diesem neuen Ausfall die besänftigende Stimme schweigen.
Das Blut brauste ihm in den Ohren. Seine Hände bebten. Diese Unglückselige raubte ihm alle Selbstbeherrschung. Sie machte ihn verrückt.
Er wusste, dass er vor ihr auf und nieder hüpfte. Er wusste, dass seine Stimme zum Geschrei wurde. Er wusste, dass er die Arme in die Luft reckte und dass sein Kinn zitterte. Aber er machte keinen Versuch, sich zu beherrschen. Er fühlte einen unbeschreiblichen Abscheu vor Charlotte, der sich nicht in Worte fassen ließ. Nein, er musste sich in Bewegungen Luft machen.
»All deine Schlechtigkeit ist mir nun offenbar!«, rief er. »Ich sehe dich so, wie du bist. Nie – nie – nie werde ich mich mit jemand verheiraten, wie du bist. Es würde mein Verderben sein.«
»In einigem bin ich dir aber doch von Nutzen gewesen«, erwiderte sie. »Du hast es doch nur mir zu danken, dass du Lizentiat und Doktor der Philosophie bist.«
Von nun an war es nicht mehr er selber, der ihr antwortete. Nicht, als ob er nicht gewusst hätte, was er sagte oder dachte, aber die Worte kamen doch überraschend und unerwartet. Ein anderer als er legte sie ihm auf die Lippen.
»Ei sieh!«, rief er. »Nun will sie mich daran mahnen, dass sie fünf Jahre auf mich gewartet hat und ich infolgedessen gezwungen sei, sie zu heiraten. Aber es nützt nichts. Ich werde keine andere heiraten als die, so Gott selber für mich erwählt.«
»Sprich nicht von Gott!«, mahnte sie.
Er erhob das Haupt und warf es zurück. Er schien in den Wolken zu lesen. »Ja, ja, ich will Gott für mich wählen lassen! Das erste ledige weibliche Wesen, das mir begegnet, soll meine Frau werden.«
Charlotte schrie auf. Sie eilte auf ihn zu.
»Aber Karl Artur, Karl Artur!«, rief sie und versuchte, einen seiner Arme herabzuziehen.
»Komm mir nicht nahe!«, schrie er.
Aber sie erfasste nicht das Maß seiner Wut. Sie umschlang ihn mit ihren Armen.
Da hörte sie einen Laut des Abscheus seiner Kehle entsteigen. Seine Hände packten die ihrigen mit eisernem Griff und warfen das Mädchen auf die Moosbank zurück.
Dann stürmte er fort von ihr.