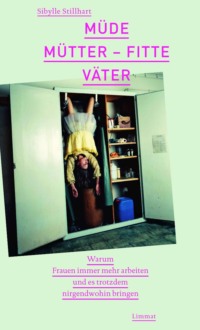Kitabı oku: «Müde Mütter - fitte Väter», sayfa 2
«Fahren wir nach Syrien in die Ferien?»
Trotzdem verfolgen mich Sätze wie jene von Jesper Juul. «Die Erwachsenen kommen mit ihrem gehetzten Leben immer weniger gut zurecht. Sie arbeiten, verdienen Geld, besorgen das Essen, bringen ihre Kinder weg, holen sie wieder ab. Und bei alldem gibt es kein Leben mehr», sagte der Erziehungsberater auch. Hm, denke ich, da hat er schon recht. Seine Worte sind ebenfalls als Kritik an unserem Wirtschaftssystem zu verstehen: «Es geht um das politische Interesse des jeweiligen Landes, ökonomisch mit anderen Ländern Schritt zu halten und konkurrieren zu können. Weshalb es notwendig ist, dass Eltern bereits kurze Zeit nach der Geburt wieder produktiv arbeiten können und wir deshalb die Kinderbetreuung am besten gleich in eine fünfjährige Vorschulzeit umwandeln. Das erinnert sehr an die Zeit der frühen Industrialisierung, als die Fabrikbesitzer von einer direkten Verknüpfung zwischen Mensch und Maschine geträumt haben.»6
Bislang sah ich mich als Feministin, die nicht umsonst jahrelang die Schulbank gedrückt hat, um nach einer Geburt alles an den Nagel zu hängen: Meine Unabhängigkeit. Mein Wissen. Mein altes Leben. Noch ohne Kinder konnte ich mir nur schleierhaft vorstellen, wie es ist, zusätzlich für ein weiteres Leben, das zwangsläufig von mir abhängig ist, verantwortlich zu sein. Ich gebe zu, dass ich meine Gefühle nicht miteinberechnet hatte, als ich damals über die Fremdbetreuung meines noch ungeborenen Nachwuchses entschieden hatte. Nun sind sie aber da, diese Gefühle, die mich exakt, seit ich Artur das erste Mal nach der Geburt in die Arme geschlossen hatte, übermannt haben. Seither habe ich mir geschworen, dieses kleine, unschuldige Wesen zeit seines Lebens zu beschützen, komme, was wolle.
Viertel nach zwölf. Ich werde aus meinen Gedanken gerissen, weil sich die Kollegen in die Mittagspause verabschieden. Ich mache keine, weil ich sonst nicht durchkomme mit der Arbeit – oder eher: weil ich sonst nicht auf meine Stunden kommen würde –, kaue an einem trockenen Sandwich aus der Kantine, trinke Leitungswasser. Später beim Kaffeeautomaten stosse ich auf meinen französischen Kollegen, der ebenfalls den Mittag im Büro verbringt. Er schaufelt einen Magerquark, obwohl er beängstigend dünn ist.
«Lucien, darf ich dich etwas fragen?», spreche ich ihn an.
«Mais oui», antwortet er, wie immer äusserst charmant.
«Sag mir, wie machen das eigentlich die französischen Frauen? Ich höre immer wieder, wie problemlos ihnen der Spagat zwischen Beruf und Familie gelingt.»
Lucien guckt mich an, als ob ich ihm Drogen zum Kauf angeboten hätte.
«Mais, was glaubst du denn?», sagt er, der Unterton seiner Stimme ziemlich vorwurfsvoll. «Müssten die Frauen nicht wegen des Geldes arbeiten, weil der Lohn ihres Mannes nicht ausreicht, würden sie sich den Stress niemals antun.»
Nun bin ich diejenige, die glotzt, als rede ich mit einem Marsmenschen.
Lucien macht eine Bewegung mit dem gestreckten Zeigefinger zu seinem Mund. «In Frankreich dürfte ich das niemals laut sagen», fügt er an. «Aber es ist die Wahrheit. Alle wissen das.» Ich zwinge mich zu einem Lächeln und kehre zurück in mein Büro. Er ist tatsächlich sehr konservativ, denke ich.
Der Nachmittag verläuft ereignislos. Ich arbeite an einem Kommunikationskonzept, das mein Vorgesetzter einst von mir gefordert hat, zähle die Minuten und mache mich Punkt 17 Uhr auf, um in die Krippe zu hetzen. Von den obligaten 8 Stunden 20 Minuten habe ich heute nur 7 Stunden 15 Minuten geschafft, obwohl mein Tag bereits um halb sechs Uhr früh begonnen hat. Ich dränge mich ins Tram, harre stehend die fünf Haltestellen in der Büromenschenmenge aus. In der Kita erwarten mich zwei freudenstrahlende Buben, doch ich sehe auf den ersten Blick, dass sie todmüde sind. Ein guter Tag sei es gewesen, sagt die junge Praktikantin, kaum älter als sechzehn Jahre alt. Ich bin ein wenig beruhigt. Ich ziehe den Buben Jacke, Kappe, Handschuhe und Schuhe an, mahne Artur, sich nicht auf dem nassen Fussboden zu wälzen, verlasse die Kita mit Linus im Buggy und Artur an meiner Hand, da er nun keine Lust mehr hat, mit dem Like-a-bike zu fahren. Wir machen noch kurz einen Abstecher in den Supermarkt, um das Nötigste fürs Abendessen zu kaufen. Es muss schnell gehen, deshalb stehe ich (Blut) schwitzend in der Schlange, innerlich betend, dass die Kinder vor Müdigkeit nicht ausrasten mögen.
Zu Hause trage ich Linus die drei Stockwerke hoch, zusammen mit der Einkaufstüte, derweil Artur meine Hand halten möchte, um die Treppen hinaufzusteigen. «Mama! Gib mir deine Hand!» Schwer atmend schlüpfe ich aus dem Mantel, ziehe die Kinder aus, eile in die Küche um Linus die Milchflasche zu richten, während er bereits zu schreien beginnt und seinen Kopf auf den Boden schlägt. Artur quengelt, er will Schokolade und eine Erklärung, weshalb es vor dem Abendessen nicht gut ist, Schokolade zu essen. «Warum nicht, Mama?! Warum?»
Eilig verteile ich die Flaschen (natürlich will auch Artur eine), dann tische ich Brot, Salami, Joghurt, Cornflakes auf, damit die Kleinen essen können – doch weder Linus noch Artur haben Lust darauf. Sie quengeln, schmeissen das Essen auf den Boden. Nach fünf Minuten breche ich die Übung ab, nehme den schreienden Linus und versuche ihn ins Pyjama zu stecken, während Artur das Sandmännchen im Fernsehen gucken darf. Als ich es geschafft habe, Linus zu beruhigen, lege ich ihn ins Bett, lösche das Licht und verharre eine Viertelstunde in seinem Zimmer, bis er endlich eingeschlafen ist. Dann eile ich zurück in die Stube, wo mittlerweile die Tagesschau läuft und Artur gebannt vor dem Kasten sitzt:
«Mama, weshalb fahren diese Männer einen Panzer? Und wieso haben die so viele Pistolen und Gewehre?»
«Das sind syrische Rebellen, die sind im Krieg mit ihrer Regierung», versuche ich zu erklären.
«Fahren wir dorthin in die Ferien?»
«Nein, sicher nicht – dort ist Krieg und die Menschen leiden sehr darunter, und nun komm, du musst das Pyjama anziehen.»
«Nein! Ich will nicht ins Bett! Ich will warten, bis Papa heimkommt!»
Ich schalte den Kasten ab, gehe in die Küche, räume das Geschirr vom Morgen- und Abendessen in die Spülmaschine und hoffe auf die Vernunft des Erstgeborenen, der sich nun seinen Legos widmet.
Eine halbe Stunde später sitzt Artur im Bett – in meinem, damit er Linus im Kinderzimmer nicht weckt –, dort guckt er Bilderbücher an und hört eine Märchen-CD von Trudi Gerster. Zum Glück wird er eine weitere halbe Stunde später vom Schlaf übermannt, derweil ich wie eine Kartoffel auf dem Sofa liege, das Notebook auf meinem Bauch, und hirnlos im Internet surfe. Um halb zehn schleppe ich mich ins Bett, wo Artur – alle viere von sich gestreckt – den ganzen Platz für sich beansprucht. Ich quetsche mich seitlich auf eine ungefähr zehn Zentimeter breite Fläche, die noch übrig ist. Fünf Minuten später höre ich den Schlüssel im Schloss drehen. Mein Mann kommt heim. Um halb elf Uhr erwacht Linus, er schreit, ich hole ihn auch zu mir ins Bett. Wir schlafen nun zu dritt im Doppelbett, während mein Mann im Kinderzimmer übernachtet. Um ein Uhr will Linus Milch, um vier schreit er nochmals und um sechs ist es Artur, der erwacht. Ein neuer Tag beginnt. Guten Morgen allerseits. Meine Glieder schmerzen.
«Einigermassen gerecht» verteilte Hausarbeit
Ich arbeite 50 Prozent als Kommunikationsverantwortliche für eine Bundesbehörde, mein Mann hat ein Pensum von 85 Prozent als leitender Journalist inne. Er arbeitet vier Tage die Woche und einmal im Monat am Sonntag. Er möchte sich auch an der Erziehung der Kinder beteiligen, sagt er, nicht nur ein Wochenend-Papa sein. Nun ist der Freitag der sogenannte Papa-Tag, an dem mein Mann das Programm mit den Kindern bestreitet, derweil ich ins Büro gehe. Mit Oliver habe ich ursprünglich – also bevor die Kinder da waren – ausgehandelt, den Alltag mit den Kindern und den Haushalt «einigermassen gerecht» zu verteilen. Bevor der Nachwuchs da war, kümmerte ich mich vor allem darum, dass die Wohnung ab und zu geputzt wurde. Dafür kaufte er ein und war für handwerkliche Dinge verantwortlich. Was das Kochen anbelangte, waren wir beide der Meinung, dass es interessantere Dinge gebe – eher gingen wir ins Restaurant oder bestellten Leckereien beim Inder. Um die Wäsche kümmerte sich jeder selbst. Nachdem die Kinder da waren, hat sich diesbezüglich einiges verändert. Sagen wir es so: Oliver kümmert sich immer noch um seine Wäsche. Er bringt seine Hemden in die Wäscherei und wäscht am Wochenende seine Unterwäsche und Socken. Den Rest besorge ich.
Als ich nach dem Mutterschaftsurlaub zurück ins Büro ging, war geplant, dass mein Mann Artur an zwei Tagen in die Kita bringt, während ich direkt mit dem Velo ins Büro radle, dafür Artur abends abhole, damit mein Mann länger arbeiten kann. Organisatorisch klappte das die ersten Wochen mehr oder weniger problemlos, obwohl ich den Kleinen doch häufiger brachte, als abgemacht war; oft musste Oliver früher zur Arbeit oder hatte eine früh anberaumte Sitzung. War Artur krank, sprang ebenfalls ich in die Bresche, für den Krippenwechsel war ich allein verantwortlich.
Drei Tage nach Arturs zweitem Geburtstag kam Linus auf die Welt. Pünktlich zur Geburt wurde mein Mann befördert. Was mich freute. Anderseits fragte ich mich, wie ich nun den Alltag mit den zwei kleinen Kindern bewältigen würde, wenn mein Mann in eine andere Stadt pendeln musste. Er verliess nun bereits um sieben Uhr früh das Haus, um Punkt acht Uhr an seinem Arbeitsplatz zu erscheinen. Die Kinder in die Krippe bringen? «Das liegt nun leider nicht mehr drin – ich kann sie ja nicht schon um Viertel vor sieben Uhr vor der geschlossenen Krippentür abstellen.» Klar. Das ging nicht. Deshalb übernahm ich nun diesen Part meines Mannes ebenfalls, ohne mir ganz bewusst gewesen zu sein, was genau ich mir da aufhalste. Abends kam Oliver gewöhnlich zwischen 21 Uhr und 23 Uhr nach Hause, meistens schlafen die Kinder dann bereits. Ich auch. Er trage, sagte er, als Mitglied der Redaktionsleitung grosse Verantwortung. Es ist ihm deshalb nie möglich, einmal etwas früher von der Arbeit zu kommen, um die Kinder von der Krippe abzuholen. Dafür hat Oliver immer noch seinen Papa-Tag, den Freitag. Was für einen Kadermitarbeiter höchst aussergewöhnlich sei, wie man ihm immer einmal wieder mitteilt. Deshalb legt sich mein Mann an den restlichen Tagen umso mehr ins Zeug.
Mit meinem 50-Prozent-Pensum arbeite ich am Montag, Dienstag und am Freitag. Mittwochs und donnerstags bleibe ich bei den Kindern zu Hause. Wir gehen dann einkaufen, ich wasche ihre Kleider, koche das Mittagessen, bringe Linus ins Zimmer für seinen Mittagsschlaf, der aber nur erfolgt, wenn ich Linus’ Hand halte (minutenlang), räume dann später die Küche auf, die Spielsachen, die Stube, schaue mit Artur ein Bilderbuch an, bis Linus nach einer guten halben Stunde wieder erwacht. Nachmittags gehen wir dann raus auf den Spielplatz oder in den Wald, abends gibt es wieder Abendessen, Pyjama, Zähneputzen, Sandmännchen und ab in die Federn.
Ich liebe meine Kinder über alles. Es ist eine unbegrenzte, sehr tiefe Liebe, die mich, seit sie auf der Welt sind, erfüllt und die mir manchmal beinahe den Verstand raubt, wenn ich mir vorstelle, dass ihnen etwas zustossen könnte. Seit ich Mutter bin, bin ich zur Löwin geworden. Ich bin, ungefragt, zu allem bereit, um meine Kinder zu schützen. Ihre Existenz verleiht meinem Leben Sinn; seit der Geburt meines älteren Sohnes stelle ich mir nicht mehr die zentnerschwere Frage, wofür ich eigentlich lebe. Heute ist klar, dass ich für meine Kinder leben will und muss, umso wertvoller erscheint mir nun auch mein eigenes Leben. Auch diese Dimension kannte ich in meinem kinderlosen Leben nicht.
Um den Alltag mit den Kindern zu bewältigen, funktioniere ich wie ein Rädchen. Ein ziemlich energieloses allerdings. Ich bin dauernd müde, erschöpft, und es kostet mich Kraft, mich über die Buben zu freuen. Hüpft Artur in eine Regenpfütze und jauchzt dabei vor Freude, denke ich: Oh nein! Die Kleider müssen heute noch gewaschen werden, damit er morgen in der Kita sauber angezogen ist. Das wird mich mindestens eine halbe Stunde kosten. Drei Stockwerke hinunter in die Waschküche, dann wieder die Treppen hinauf. Abends, wenn sie – hoffentlich endlich! – schlafen. Nur gequält lächle ich meinem Sohn zu. «Komm weiter, Artur! Wir müssen noch einkaufen gehen», treibe ich ihn an. Und denke: Sonst schläft Linus vor dem Mittagessen ein – und ich habe dann über Mittag erst recht keine freie Sekunde, um kurz auszuatmen. Tatsächlich bin ich nicht fähig, den Tag mit ihnen zu «geniessen», wie meine Mutter immer so schön zu mir sagt. «Geniess es, die Kinder wachsen so schnell!» Mein Unvermögen, mich zu freuen, schiebe ich der permanenten Müdigkeit zu, meinem Schlafmangel, den ich nicht aufzuholen imstande bin. Ich fühle mich ständig wie nach einem Marathon-lauf, ohne Möglichkeit, mich von der Anstrengung zu erholen.
Papa-Tag
Heute hat Oliver seinen Papa-Tag, er will mit den Kindern einen Ausflug in den Basler Zoo machen. Ich fahre mit dem Velo ins Büro, wo ich die Stunden, die ich die Tage zuvor wegen des Kita-Bring-und-Abhol-Dienstes nicht arbeiten konnte, aufholen muss. Im Büro stelle ich mir vor, wie Oliver unterwegs als «vorbildlicher Vater» anerkennende Blicke erntet. Er gilt als «moderner Vater», der sein Arbeitspensum reduziert hat, um sich vermehrt seinen Kindern zu widmen. In Wahrheit schuftet er unter der Woche so viel, dass sein Arbeitspensum locker als Vollzeit durchgehen würde. Durch seine Abwesenheit unter der Woche lastet der Haushalt zwangsläufig allein auf meinen Schultern. Ich hingegen gelte als berufstätige Mutter irgendwie immer noch als Rabenmutter, die ihre Kinder fremd betreuen lässt. Ebenfalls strapaziere ich durch meine Unflexibilität die Nerven meines Chefs: «Nein, das schaffe ich heute nicht mehr, ich schreibe den Brief nächste Woche, okay?» Oder: «Ich kann leider nicht, weil ich Linus von der Kita holen muss, er ist krank. Entschuldige bitte.» So dass ich in der nächsten Beförderungsrunde bestimmt nicht berücksichtigt werde.
Die Sekretärin erscheint in der Tür. Mit ihren violett geschminkten Lippen und den platinblond gefärbten Strähnchen macht sie zwar, sagen wir es so: einen aufgeweckten Eindruck, in Wahrheit ist sie aber bösartig und intrigant. Ich weiss, dass sie hinter meinem Rücken schnödet, dass ich wegen meiner Kinder zu oft fehle. Und dass sie selbst nicht ein einziges Mal krank «gefeiert» habe. Heute beklagt sie sich nun bei mir, wie viel sie zu tun habe und wie überlastet sie sei. Will sie mir etwas abtreten? Ich höre nur mit einem Ohr zu, tue, als ob ich tief konzentriert am Schreiben sei – in der Hoffnung, dass sie mich bald wieder in Ruhe lässt. Irgendwann geht sie. Ich widme mich dem Tätigkeitsbericht unserer Büroeinheit, für den ich verantwortlich bin, versuche das Juristen-Deutsch meiner Kollegen so zu übersetzen, dass auch die Öffentlichkeit versteht, was gemeint ist. Erneut mache ich keine Mittagspause, hole nur Wasser und begegne auf dem Flur dem neuen Vorgesetzten meines Chefs. Wir unterhalten uns höflich miteinander, er will mehr über die Herkunft meines Namens wissen, dann verabschiedet er sich abrupt. «Wissen Sie, ein wichtiges Mittagessen!» Er überreicht mir, ganz Herr alter Schule, seinen Füllfederhalter und bittet mich, ihn zurück in sein Büro zu bringen. Ich nicke, obwohl mich das irritiert. Was soll das? Würde er das auch von einem Mann verlangen? Um 14.30 Uhr verlasse ich das Büro, stemple aus. Danach gehe ich einkaufen.
Als ich mit zwei prallvollen Einkaufstüten heimkomme, ist die Wohnung leer, aber überall liegen die Spielsachen in der Wohnung verstreut. Das Frühstücksgeschirr ist nicht abgeräumt, Brotkrümel liegen auf dem Boden. Ich bringe alles in Ordnung, schütte die Bettdecken aus, öffne die Fenster, um die Räume zu lüften. Als ich nach einer knappen Stunde fertig bin, sinke ich müde aufs Sofa. Yes! Zeit für mich! Ich schlage die Zeitung auf und stosse auf einen Artikel7, der mich interessiert. Es geht um eine Mathematikerin, eine zweifache Mutter, die den Bettel nach zehn Jahren Doppelbelastung hingeschmissen hatte, ihren Job kündigte und sich von ihrem Mann scheiden liess. Sie hatte ein Arbeitspensum von 80 Prozent, während ihr Mann Vollzeit arbeitete. «Für Mütter gelten andere Regeln als für Väter», lässt sie sich zitieren. Von Frauen würde allgemein mehr Verzicht, mehr Verständnis, mehr Grosszügigkeit und mehr Anpassung gefordert. Da sie und ihr Mann dieselbe Ausbildung hatten und auch beide gleichzeitig ins Berufsleben starteten, habe es keinen Grund gegeben, weshalb sie mehr Hausarbeit übernehmen sollte. Es kam dann aber doch so, dass sie sich zusätzlich zu ihrem Arbeitspensum allein um Kinder und Haushalt kümmerte, während ihr Mann seine Karriere vorantrieb. Nach zehn Jahren brach sie zusammen.
Auch könne sie sich an ein Podiumsgespräch erinnern, an der ETH, als geladene Professorinnen darüber sprachen, wie sie Familie und Beruf unter einen Hut brächten. Die Frauen waren sich einig, dass es zwar schwierig sei, aber letztlich nur eine Frage der Organisation. Eine zuhörende Ärztin meldete sich zu Wort und widersprach: Sie glaube den Frauen da vorne auf der Bühne kein Wort – ihre Patientinnen schilderten ihr die Situation wesentlich weniger rosig, sie sprächen von Erschöpfung und davon, in jeder Hinsicht zu kurz zu kommen. Die Mathematikerin sagte, dass sie erst heute wisse, dass die Ärztin recht gehabt habe: Den Begriff Doppelbelastung verwende man nur im Zusammenhang mit berufstätigen Müttern – nicht im Zusammenhang mit berufstätigen Vätern. Und es mache sie wütend, dass berufstätige Mütter so tun, als ob alles überhaupt kein Problem wäre. «Keine steht hin und sagt: Es fordert mir das Letzte ab, weil die Gesellschaft immer noch mehr verlangt von einer Mutter als von einem Vater. Wer sich keine Nanny leisten kann – was für Mittelklassefamilien unmöglich ist –, ist permanent am Limit, trotz Krippe oder Hort.»
Die Sache mit der Nanny
Wobei das mit der Nanny nicht überschätzt werden darf, denke ich. Auch wir hatten für kurze Zeit eine Teilzeit-Nanny engagiert – für zwei Tage die Woche, was uns ungefähr gleich teuer kam wie die Kita-Plätze für die zwei Buben. Erinnern mag ich mich an diese Episode nur sehr ungern. Bekannte von uns, die in eine andere Stadt gezogen waren, mussten ihrer Kinderfrau kündigen und hielten deshalb Ausschau nach einer neuen Anstellung für sie. Weil sie gute Erfahrungen gemacht hatten, liessen wir uns zum Gedanken, selbst eine Nanny anzustellen, hinreissen. Eine Kinderfrau würde bedeuten, dass ich die Kinder nicht mehr morgens in die Kita bringen und abends abholen müsste. Was hiesse: weniger Stress für mich. Zudem hätten die Buben eine einzige Bezugsperson, die sich voll um sie kümmern würde. Ein sehr einladender Gedanke. Deshalb luden mein Mann und ich die Frau zum Vorstellungsgespräch ein.
Vor uns stand dann eine gut 50-jährige Frau mit langen, schwarz gefärbten Haaren, Jeans und T-Shirt. Sie war gelernte Kinderkrankenschwester, hatte eine Zusatzlehre als Kleinkindererzieherin gemacht und selbst zwei Söhne grossgezogen. Sie nahm auf dem Stuhl Platz, und gleich zu Beginn des Gesprächs machte sie uns klar, dass sie auf einen 13. Monatslohn verzichten würde, falls wir ihr dafür einen zusätzlichen Monat Ferien gestatten würden. Neun Wochen Ferien hiesse das. Ich schluckte, mein Mann nickte zustimmend. Zumindest ich liess mir nicht anmerken, wie erstaunt ich ob der Forderung war.
Zugegeben: Hätte ich die Lobgesänge meiner Bekannten nicht in meinen Hinterkopf gehabt, hätte ich wohl eher auf mein Bauchgefühl gehört. Doch ich war geblendet, wischte meine Bedenken beiseite. Offenbar handelte es sich hier um eine Top-Nanny. Und für das Wertvollste, was ich und mein Mann haben – nämlich unsere beiden Söhne – waren wir bereit, jeden Preis zu zahlen. Auch neun Wochen Ferien sollten da drinliegen, obwohl mir schleierhaft war, wie ich (mit einem Ferienkonto von fünf Wochen) diese Zeit überbrücken würde. Egal. Auch waren wir bereit, ihr einen anständigen Lohn zu bezahlen, der uns nun mit Bestimmtheit höher kam als die Kita-Kosten für beide Kinder – aber schliesslich wollten wir nicht knausrig sein. Es ging um unsere Buben. Wir engagierten sie.
Die ersten beiden Wochen lief alles ziemlich gut. Die Nanny war wie vereinbart an zwei Tagen die Woche bei uns zu Hause und lernte die beiden Buben kennen. Artur war damals vielleicht zweieinhalb Jahre alt, Linus ein paar Monate. Ganz klar erwarteten die Nanny zwei strenge Tage bei uns – mir war das bewusst. In den ersten Tagen verkürzten wir ihre Anwesenheitsdauer, damit die Kinder nicht überfordert waren. Sie kam morgens eine Stunde später, auf halb zehn Uhr, und verliess unsere Wohnung bereits um 16 Uhr wieder. Was für mich bedeutete, dass ich zwei Stunden zu wenig bei der Arbeit war. Wie soll ich diese Stunden nur wieder aufholen?, dachte ich mir. Wohl deshalb war ich nun doch etwas mehr gestresst, als ich mir das vorgestellt hatte. Immerhin hatte ich den Eindruck, dass die Kinder die Nanny mochten.
Bereits in ihrer dritten Arbeitswoche bat mich die Kinderfrau, ihre Arbeitstage für einmal zu tauschen. Ob das möglich sei, weil sie Möbel erwarte, die nur am Montag ausgeliefert würden, und genau dann müsse ihr Mann arbeiten. Okay, dachte ich, wenn das eine Ausnahme ist, werde ich versuchen, meine Tage im Büro abzutauschen. Allerdings ging es von nun an im gleichen Stil weiter. In der vierten Woche hatte sie Rückenschmerzen – sie führte das darauf zurück, dass sie die Buben oft tragen müsse, und bat mich deshalb, früher von der Arbeit heimzukommen. In der fünften hatte sie mit ihrem Sohn irgendwo abgemacht, wo sie das Postauto früher nehmen musste. In der Woche darauf fühlte sie sich nicht ganz gut. Und dann kamen nochmals Möbel, um die sie sich kümmern musste. Sehr oft in diesen wenigen Wochen musste sie früher als vereinbart nach Hause. Und ich deshalb auch.
Obwohl es den Kindern mit der Nanny zu gefallen schien, war ich gestresster denn je. Ich war diejenige, die sich nun nach den Bedürfnissen unserer Angestellten zu richten hatte, im Büro kam ich zu nichts. Die Situation eskalierte ein paar Wochen darauf, nach den zweiwöchigen Weihnachtsferien. Davor war ich es, die sie bat, in der Woche nach den Ferien statt am Montag doch am Mittwoch zu kommen, da wir an diesem Tag mittags unser verspätetes Büro-Weihnachtsessen hatten. Ich fragte sie bereits drei Wochen zuvor, ob das wohl möglich sei und sie meinte, dass sei überhaupt kein Problem. Drei Tage vor dem Termin – es war Sonntag, Ende der Ferien – piepste mein Handy. Die Nanny. Sie wisse nicht mehr, was wir nun eigentlich abgemacht hätten, ob sie nun tatsächlich am Mittwoch kommen müsste, fragte sie. Und ob dann nicht meine Mutter kommen könnte, weil sie dann doch lieber zu ihrem Gottenmeitli gehen wollte.
Ich war wie vor den Kopf gestossen. Am Telefon sagte ich ihr, dass ich nicht kurzfristig jemanden anderen aufbieten könne. Sie blieb hartnäckig, ich standhaft. Zuerst schmeichelte sie mir, dann wurde sie ungeduldig, dann wütend und am Schluss drohte sie mir sogar: «Gut, dann werde ich halt kommen. Aber ich komme nur mit einem schlechten Gefühl.»
Die nächsten drei Stunden war ich damit beschäftigt, jemanden zu suchen, der sich am Mittwoch um meine beiden Buben kümmern konnte. Mein Puls lief auf Hochtouren, ich war wütend. Ich fragte mich, ob sie eigentlich gerne zu uns kam? Was lag ihr an meinen beiden Buben? Würde ich mich getrauen, so mit meinem Chef zu sprechen? Noch in der Probezeit? Mochte ich dieser Frau überhaupt noch meine Kinder anvertrauen? Ich war ausgelaugt und gestresst wie nie zuvor.
Doch es kam noch schlimmer. Bereits ein paar Stunden nach dem Gespräch meldete sie sich wieder. Dieses Mal sprach mein Mann mit ihr. Sie teilte ihm mit, dass sie einen Ausschlag im Gesicht habe und sich am nächsten Tag nicht unter die Leute getraue. Sie könne daher morgen – Montag!, Erster Arbeitstag! Nach den Weihnachtsferien! – nicht zur Arbeit kommen.
Offenbar war ihr schleierhaft, was dies für mich bedeutete. Dass ich nämlich nicht zur Arbeit gehen konnte, wenn sie nicht kam. Und ein Problem mit meinem Chef bekam. Ich verlor die Nerven, heulte nur noch. So hatte ich mir die Anstellung einer Nanny nicht vorgestellt.
Zum Glück eilte meine Mutter am Sonntagabend auf den Zug, um die nächsten beiden Tage die Kinder zu hüten. Ich hörte nichts mehr von der Nanny. Als ich sie dann am Mittwoch anrief und mich erkundigte, wie sie sich denn künftig vorstellte, bei uns zu arbeiten, brach sie in Tränen aus, da ich sie nicht nach ihrem Gesundheitszustand gefragt hatte. Einen Tag später erhielt ich ihre Kündigung. Ich war erleichtert. Und natürlich gestresst wie niemals zuvor. Was sollte ich nun mit den Buben machen, wenn ich arbeiten gehen musste? Wer konnte sich um sie kümmern? Ich war total überfordert, verunsichert, übermüdet und konnte vor lauter Ärger in der Nacht kein Auge mehr zutun.
Noch in der gleichen Woche meldete ich die Kinder erneut in der Kita an. Ich musste allerdings drei Monate warten, bis ich sie wieder bringen konnte. In dieser Zeit engagierten wir eine sogenannte Not-Nanny. Wir entschieden uns für eine Familienfrau, die zwei Söhne aufgezogen hatte, zwar keine Ausbildung als Nanny hatte, aber gerne wieder arbeiten wollte. Sie machte einen netten, zuverlässigen Eindruck, wusste aber nicht viel mit den Kindern anzufangen. Sie sagte mir lammfromm, dass sie niemals Kinder schlagen oder anschreien würde. Ich wollte ihr glauben. Es war dann die Nachbarin, die mich darauf hinwies, dass die Nanny manchmal ziemlich laut herumschreien würde.
Ich hatte es geahnt, dass sie mit den kleinen Buben überfordert war. Ich hätte es geschätzt, sie hätte mir dies gesagt. Ich kann sehr wohl nachvollziehen, dass man an die Grenzen kommen kann; vor allem wenn der Grosse den Kleinen bis zum Gehtnichtmehr piesackt. Zum Glück waren die drei Monate irgendwann vorbei – auch weil mich das schlechte Gewissen in dieser Zeit beinahe zerfressen hat. Ich sass ruhelos im Büro, guckte in meinen Computer und fragte mich, warum sich nun eine fremde Frau, der ich nur halbwegs vertraute, um meine beiden kleinen Buben kümmerte, während ich hier brav die Befehle meines Vorgesetzten ausführte. Kann es das sein? Ich fühlte mich nicht nur zerrissen, ich war es auch. Hetzte stets vor Büroschluss nach Hause, um schnellstmöglich wieder bei den Kleinen zu sein. Ich war froh, als die Zeit mit der Not-Nanny vorbei war und die Buben wieder in die Kita gehen konnten.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.