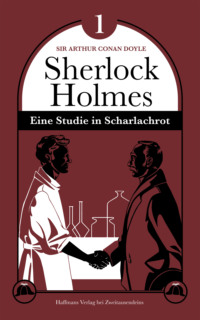Kitabı oku: «Eine Studie in Scharlachrot»
SIR ARTHUR CONAN DOYLE
Eine Studie in Scharlachrot
Der erste Sherlock-Holmes-Roman
Leipziger Ausgabe
Nach der ersten deutschen Übersetzung von
Margaret Jacobi
neu gefasst und mit Anmerkungen versehen von
Gerd Haffmans
HAFFMANS VERLAG
BEI ZWEITAUSENDEINS
Die englische Originalausgabe A Study in Scarlet wurde zuerst 1887 in Beetons’ Christmas Annual veröffentlicht, die Buchausgabe folgte 1888 bei Ward, Lock & Co. in London.
Die deutsche Erstausgabe erschien unter dem Titel Späte Rache im Verlag Robert Lutz, Stuttgart 1894, NA 1902.
Weiteres in der Editorischen Notiz am Schluss des Bandes.
1. Auflage, Winter 2021.
Alle Rechte vorbehalten. Alle Rechte an dieser Neuedition & Neuübersetzung vorbehalten.
Copyright © 2021 by Haffmans Verlag
bei Zweitausendeins Versand-Dienst GmbH,
Bahnhofstr. 30, 82340 Feldafing.
Gestaltung & Produktion: Zweitausendeins.
Umschlagsillustration: Christiane Nebel.
ISBN 978-3-96318-135-1
Inhalt
I. TEIL
Aus den Erinnerungen von Dr John H. Watson, Stabs-Arzt a. D., ehemals im Sanitäts-Corps der Britischen Armee
1. Kapitel: Mr Sherlock Holmes
2. Kapitel: Die Wissenschaft der Deduktion
3. Kapitel: Das Geheimnis von Lauriston Gardens
4. Kapitel: Was John Rance zu erzählen hatte
5. Kapitel: Wir bekommen Besuch
6. Kapitel: Gregson kann zeigen, was er gelernt hat
7. Kapitel: Licht in der Finsternis
II. TEIL
Im Land der Heiligen
1. Kapitel: Auf der großen Alkali-Ebene
2. Kapitel: Die Blume von Utah
3. Kapitel: John Ferrier spricht mit dem Propheten
4. Kapitel: Flucht auf Leben und Tod
5. Kapitel: Die Rache-Engel
6. Kapitel: Fortsetzung der Erinnerungen von Dr John Watson
7. Kapitel: Die Schlussfolgerung
ANHANG
Anmerkungen
Editorische Notiz
Kompendium
Bemerkungen zu Sherlock Holmes von Joachim Kalka
Eine Einführung in den Kriminalroman
Who’s Who
Kleine ACD-Chronik
I. Teil
Aus den Erinnerungen von John H. Watson, M. D., ehemals Mitglied des Medizinischen Dienstes der Armee
1. KAPITEL
Mr Sherlock Holmes
Im Jahr 1878 hatte ich meinen Doktor an der Medizinischen Fakultät der Universität London gemacht und im Royal Victoria Military Hospital Netley die für Militärärzte vorgeschriebene medizinische Spezialausbildung absolviert. Bald darauf wurde ich als Sanitätsoffizier dem fünften Füsilierregiment Northumberland zugeteilt, das damals in Indien stationiert war. Bevor ich jedoch an meinem Bestimmungsort ankam, brach der zweite Afghanistan-Krieg aus, und bei meiner Landung in Bombay erfuhr ich, mein Regiment sei bereits durch die Gebirgspässe marschiert und weit ins Feindesland vorgedrungen. In Gesellschaft mehrerer Offiziere in gleicher Lage folgte ich meinem Corps, das Kandahar unversehrt erreicht hatte, und trat meinen neuen Dienst an.
Der Feldzug, in dem andere Ruhm und Beförderung fanden, brachte mir nur Unglück und Elend. Ich wurde von meiner Brigade zu den Berkshires versetzt, wo mir gleich in der ersten verhängnisvollen Schlacht von Maiwand eine Jezail-Kugel die Schulter zerschmetterte und die Schlüsselbein-Arterie verletzte. Ich wäre sicherlich den mörderischen Ghazis in die Hände gefallen, hätte mich nicht mein treuer, tapferer Bursche Murray auf ein Lastpferd geworfen und sicher hinter unsere Linien gebracht.
Lange lag ich im Lazarett, erst nachdem ich mit vielen verwundeten Offizieren ins Basis-Hospital von Peschawar gebracht worden war, erholte ich mich von den Strapazen allmählich wieder so weit, dass ich mich in den Krankensälen umherschleppen und auf der Veranda wärmen konnte. Da befiel mich der Typhus, der Fluch unserer Indischen Landnahme. Mein Leben hing am seidenen Faden. Als mein Bewusstsein zurückkehrte, war ich so schwach, dass die Ärzte beschlossen, mich sofort zurück nach England zu schicken. Einen Monat später landete ich mit dem Truppentransporter ›Orontes‹ in Portsmouth. Meine Gesundheit war völlig ruiniert, doch Vater Staat erlaubte mir den Versuch, sie während der nächsten neun Monate wieder zu kurieren.
Da ich in England weder Verwandte noch Freunde hatte, beschloss ich, mich in einem kleinen Hotel mitten in der Metropole einzunisten, wo das ganze menschliche Strandgut der Mühseligen und Beladenen anlandete. Mein tägliches Einkommen von elfeinhalb Shilling ließ mich leben; doch da ich nicht haushälterisch damit umging, machte mir meine Finanzlage bald große Sorgen. Ich sah ein, dass ich entweder aufs Land ziehen oder meine Lebensweise drastisch einschränken musste. Ich zog Letzteres vor und sah mich genötigt, das Hotel aufzugeben und mir ein schlichtes, günstiges Quartier zu suchen.
Ich stand mit meinen Überlegungen an der Criterion-Bar, da tippte mir jemand auf die Schulter. Als ich mich umsah, erkannte ich den jungen Stamford, der früher als mein Assistent im St Bartholomew’s Hospital bedienstet war. Ein bekanntes Gesicht ist ein höchst erfreulicher Anblick für einen verlorenen Menschen in der höchst bedrohlichen Megapolis London. Nicht dass wir damals dicke Freunde gewesen wären, aber jetzt begrüßte ich ihn geradezu enthusiastisch, und auch er schien sich über das Wiedersehen zu freuen. Bald saßen wir beim Lunch im Holburn und tauschten unsere Erlebnisse aus.
»Was in aller Welt ist denn mit Ihnen passiert, Watson?« fragte Stamford verwundert. »Sie sind braun wie eine Nuss und dünn wie eine Bohnenstange.«
Ich gab ihm einen Abriss der Geschichte meiner Abenteuer.
»Armer Kerl«, sagte er mitfühlend, »und was haben Sie jetzt vor?«
»Ich bin auf Wohnungssuche. Ich muss eine komfortable Wohnung für wenig Geld finden.«
»Das ist merkwürdig«, sagte Stamford. »Sie sind heute schon der Zweite, der mit diesem Anliegen kommt.«
»Und wer war der Erste?«
»Ein Bekannter von mir, der im Chemie-Labor des Hospitals arbeitet. Er klagte mir diesen Morgen, dass er niemanden findet, der mit ihm zusammen eine sehr günstige, angenehme Wohnung mieten könnte, die für ihn allein zu teuer ist.«
»Bei Jupiter«, rief ich, »wenn er Wohnung und Kosten teilen will, bin ich dabei. Ich würde sogar lieber mit jemandem zusammen wohnen als ganz alleine.«
Der junge Stamford sah mich über sein Weinglas bedeutungsschwer an. »Sie kennen Sherlock Holmes nicht«, sagte er. »Vielleicht halten Sie ihn als Mitbewohner gar nicht aus.«
»Warum? Stimmt was nicht mit ihm?«
»Soweit würde ich nicht gehen. Er hat in manchen Dingen seltsame Ansichten und schwärmt für die exakten Wissenschaften. Im Übrigen ist er ein höchst patenter Kerl, soviel ich weiß.«
»Wahrscheinlich ein Medizinstudent?«
»Nein – ich hab keine Ahnung, was er wirklich macht. Von Anatomie versteht er wirklich etwas, und er ist ein erstklassiger Chemiker. Aber meines Wissens hat er nie regelrecht Medizin studiert. Er ist überhaupt ziemlich exzentrisch und unmethodisch in seinen Studien, doch er kennt sich in entlegendsten Gebieten ungewöhnlich gut aus, da könnte ihn mancher Professor beneiden.«
»Haben Sie ihn nie nach seinem Beruf gefragt?«
»Nein – er ist kein Mensch, der sich ausfragen lässt; doch er kann auch ganz mitteilsam sein, wenn ihm danach ist.«
»Ich möchte ihn auf jeden Fall kennen lernen«, sagte ich. »Ein Mensch, der sich mit Vorliebe in seine Studien vertieft, ist für mich der angenehmste Mitbewohner, den ich mir denken kann. Bei meinem Gesundheitszustand vertrage ich weder Lärm noch Aufregung. Von beidem hatte ich in Afghanistan genug, das reicht mir für den Rest meiner Tage. Bitte, wie kann ich Ihren Freund kennen lernen?«
»Wahrscheinlich ist er jetzt noch im Labor. Manchmal lässt er sich dort wochenlang nicht blicken und dann wieder arbeitet er von früh morgens bis spät abends. Wenn’s Ihnen recht ist, gehen wir gleich hin.«
So machten wir uns nach dem Lunch auf den Weg zum Hospital, während Stamford mir von weiteren Eigentümlichkeiten des Gentlemans berichtete, der mein Mitbewohner werden sollte. »Sie dürfen mir aber keine Vorwürfe machen, wenn Sie nicht miteinander auskommen«, sagte Stamford, als wir in die Droschke stiegen. »Ich möchte in dieser Angelegenheit weder zu- noch abgeraten haben.«
»Wenn wir nicht zusammen passen, können wir ja leicht wieder auseinander gehen. Ihre Vorsicht scheint mir fast ein wenig übertrieben, da muss noch etwas anderes dahinter stecken, Stamford. Heraus mit der Sprache, was wissen Sie noch?«
»Nichts, gar nichts; es ist eben nicht einfach, etwas auszudrücken, was man selbst nicht genau fassen kann«, sagte er und lachte verlegen. »Er ist nach meinem Geschmack der Wissenschaft etwas zu sehr ergeben – das grenzt schon an Gefühllosigkeit. Ich halte es nicht für undenkbar, dass er einem guten Freund eine Dosis des neuesten vegetabilischen Alkaloids verpasst – nicht etwa aus Bosheit, nein, aus Forschungstrieb –, nur damit er die Wirkung genau beobachten kann. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, würde er jedes Experiment auch als Selbstversuch vornehmen. Überhaupt ist Klarheit und Genauigkeit des Wissens seine größte Leidenschaft; aber zu welchem Zweck er all diese Studien betreibt, weiß der liebe Himmel.«
Beim Hospital stiegen wir aus, gingen ein Gässchen hinunter und traten durch eine Seitentür in einen Flügel des weitläufigen Gebäudes. Hier war mir alles wieder vertraut, und ich brauchte weiter keine Führung. Es ging die kahle Steintreppe hinauf durch einen langen, weißgetünchten Korridor mit Türen auf beiden Seiten, an den sich der niedrige Bogengang anschloss, der ins Chemielabor führte.
Im großen Saal waren sämtliche Tische voll gestellt mit Retorten, Reagenzgläsern und kleinen Bunsenbrennern mit den kleinen blau flackernden Flammen. An den Wänden standen Flaschen in allen Größen und Formen, soweit das Auge reichte.
Am andern Ende saß ein junger Mann in seine Experimente versunken über den Tisch gebeugt. Beim Geräusch unserer Schritte blickte er auf und sprang mit einem Freudenschrei in die Höhe. »Heureka, heureka!« jubelte er und kam uns entgegen und schwenkte ein Reagenzglas. »Ich hab’s, ich hab das Reagens gefunden, das sich nur mit Hämoglobin zu einem Niederschlag verbindet und mit keinem Stoff sonst.«
Er sah so glückstrahlend aus, als hätte er eine Goldmine entdeckt.
Stamford stellte uns vor: »Doktor Watson – Mister Holmes«.
»Sehr erfreut«, sagte Holmes herzlich und mit einem so kräftigen Händedruck, wie ich ihn nicht erwartet hatte.
»Sie kommen aus Afghanistan, wie ich sehe.«
Ich sah ihn verblüfft an. »Woher wissen Sie das?«
»Nicht so wichtig«, er rieb sich vergnügt die Hände. »Wichtig ist jetzt nur mein Hämoglobin. Sicher haben Sie die Tragweite meiner Entdeckung gleich begriffen.«
»Chemisch sicher, aber praktisch …?«
»Gerade in der Praxis ist es von größter Wichtigkeit für die Gerichtsmedizin, weil sich damit alle Blutflecken nachweisen lassen. – Bitte, kommen Sie doch einmal her.« In seinem Eifer ergriff er meinen Rockärmel und zog mich an seinen Arbeitstisch. »Wir brauchen etwas frisches Blut«, sagte er und stach sich mit einer großen Nadel in den Finger, worauf er das herabtropfende Blut mit einer Pipette auffing. »Jetzt mische ich diese kleine Menge Blut mit einem Liter Wasser – das Verhältnis ist etwa eins zu einer Million –, und die Flüssigkeit sieht genau so aus wie reines Wasser. Trotzdem wird sich, denke ich, die gewünschte Reaktion herstellen lassen.« Während er sprach, hatte er einige weiße Kristalle hineingeworfen und goss jetzt noch mehrere Tropfen einer durchsichtigen Flüssigkeit hinzu. Sofort nahm das Wasser die Färbung von dunklem Mahagoni an, und ein bräunlicher Niederschlag erschien auf dem Boden des Glases.
»Ha ha«, rief er und klatschte in die Hände wie ein Kind vor Freude über ein neues Spielzeug. »Jetzt sind Sie dran!«
»Das scheint mir ein gelungenes Experiment zu sein.«
»Wunderbar, wunderbar! Die alte Methode, die Analyse mit Guajacum durchzuführen, war sehr umständlich und unsicher, die mikroskopische Untersuchung der Blutkörperchen aber ist wertlos, sobald die Flecken ein paar Stunden alt sind. Meine Erfindung wird sich dagegen ebenso gut bei altem wie bei frischem Blut bewähren. Wäre sie schon früher gemacht worden, so hätte man Hunderte von Verbrechern zur Rechenschaft ziehen können, die straflos davongekommen sind.«
»Wirklich?«
»Keine Frage. Die Kriminalfälle drehen sich ja fast immer um diesen einen Punkt. Vielleicht Monate nach der Tat gerät einer unter Verdacht, man untersucht seine Kleider und findet braune Flecke am Jackett oder in der Wäsche. Das könnten Blutspuren sein, aber auch Rostflecken, Obstflecken oder Schmutzflecken. Mancher Sachverständige hat sich darüber schon den Kopf zerbrochen, und das bloß, weil es keine zuverlässige Beweismethode gab. Mit der Sherlock-Holmes-Methode ist dieses Problem jetzt gelöst.«
Seine Augen funkelten, als er seine Hand aufs Herz legte und sich feierlich verbeugte, als sähe er sich einem Beifall klatschenden Publikum gegenüber.
»Da kann man nur gratulieren«, sagte ich, verwundert über seinen Feuereifer.
»Letztes Jahr hätte von Bischoff in Frankfurt sicher überführt werden können, wäre meine Methode schon verfügbar gewesen«, fuhr er fort. »Mason aus Bradford, auch dem berüchtigten Müller sowie Lefevre aus Montpellier und Samson aus New Orleans wäre es bestimmt an den Kragen gegangen. Ich könnte Ihnen Dutzende von Fällen nennen, bei denen meine Methode entscheidend gewesen wäre.«
»Sie scheinen ja ein wandelnder Verbrecher-Almanach zu sein«, meinte Stamford lachend. »Bringen Sie doch ein Kriminal-Magazin heraus:
Sherlock Holmes präsentiert
ALLE FÄLLE:
umgefallen, hingefallen, aufgefallen.«
»Das will jeder unbedingt lesen«, erwiderte Holmes, der sich eben ein Pflaster auf den verwundeten Finger klebte. »Ich muss sehr vorsichtig sein«, fügte er hinzu, »ich experimentiere oft mit Giften.« Als er die Hand in die Höhe hielt, sah ich, dass sie von scharfen Säuren verfärbt und an vielen Stellen bepflastert war.
»Wir kommen allerdings in einer bestimmten Angelegenheit«, sagte Stamford und schob mir einen Schemel zu, während er ebenfalls Platz nahm. »Mein Freund hier sucht eine Wohnung, und da Sie gern mit jemandem zusammenziehen möchten, dachte ich, es wäre vielleicht Ihnen beiden geholfen.«
Sherlock Holmes ging mit Freuden auf den Vorschlag ein. »Ich habe ein Auge des Wohlgefallens auf eine Wohnung in der Baker Street geworfen, die perfekt wäre«, sagte er. »Haben Sie eine Abneigung gegen Tabak?«
»O nein, ich dampfe selbst wie ein Schlot.«
»Das trifft sich gut. Ferner habe ich häufig Chemikalien bei mir herumstehen, die ich für meine Experimente brauche. Würde Sie das stören?«
»Durchaus nicht.«
»Warten Sie – was habe ich sonst noch? Manchmal habe ich so Zustände, da kriege ich die Zähne nicht auseinander. Das dürfen Sie nicht persönlich nehmen. Dann lassen Sie mich einfach in Ruhe und kümmern sich gar nicht um mich, und bald ist alles wieder vorbei. So – nun sind Sie dran, mir Bekenntnisse zu liefern. Wenn zwei Menschen zusammen leben wollen, ist es gut, wenn sie im Voraus wissen, was sie von einander zu erwarten haben.«
Ich musste über diese Generalbeichte lachen. »Ich besitze meinen alten Armee-Revolver«, gestand ich. »Ich kann keinen Lärm vertragen, weil meine Nerven blank liegen; und ich schlafe als notorischer Langschläfer tief in den Tag hinein und bin überhaupt maulfaul. In gesunden Zeiten fröhne ich noch Lastern anderer Art, aber für’s Erste sind dies die wichtigsten.«
»Würden Sie unter ›Lärm‹ auch den Klang einer Geige verstehen?« fragte er besorgt.
»Das kommt auf den Musiker an. Gekonntes Geigenspiel ist ein Genuss für Götter – aber gestümpertes –«
»Schon klar, schon klar«, sagte er amüsiert. »Nun, ich denke, die Sache ist abgemacht – das heißt, wenn Ihnen die Wohnung gefällt.«
»Wann können wir sie ansehen?«
»Holen Sie mich bitte morgen hier mittags um Punkt zwölf Uhr ab, dann gehen wir zusammen hin und können uns sofort entscheiden.«
»Alles klar, also morgen Mittag um zwölf«, sagte ich und schüttelte ihm die Hand. Wir ließen ihn samt seinem Hämoglobin und gingen in Richtung meines Hotels zurück. »Nur noch eins«, wandte ich mich an Stamford, »woher hat er gewusst, dass ich aus Afghanistan komme?«
Stamford lachte geheimnisvoll. »Schon mancher hätte gern gewusst, woher Sherlock Holmes sein Wissen bezieht. Er besitzt eben eine besondere Gabe.«
»Aha, dahinter steckt ein Geheimnis«, rief ich belustigt. »Das ist ja höchst interessant. Ich bin Ihnen für diese neue Bekanntschaft sehr verbunden. Das wahre Studium des Menschen ist der Mensch.«
»Dann studieren Sie ihn gut«, entgegnete Stamford. »Sie werden manche Nuss zu knacken haben. Ich wette, er kennt Sie bald besser als Sie ihn. Good bye.«
»Good bye«, sagte ich und schlenderte allein zurück, ganz in Gedanken an die neue Bekanntschaft versunken.
2. KAPITEL
Die Wissenschaft der Deduktion
Wie abgemacht besichtigten wir am nächsten Tag unsere künftige Wohnung in der Baker Street Nr. 221 b. Mir gefiel der große, luftige Wohnraum, an den sich zwei behagliche Schlafzimmer anschlossen, alles war freundlich möbliert und, da das Tageslicht durch zwei große Fenster fiel, auch angenehm hell. Unter uns geteilt, erschien auch die Miete der Wohnung so günstig, dass wir uns auf der Stelle einigten und beschlossen, sofort einzuziehen. Noch am selben Abend ließ ich meine Habseligkeiten vom Hotel herüberschaffen, und Sherlock Holmes folgte bald mit verschiedenen Koffern und Reisetaschen. In den ersten Tagen waren wir damit beschäftigt, auszupacken und unsere Sachen unterzubringen. Als alles verstaut war, begannen wir uns in aller Ruhe in unsere neue Umgebung einzuleben.
Mit Holmes ließ sich leicht leben, er war still und hatte berechen- und überschaubare Gewohnheiten. Selten blieb er abends nach zehn Uhr auf, und wenn ich morgens zum Vorschein kam, hatte er immer schon gefrühstückt und war ausgegangen. Tagsüber war er meist im Chemielabor oder im Seziersaal, zuweilen machte er auch weite Ausflüge, die ihn bis in die verrufensten Gegenden der Stadt zu führen schienen. So lange seine Arbeitswut anhielt, war seine Tatkraft ungebochen. Von Zeit zu Zeit trat jedoch ein Rückschlag ein, dann lag er den ganzen Tag im Wohnzimmer auf dem Sofa, ohne sich zu rühren oder ein Wort zu reden. Dabei nahmen seine Augen einen so träumerischen, verschwommenen Ausdruck an, dass der Verdacht in mir aufsteigen wollte, er müsse irgendwelche Narkotika einnehmen, hätte nicht seine Mäßigkeit und Nüchternheit im Alltagsleben diese Annahme völlig ausgeschlossen.
Nach den ersten Wochen unseres Beisammenseins war mein Interesse für ihn nur noch gestiegen; ich wollte ergründen, welche Ziele er eigentlich verfolgte. Schon seine äußere Erscheinung war ungemein auffällig. Er war über sechs Fuß groß und sehr hager; sein scharfkantig vorstehendes Kinn drückte Charakterfestigkeit aus, sein Blick war lebhaft und durchdringend, außer in den erwähnten Zeiten völliger Lethargie. Eine Adlernase gab seinem Gesicht etwas Waches und Entschlossenes. Die Hände schonte er nicht, sie trugen fortwährend Spuren von Tinten und Chemikalien, ich hatte oft Gelegenheit, seine Geschicklichkeit zu bewundern, wenn er mit seinen filigranen physikalischen Instrumenten hantierte.
Kein Wunder, dass ich im Zustand hochgradiger Neugier immer wieder versucht war, die strenge Zurückhaltung zu durchbrechen, die er in allem wahrte, was ihn persönlich betraf. Das meinen Gefährten umgebende Geheimnis beschäftigte mich um so mehr, als mein eigenes Leben zu der Zeit gänzlich zweck- und ziellos verlief und kaum Zerstreuungen bot. Mein Gesundheitszustand erlaubte mir, nur bei günstigem Wetter auszugehen, und Freunde, die etwas Abwechslung in mein einförmiges Dasein hätten bringen können, hatte ich nicht.
Dass Holmes nicht Medizin studierte, wusste ich aus seinem eigenen Munde. Auch schien er kein bestimmtes Kolleg in irgendeiner anderen Wissenschaft belegt zu haben, die ihm auf akademische Weise Eingang in die Gelehrtenwelt verschafft hätte. Trotzdem verfolgte er gewisse Studien mit wahrem Feuereifer und besaß innerhalb ihrer Grenzen ein so ausgedehntes und umfassendes Wissen, dass er mich damit oft aufs Höchste überraschte. – Wie konnte ein Mensch so angestrengt arbeiten und sich so genau unterrichten, ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen zu haben? – Wer seinen Kopf derart mit Wissen vollstopft, muss gute Gründe dafür haben.
Andererseits war Holmes’ Unwissenheit so groß wie seine Kenntnisse. Von Literatur, Philosophie oder Politik zum Beispiel verstand er so gut wie gar nichts. Mir war das bereits aufgefallen, als er bekannte, noch nie etwas von Thomas Carlyle gelesen zu haben, doch meine Verwunderung erreichte den Gipfel, als sich herausstellte, dass er über unser Sonnensystem und die Entdeckung des Kopernikus völlig falsche Vorstellungen hatte. Mir war unbegreiflich, wie ein gebildeter Mensch in unserem 19. Jahrhundert keine Ahnung haben konnte, dass die Erde sich um die Sonne dreht.
»Erstaunt Sie das?« fragte er lächelnd. »Nun, wo Sie mir das erzählt haben, will ich versuchen, es so schnell wie möglich wieder zu vergessen.«
»Zu vergessen?!«
»Ja. – Nach meiner Ansicht gleicht das Gehirn einer leeren Dachkammer, die man nach eigenen Bedürfnissen vollstellen kann. Nur ein Tor stopft sie mit Gerümpel voll und hat dann keinen Platz mehr für die Sachen, die er braucht. Ein Verständiger lagert in seiner Hirnkammer die Werkzeuge ein, die für seine Arbeit hilfreich sind, aber davon schafft er sich eine umfassende Sammlung an und hält sie in Schuss. Ein Irrtum, zu meinen, die kleine Kopfkammer habe dehnbare Wände und könne sich nach Belieben ausweiten. Im Gegenteil, es kommt eine Zeit, da wir für alles neu Hinzugelernte etwas von dem vergessen müssen, was wir früher gewusst haben. Daher sollten wir aufpassen, dass nicht nutzloses Wissen den Zugang zu unseren wichtigen Kenntnissen verstopft.«
»Aber das Sonnensystem –« protestierte ich.
»Zum Teufel damit«, unterbrach er mich ungeduldig. »Was geht mich das Sonnensystem an? Ob sich die Erde um die Sonne oder um den Mond dreht – darauf ist gepfiffen. Für meine Arbeit ist das total egal.«
Ich war drauf und dran, zu fragen, worin denn seine Arbeit eigentlich besteht, doch ich hielt mich zurück, um ihn nicht zu verärgern. Unser Gespräch gab mir so einiges zu denken, und ich begann, meine Schlüsse zu ziehen. Wenn er sich nur Kenntnisse aneignete, die für seine Arbeit nützlich waren, so musste man ja aus den Wissensgebieten, mit denen er am vertrautesten war, auf den Beruf schließen können, dem er sich verschrieben hatte. Ich zählte alles auf, was er richtig gründlich studierte, ja ich machte mir eine Liste mit den einzelnen Fächern und konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen, als ich das noch einmal überlas:
Sherlock Holmes – Größe & Grenzen
1. Literatur – Null.
2. Philosophie – Null.
3. Astronomie – Null.
4. Politik – Schwach.
5. Botanik – Unterschiedlich. Gute Kenntnisse in Belladonna, Opium & überhaupt allen Giften; Garten- und Nutzpflanzenkunde – Null.
6. Geologie – Viel praktische, aber nur partielle Erfahrung. Er unterscheidet sämtliche Bodenbeschaffenheiten auf den ersten Blick. Von Ausflügen zurückgekehrt, weiß er nach Konsistenz und Farbe der Schmutzflecken auf seiner Kleidung die Stadtgegend von London anzugeben, aus der sie stammen.
7. Chemie – Umfassend.
8. Anatomie – Umfassend, aber unmethodisch.
9. Kriminalistik – umfassend, und zwar gigantisch. Er scheint alle Einzelheiten aller in unserem Jahrhundert verübten Schwerverbrechen zu kennen.
10. Ein guter Geiger.
11. Ein gleich gewandter & trainierter Boxer wie Fechter.
12. Ein gründlicher Kenner der britischen Rechtsprechung in ihren Gesetzen und deren Anwendung.
Weiter kam ich nicht; ich zerriss die Liste und warf sie verärgert ins Feuer. »Wie kann einer behaupten, dass es einen Beruf gibt, in dem sich alle diese verschiedenartigen Kenntnisse unter einen Hut bringen und professionell einsetzen lassen?« rief ich. »Völlig rätselhaft.«
Holmes als Violinspieler war großartig, aber von ganz eigener Art, wie alles bei diesem ungewöhnlichen Menschen. Gelegentlich spielte er mir wohl abends einige meiner Lieblingsstücke vor, um die ich ihn bat. War er aber sich selbst überlassen, so ließ er selten eine bekannte Melodie hören. Er lehnte sich dann in den Armstuhl zurück, schloss die Augen und fuhr mechanisch mit dem Bogen über das Instrument, das auf seinen Knien lag. Die Töne, die er dann den Saiten entlockte, waren stets der Ausdruck seiner augenblicklichen Empfindung, bald leise und klagend, bald heiter, bald schwärmerisch. Ob er dabei nur den wechselnden Launen seiner Einbildung folgte oder durch die Musik die Gedanken, die ihn gerade beschäftigten, besser in Fluss bringen wollte, überstieg meine Urteilskraft. Ich hätte sicherlich gegen seine herzzerreißenden Solovorträge Einspruch erhoben, doch um mich halbwegs für die mir auferlegte Geduldsprobe zu entschädigen, endigte er meist damit, dass er hintereinander einige meiner Lieblingsweisen spielte, was mich wieder versöhnlich stimmte.
In der ersten Woche bekamen wir keinen Besuch, und ich fing schon an zu glauben, mein Mitbewohner stehe ebenso allein in der Welt wie ich. Bald stellte sich jedoch heraus, dass er viele Bekannte hatte, und zwar in allen Schichten der Bevölkerung. Der kleine Mensch mit dem blassgelben Gesicht, der einer Ratte ähnelte und mir als Mr Lestrade vorgestellt wurde, kam im Lauf von acht Tagen mindestens drei oder vier Mal. Eines Morgens erschien eine elegant gekleidete junge Frau, die über eine halbe Stunde blieb. Am Nachmittag desselben Tages fand sich ein schäbiger Graubart ein, der wie ein jüdischer Hausierer aussah und hinter dem ein hässliches altes Weib hereinschlurfte. Bei einer späteren Gelegenheit hatte ein ehrwürdiger Greis eine längere Unterredung mit Holmes und dann wieder ein Eisenbahnbeamter in Uniform. Jedes Mal, wenn sich einer dieser merkwürdigen Besucher einstellte, bat mich Holmes, ihm das Wohnzimmer zu überlassen, und ich zog mich in mein Schlafzimmer zurück. Er entschuldigte sich jedes Mal, wenn er mir diese Unbequemlichkeit auferlegte. »Ich brauche das Zimmer als Büroraum, die Leute sind meine Klienten.«
Auch diese Gelegenheit, mir Aufschluss über seine Tätigkeit zu verschaffen, ließ ich aus Rücksichtnahme ungenützt vorübergehen. Ich wollte sein Vertrauen nicht erzwingen, und schließlich bildete ich mir ein, er habe einen bestimmten Grund, mir sein Geschäft zu verheimlichen. Dass ich mich hierin getäuscht hatte, sollte ich bald erfahren.
Am vierten März – der Tag ist mir im Gedächtnis eingebrannt – war ich früher als gewöhnlich aufgestanden und fand Sherlock Holmes beim Frühstück. Mein Kaffee war noch nicht fertig, und verärgert, weil ich warten musste, nahm ich ein Journal vom Tisch, um mir die Zeit zu vertreiben, während mein Gefährte schweigend seinen Toast verzehrte.
Mein Blick fiel zuerst auf einen Artikel, der mit Kopierstift angestrichen und »Das Buch des Lebens« betitelt war. Der Verfasser versuchte darin darzulegen, dass es für einen aufmerksamen Beobachter von Menschen und Dingen im alltäglichen Leben unendlich viel zu lernen gäbe, wenn er sich nur angewöhnen wolle, alles, was ihm in den Weg käme, genau und eingehend zu prüfen. Die Beweisführung war kurz und bündig, aber die Schlussfolgerungen schienen mir weit hergeholt und ungereimt, das Ganze eine Mischung von scharfsinnigen und krausen Behauptungen. Ein Mensch, der zu beobachten und zu analysieren verstand, müsse danach befähigt sein, die innersten Gedanken eines jeden zu lesen, und zwar mit solcher Sicherheit, dass es dem Uneingeweihten förmlich wie Zauberei vorkomme.
»Das Leben ist eine große, gegliederte Kette von Ursachen und Wirkungen«, hieß es weiter, »an einem einzigen Glied lässt sich die Gestaltung des Ganzen erkennen. Wie jede andere Wissenschaft, so fordert auch das Studium der Deduktion und Analyse viel Ausdauer und Geduld; ein kurzes Menschendasein genügt kaum, um es darin zur höchsten Vollendung zu bringen.« Ehe sich ein Anfänger an die Lösung verwickelter geistiger Probleme wage, solle er sich auf einfachere Aufgaben beschränken. Zur Übung könne er zum Beispiel bei der flüchtigen Begegnung mit einem Unbekannten den Versuch machen, auf den ersten Blick die Lebensgeschichte und den Beruf des Menschen zu bestimmen. »Das konzentriert die Aufmerksamkeit, und man lernt dabei, scharf zu beobachten und zu unterscheiden. An den Fingernägeln, dem Rockärmel, den Manschetten, den Stiefeln, den Hosenknien, der Hornhaut an Daumen und Zeigefinger, dem Gesichtsausdruck und vielem anderen lässt sich die tägliche Beschäftigung eines Menschen deutlich erkennen. Dass ein urteilsfähiger Forscher, der die verschiedenen Anzeichen zu vereinigen weiß, nicht zu einem richtigen Schluss gelangt, ist einfach undenkbar.«
»Was für ein törichtes Gerede«, rief ich und warf das Journal auf den Tisch. »In meinem ganzen Leben ist mir dergleichen Hergeholtes noch nicht untergekommen.«
Sherlock Holmes sah mich fragend an.
»Sie haben den Artikel angestrichen«, fuhr ich fort, »dann müssen sie ihn auch gelesen haben. Dass er geschickt abgefasst ist, will ich nicht bestreiten. Mich ärgern aber solche widersinnigen Theorien, die daheim im Lehnstuhl aufgestellt werden und dann an der Wirklichkeit elend scheitern. Der Herr Verfasser sollte nur einmal in einem Eisenbahnwagen dritter Klasse fahren und probieren, das Geschäft eines jeden seiner Mitreisenden an den Fingern herzuzählen. Ich wette tausend gegen eins, er wäre dazu nicht imstande.«