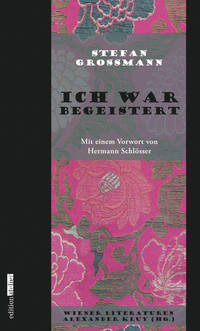Kitabı oku: «Ich war begeistert», sayfa 4
Annie
Damals hatte ich auch eine schicksalsschwere Entscheidung zu fällen. Das Stammcaféhaus war zu wählen, in dem ich mich mit einigen jungen Freunden niederlassen sollte. Man hat über das Caféhausunwesen der Wiener oft die Nase gerümpft und es bespöttelt. Dem Fremden, der es nur in der Nachkriegszeit kennengelernt hat, wo fette, aufgedonnerte Weiber sich in den Fensternischen der Ringstraße breitmachten, mag der Geschmack am Wiener Caféhaus schnell vergangen sein. Aber bis zum Kriege hat das Wiener Café nicht nur seine Berechtigung, sondern auch seine Kultur gehabt. Das Wiener Caféhaus war eine Art von Klub, scheinbar ein Klub mit offener Tür, in Wirklichkeit meistens eine geschlossene Gesellschaft, die es verstand, Eindringlinge, die nicht hingehörten, vom Marmortisch und aus dem Lokal herauszuspötteln. Es gab Cafés für die verschiedenen Lager und Branchen, Arbeiter-Cafés in den Vorstädten, Kaufmann-Cafés in den Geschäftsvierteln, Künstler-Cafés um die Akademie und Sezession herum, Politiker-Cafés beim Reichsratsgebäude, Mediziner-Cafés in der Umgebung des Allgemeinen Krankenhauses.
Wir jungen Leute wählten keck das Café Griensteidl. Es lag auf dem Michaeler Platz, direkt gegenüber der Hofburg. Es hatte noch den entzückenden Charakter des Altwiener Cafés, es war ganz ohne Pomp, ohne Marmor, ohne Plüsch; sein einziger Schmuck bestand in großen, goldgerahmten Spiegeln. Von den vorderen Räumen, in die sich immerhin noch Zufallsgäste verlieren konnten, mußte man durch einen kleinen Biedermeierbogen schlüpfen, wenn man in die geheiligteren hinteren Zimmer gelangen wollte. Da das Café an der Ecke der Herrengasse lag, so gab es an zwei Fronten Fensternischen. In jeder dieser Nischen und an allen Tischen der geheiligten hinteren Räume saß ein sozusagen geschlossener Stammtisch. Das Café Griensteidl war gegen Ende der neunziger Jahre ein geistiges Zentrum der Stadt; in diesem Lager war Österreich, nämlich das junge, das bewußt oder unbewußt an eine Renaissance des auseinanderfallenden Staates dachte. In den geheiligten hinteren Räumen residierten die Politiker. Hier wandelte der bärtige Historiker des sechsundsechziger Krieges, Heinrich Friedjung, monologisierend auf und ab, hier hatte Viktor Adler mit seinem alten Freunde Engelbert Pernerstorfer, der langsam von den Deutschnationalen zu den Sozialisten hinüberrutschte, seinen Spieltisch; der Dritte im Bunde war ein hellblonder Bankdirektor, Otto Wittelshöfer, ein in der Finanzwelt hoch geachteter Mann, den der Nimbus des »geheimen Genossen« umstrahlte. In einem anderen verrauchten Zimmer tagten oder nachteten die Großen des Burgtheaters, das ja nur ein paar Schritte weit entfernt lag. Unser Tisch konnte natürlich nicht in den allerheiligsten Hinterräumen aufgeschlagen werden. Der Zahlkellner Heinrich, der wohlwollende Regisseur des Cafés, hatte uns eine Fensternische in der Herrengasse zuerkannt. Die Geistigkeit des Cafés Griensteidl kam darin zum Ausdruck, daß nicht nur eine Unzahl von in- und ausländischen Tageszeitungen auflag, sondern daß auch sämtliche literarische Wochen- und Monatsschriften von Tisch zu Tisch wanderten. Im Café Griensteidl anerkannt werden, das hieß den Grundstock zum großen Ruhm legen. Aber wie schnuppe war uns jungen Leuten Ruhm oder nicht Ruhm. Damals erschien in einer Münchener Monatsschrift Die Gesellschaft der erste Aufsatz des kleinen Karl Kraus, der auch im Griensteidl geboren wurde. Ich erinnere mich an einen Abend, an dem er mit mir zusammen das Griensteidl verließ, seinen Arm unter meinen schob und ganz ernsthaft an mich die Frage richtete: »Was würdest du dafür geben, wenn du so berühmt wärst wie ich?« Ich wollte ihm nicht direkt ins Gesicht lachen, aber wenn ich später fast allwöchentlich die pathologischen Eitelkeitsexzesse dieses tragischen Zwerges lesen mußte, dann fiel mir dieses erste aufschlußgebende Erlebnis immer wieder ein.
Im Café Griensteidl habe ich den ersten etwas einseitigen Liebesroman meines Lebens zu spinnen begonnen. Zwischen halb elf und elf Uhr abends trat hier eine junge Dame mit ihrer kleinen Clique ein, die in dem ersten Raum hinter dem großen runden Eintrittszimmer sich niederzulassen pflegte. Es war ein junges Mädchen von wunderbarem, milchweißem Teint, hellbraunen, großbewimperten Augen und einer ungewöhnlich schönen Stirn. Eine reizende Fröhlichkeit ging von diesem jungen Mädchen aus, und an vielen Abenden sah ich ihr aus meiner Nische zu, immer entzückter von ihrem kollernden Lachen, bezaubert von den schwer bewimperten Augen, von den weißen Zähnen, die bei ihrem ungenierten Geplauder immer wieder fröhlich zum Vorschein kamen. Von den jungen Leuten, die um sie herum waren, schien keiner sich ihrer besonderen Gunst zu erfreuen. Dann und wann kam eine blonde Freundin mit, aber sie war nur eine stille Hintergrundserscheinung. Die heitere Königin des Tisches war Annie R. Ich hatte durch vorsichtiges Fragen ihren Namen herausbekommen und erfahren, daß es sich um ein junges Mädchen handelte, das im Begriff war, zur Bühne zu gehen. Viele Abende hat es mich beglückt, in meiner Nische zu sitzen und nur sehr vorsichtig, ohne daß ich bemerkt wurde und ohne daß ich gestört hätte, einen schnellen Blick zu Annie R. hinüberzuwerfen. Der Eindruck des strahlenden frohen Mädchens war so stark, daß ich mich an meinen Beobachterplatz in der Nische gewöhnte, und wenn ich einen Abend irgendwo in der Vorstadt oder im Prater verbracht hatte, so scheute ich um Mitternacht den weiten Weg zum Michaeler Platz nicht, um vor dem Schlafengehen wenigstens zehn Minuten lang, hinter einem großen Zeitungsblatt geborgen, einige Blicke an ihren Tisch zu werfen. Kam sie an einem Abend nicht, so fehlte sie mir. An Schlafverschwendung gewöhnt, konnte ich hier bis um zwei Uhr nachts wartend ausharren. Als sie einmal zwei Tage nicht erschien, verfolgte mich der Gedanke, daß sie aus meinem Gesichtskreis verschwunden sein sollte, so sehr, daß ich an meinem Bürotisch vormittags einen Brief konzipierte, den ich an Annie R., Café Griensteidl, am Büfett abzugeben, adressierte. Es war damals Sitte, daß man sich einen Teil seiner Korrespondenz ins Café kommen ließ; in dem Glaskasten, der neben dem Büfett hing, waren immer Dutzende von Briefen an Gäste ausgestellt. Ich hatte in dem Brief Annie R. gefragt, warum sie nicht gekommen sei, und ich hatte ihr gestanden, daß sie mir bitter gefehlt habe. Sie möge es wissen, daß jeder Abend, an dem sie nicht im Griensteidl auftauche, mindestens für einen Menschen in Wien ein verlorener sei. Den Brief hatte ich nicht mit meinem Namen gezeichnet, sondern Gabriel Gram. Am nächsten Abend saß ich in meiner Fensternische. Gegen elf Uhr trat Annie R. mit ihren Freunden ein. Sie wollte sich gerade an ihrem Stammtisch niederlassen, als der Kellner sie auf den Brief im Schaukasten aufmerksam machte. Ich sah ihr erstauntes Gesicht, während ich hinter meiner Zeitung versteckt war; ich konnte beobachten, wie sie den Brief öffnete und ihn mit einem freundlichen Lächeln, aber nicht ohne eine angenehme Nachdenklichkeit, zusammenfaltete. Sie drehte sich um, schien an den Tischen nachzusehen, wo der Schreiber des Briefes sich aufhalten könne. Grund genug, mich rasch noch geschützter hinter meiner Zeitung zu verschanzen. Zum Glück war mein Beobachterposten etwas weit, mein Tisch war noch von einigen Freunden besetzt, so daß es ihr auch bei angestrengtem Suchen unmöglich war, den Briefschreiber zu erkennen. Aber jede suchende Bewegung, jeder durch das Caféhaus schweifende Blick tat meinem Herzen wohl. Nach ein paar Tagen entschloß ich mich, wieder einen Brief zu schreiben. Wieder als Gabriel Gram maskiert. Es war ein Huldigungsbrief, wie ihn das junge Mädchen kaum noch erhalten hatte. Jemand war entzückt von ihr, mit dem sie noch nie ein Wort gesprochen hatte, jemand glaubte sie zu erkennen auf Grund ihrer Bewegungen, ihrer Blicke, ihres Lächelns. Und was wollte Gabriel Gram? Nichts, als dafür Dank sagen, daß er sie sehen konnte. Kein Annäherungsversuch, keine Bitte um Antwort, ja, keine Möglichkeit zu antworten. Und wieder hatte ich die Genugtuung, um elf Uhr abends zu sehen, wie Annie R. den Brief am Büfett entgegennahm. Dieses Mal blieb sie stehen, ließ ihre Freunde sich am Stammtisch versammeln und las, einige Schritte entfernt, verhältnismäßig ungestört, den kuriosen Brief. Schon die Vertiefung in die Lektüre, die Gesenktheit des Kopfes, die Entfernung vom Stammtisch der anderen, ein etwas ungeduldiges Reagieren: – ja, ja, ich komme schon –, als sie von ihren Freunden gerufen wurde, eine unwillkürliche Handbewegung, die ausdrücken sollte: laßt mich doch einen Augenblick in Ruhe –, all das machte den Beobachter in der Fensternische geradezu glücklich. Als die Briefempfängerin nun gar aufblickte und ihre großen hellbraunen Augen ganz langsam suchend das Caféhaus abwanderten, da durchrann mich eine große Seligkeit. Sie steckte den Brief ein, ich spähte von Zeit zu Zeit zu dem Stammtisch hinüber, aber ich hatte nicht den Eindruck, daß sie irgend jemand, auch nicht der blonden Statistin, ein Wort über ihr Brieferlebnis verraten hätte. Nun hätte ich mich ja eigentlich darüber kränken sollen, daß ihr suchender Blick bei mir nicht haltgemacht, daß ihr Auge nicht in meiner Fensternische stillgestanden hatte; denn wenn es wirklich einen solchen coup de foudre gab, der auf schriftlichem Wege erzeugt werden konnte, Herrgott, dann mußte sie doch spüren, aus welcher Ecke der elektrische Strom kam. Aber diese Gedanken verflogen, kaum aufgetaucht, wieder, und zwar aus einem sehr einfachen Grund: Ich war durchdrungen von meiner Häßlichkeit, ich sah mich selbst, wie sie mich sehen mußte, ungewöhnlich mager, erschreckend blaß, höchst dürftig gekleidet, nachlässig in der Haltung, mit jener bewußten Gleichgültigkeit gegen den äußeren Menschen, der damals das Zeichen des Geistigen sein sollte. Nein, nein, sie konnte mich nicht erkennen, und sie sollte mich nicht erkennen. Und im übrigen, was wollte ich von ihr? Ich wollte ihr eine Freude machen. Sonst nichts. In den nächsten Tagen geschah es, daß Annie R., wenn sie abends ins Café kam, vor allem schnell zum Büfett ging und fragte: »Ist ein Brief für mich da?« War nichts da, so sagte ihr Gesicht: schade. Und zuweilen blickte sie ringsumher und sagte deutlich und ganz laut: »Schade.« Ich muß übrigens hinzufügen, daß ich einige List darauf verwendete, nicht entdeckt zu werden. Ja, diese Angst ging so weit, daß ich mich bezwang und von Zeit zu Zeit einige Tage vom Café wegblieb, weil ich durch meine regelmäßige Anwesenheit aufzufallen fürchtete. Es kostete mich sehr viel Überwindung, an dem Tage, an dem der dritte Brief eintraf, dem Café fernzubleiben. Nach und nach bürgerte es sich ein, daß Gabriel Gram alle drei, vier Tage einen Brief absandte. Kein Zweifel, Annie R. wartete schon auf diesen Brief, ihre Phantasie war entzündet, und der unbekannte Huldiger bedeutete ihr vielleicht mehr als die allzu Bekannten am Stammtisch. Aber ich sollte die Feigheit meiner Huldigungen büßen. Je enthusiastischer meine Briefe wurden, desto bitterer fraß sich in mir das Bewußtsein ein, wie groß wird die Enttäuschung sein, wenn sie dich nun leibhaftig vor sich sieht? Und weil ich als Gabriel Gram etwas in ihrem Leben zu bedeuten schien, deshalb gab ich die Partie für Stefan Großmann verloren. Närrisches Jugendspiel, das zwei, drei Monate dauerte. Dann schien es mir, als ob nicht Annie allein, sondern auch alle ihre Freunde das Café absuchten. Es blieb mir nichts übrig, als zu schreiben und aus dem Griensteidl wegzubleiben oder meine Ecke zu besetzen und nicht mehr zu schreiben. Ich mußte Gabriel Gram wieder abtreten lassen, wenn ich als Stefan Großmann existieren wollte. Anfang Juli fand das Versteckspiel sein Ende. Annie R. war an das Kurtheater in Ischl engagiert. Das Café Griensteidl, im Sommer immer leer, schien an diesen heiteren Juliabenden vollkommen ausgestorben. Fast als einziger saß ich in meiner Nische und starrte zu dem Tisch, der leer blieb. An einem solchen Sommerabend voller Sehnsucht setzte ich mich im Griensteidl hin und wagte den ersten Brief nicht mehr als Gabriel Gram, sondern mit meinem wahren Namen zu unterzeichnen. Zwei Tage darauf konnte ich am Büfett die Antwort entgegennehmen. Es war ein ungewöhnlich liebenswürdiger und geradezu freundschaftlicher Brief. Natürlich, schrieb sie, habe sie schon seit Wochen gewußt, daß die Briefe nur aus meiner Nische kommen könnten, aber sie habe mich nicht gegen meinen Willen demaskieren wollen. Und im übrigen fragte sie mich, ob ich denn krank sei, so sähe ich aus, und ob ich denn nicht für vier Wochen ins Salzkammergut in ihre Nähe, »zu mir«, kommen könne. Ich steckte den Brief lautlos in die Tasche, ich drehte mich um, um zu sehen, ob niemand mich beobachtete, wie ich Annie beobachtet hatte. Es war keinMensch an diesem heißen Sommerabend im Café. Da zog ich den Brief aus der Tasche und las ihn, am Büfett stehend, noch einmal. Und dann setzte ich mich in meine Nische und las den Brief ein drittes Mal.
Ich konnte nicht auf vier Wochen ins Salzkammergut. Knirschend hatte ich noch meinen Bürodienst zu absolvieren. Aber ich konnte jeden Sonnabendnachmittag nach Ischl, ich konnte eine Nacht und einen Tag dort verbringen und in der Nacht vom Sonntag auf Montag zurückkehren. Es hatte sich herausgestellt, daß Gabriel Gram kein schlechter Wegmacher für mich gewesen. Sanft hatte er die Enttäuschung in der Wirklichkeit schriftlich vorbereitet. Der Kristallisationsprozeß, von dem Stendhal spricht, war geglückt. Annie R. sah mich nicht, wie ich war, sondern wie ich in ihrer Vorstellung lebte, und da ich überdies in einem Zustand hellster Verzauberung war, und da ich schweigen durfte, nachdem ich ihr das Schönste schon geschrieben hatte, und da weit und breit kein Stammtischfreund unser Beisammensein störte, und da wir auf diese Stunde des Zusammenseins monatelang gewartet hatten, so hätte der kleine Roman seinen normalen und banalen Verlauf nehmen können. Aber wir waren beide blutjung. Die Spannung zwischen uns war vielleicht zu groß. Die Angst, etwas von diesem ganz unerwarteten Glück zu verlieren, lähmte mich, und meine Leidenschaft machte mich zaghaft. Ich war ein junger Joseph, aber Annie war keine Frau Potiphar. So sahen wir uns mit trunkenen Augen an, spürten uns, zerdrückten uns die Hände und sind einander doch nicht ganz nahe gekommen. Möglich, daß immer noch Gabriel Grams Schatten zwischen uns stand, möglich, daß hinter all ihren lieben und zärtlichen Worten doch eine innerste Enttäuschung verschwiegen blieb. Freilich, wenn ich am Montag früh ins Büro kam nach einer Nacht, die ich in der dritten Klasse im Gedränge sitzend oder stehend, im Halbschlaf – ach, wieder ein Schlafdefizit! – verbracht hatte, fühlte ich mich wie zerschmettert. Doch die Wochentage gingen hin, und ein neuer Sonntag kam. Dieses schöne und entnervende Spiel dauerte bis in den September.
Vom Herbst an war Annie R. an das Wallner-Theater in Berlin engagiert, und das bedeutete für mich den zweiten Aufbruch aus Wien. Der Koffer, mit dem ich nach Berlin fuhr, war wohl etwas größer als der, mit dem ich nach Paris gereist war. Meine Brieftasche enthielt ein paar kleine Banknoten mehr als die fast leere Börse, die ich in den Schweinezug genommen hatte. Aber im Grunde hatte ich wieder, ganz aufs Geratewohl, meine bürgerliche Existenz abgebrochen. Ich hatte für Berlin ein sehr kurzes und sehr klares Programm: ich wollte mit Annie zusammen sein, und ich wollte nie mehr Büroarbeit tun.
Gastspiel in Berlin
In den glücklichen Wiener Tagen bin ich zur Wirklichkeit erwacht. In Berlin sank ich wieder zurück in die unreale Phantasiewelt des Jünglings. War ich in Berlin? In der Erinnerung an diesen ersten Aufenthalt ist kein eigentliches Berliner Bild enthalten. Weder der Norden noch der Westen wurden mir lebendig; ich habe die Seenwelt der Umgebung, die mich viele Jahre später so entzückte. daß ich mich an der Havel niederließ, nicht kennengelernt. Ich habe damals, glaube ich, weder den Wannsee noch Tegel, weder den Grunewald noch auch nur den Tiergarten gesehen. Kein Theatereindruck, kein Redner, keine Universitätsvorlesung aus dieser Zeit hat sich mir eingeprägt. Ich sehe nur zwei Räume vor mir: das Zimmer, in dem Annie R. wohnte, und das Haus in Pankow, das Gustav Landauer mit seinen Leuten bezogen hatte. Liegen die Schatten auch nicht mehr so schwer wie über den Pariser Tagen, so ist es doch noch ein traumdunkles, unwirkliches Berlin, das ich damals erlebt habe.
Was habe ich eigentlich in Berlin mit meiner Zeit getan? Wofür habe ich gelebt? Wo war ich denn? Meine Hauptbeschäftigung war es, Annie R. zu begleiten. Das Engagement im Wallner-Theater hatte sich im ersten Monat zerschlagen. Damals hatten die Theaterdirektoren das Recht, jeden Vertrag im ersten Monat zu lösen, und sie taten das gerade bei jungen Darstellern sehr gern, weil sie dann die verzweifelten Schauspieler, die für die Saison kein neues Engagement finden konnten, »aus Mitleid« für die halbe Gage wieder engagierten. Auch Annie R. hatte eine solche Trickkündigung empfangen. Sie lehnte sich gegen diesen Schwindel auf und klapperte sämtliche Theaterkanzleien Berlins ab, um ein anderes Engagement zu finden. Es war die erste Berührung mit der Theatergemeinheit, die das junge Mädchen erlebte. Sie verheimlichte ihr Mißgeschick vor ihren Wiener Leuten, und es war sicher ein Trost für sie, daß ich bei diesem demütigenden und nervenkraftfressenden Antichambrieren in den Theaterkanzleien sie zu begleiten suchte. Nachmittags saß man zusammen in dem bräunlichen Hotelzimmer Annies, das Lachen war ihr nicht ganz vergangen, und nach dem Rennen von Kanzlei zu Kanzlei tat es wohl, still beieinander zu sitzen.
Im übrigen wohnte ich bei Gustav Landauer. Ich hatte schon von Wien aus für seine Wochenschrift Der Sozialist geschrieben. Wir waren beide sehr jung, und schnell war das »du« zwischen uns ausgesprochen. Ich sehe Landauer noch vor mir, wie er damals war. Noch um einen Kopf länger als ich, ein etwas lockiges Haupt mit einem gut gepflegten Christusbärtchen, darüber ein reizend geschwungener, ich kann nicht anders sagen als kußlicher Mund, ein kleines lustiges Näschen, auf dem zuweilen ein kapriziöser Kneifer saß. Landauer hatte, übrigens bis zu seinem Ende, eine Vorliebe für jenes romantische Kleidungsstück, das man Havelock nannte. Damals stellte Fritz von Uhde ein Christusbild aus, das Jesus unter den Seinen in der damals modernen Tracht, aber doch ein wenig romantisierend, also im Havelock, darstellte. Eine solche Christuserscheinung im Havelock ist Landauer, noch dazu mit seiner Vorliebe für breite malerisch gekrämpelte Hüte, bis in seine letzten Tage geblieben. Aber während er in der letzten Phase seines Lebens, mag sein durch Leiden, die er in übergroßem Maße zu überstehen hatte, mag sein aus einer Märtyrerkoketterie, die ihm nicht ganz fehlte, ein duldendes Christusantlitz zur Schau trug, war sein Gesicht damals in den letzten Jahren des neunzehnten Jahrhunderts nicht ohne Heiterkeit. Vor allem sprach es deshalb an, weil die Szenerie des Gesichts sich blitzschnell verändern konnte, von Schelmerei zur Schwermut und ebenso geschwind wieder zurück. Den entscheidenden Ausdruck aber bekam sein Gesicht, wenn er den Kneifer abnahm und sein kurzsichtiges Auge etwas Unfixiertes, Leeres, in der Luft Herumtastendes bekam. So war er: in die Wirklichkeit verirrt, so ist er geblieben: Er hat sich bis zuletzt in die gemeine Realität nicht hineinfinden können. Damals hatte er seinen ersten Roman herausgegeben, der hieß Der Todesprediger. Wäre er mir zwei Jahre früher in die Hände gefallen, so hätte er wahrscheinlich wie Mainländers Philosophie der Erlösung auf mich gewirkt. Jetzt, da ich mich glücklich von der Selbstmordromantik losgerungen hatte, wirkte der Roman etwas fade auf mich. Aber dafür gab es ein anderes Band, das mich mit Landauer fest zusammenknüpfte. Der Sozialist wurde erhalten und verbreitet von der Gruppe Berliner Unabhängiger, die die Polizei als Anarchisten bezeichnete. Auf dieser Bettelsuppe gab es nur wenige Fettaugen. Die drei oder vier besten Geister standen als Helfer neben Landauer. Er selbst aber war von seiner eigenen Gruppe verfemt. Landauer, übrigens ein Sprachkünstler ersten Ranges, gab dem Sozialist sein Gesicht. Es war das führende Blatt des jungen undogmatischen Sozialismus.
Gericht und Polizei saßen ihm im Nacken. Landauer wanderte wiederholt ins Gefängnis, obwohl er nie auch nur eine einzige blutrünstige Zeile geschrieben hat. Er lebte mit seiner jungen Frau – er hatte eine tuberkulöse Proletarierin geheiratet, eine sehr liebenswerte und gütige Kameradin – und mit seinem kleinen Töchterchen draußen in dem Vorort Pankow, der damals noch ganz abseits vom berlinischen Lärm lag. Landauer, der aus dem Schwäbischen stammte, hat sich zeitlebens den Sinn für Stille bewahrt. Er konnte es nie in der Großstadt aushalten. Übrigens hatte er eine schrullige Vorliebe für die Arbeit in der kleinen Gemeinde. Er verachtete den Parlamentarismus, aber er wäre ganz gern Gemeinderat von Pankow geworden.
Meine Übersiedlung nach Berlin kam ihm gelegen. Er konnte mich als Gehilfen beim Sozialist gebrauchen. Gefängnis drohte ihm immer wieder, und er hatte eigentlich nur eine Stütze, seinen Freund, den Schriftsetzer Albert Weidner, der der Polizei soviel Kopfzerbrechen verursacht hat, weil sie manches Manuskript trotz eifrigen Suchens nicht finden konnte. Es existierte nämlich gar nicht. Weidner hatte die Fähigkeit, seine Beiträge aus dem Hirn direkt in den Setzkasten zu übertragen. Besonders willkommen war ich Landauer aber auch deshalb, weil damals gerade wieder ein »Sklavenaufstand« – um mich der hier vielleicht deplacierten Terminologie Nietzsches zu bedienen – gegen den Führer Landauer einzusetzen drohte. Es ist überall dasselbe in den großen Parteien wie in den kleinen Gruppen, in der Weltgeschichte wie im engen Familienkreise: Der Bedeutende ist im Grunde der Verhaßteste. Die Mittelmäßigen fühlen sich nur ganz wohl und sitzen in Hemdärmeln da, wenn sie unter sich sind. Wenn sie spüren, daß einer übers Mittelmaß reicht und keine Fabrikware der Natur darstellt, so bringen sie ihm Mißtrauen und einen kleinlichen Neid entgegen. Nichts wäre natürlicher, als daß der Größere, der reicher Begabte der Führer ist. Nichts ist unnatürlicher, als daß er sich fortwährend umdrehen muß, damit ihn die Gefährten nicht hinterrücks überwältigen. Jeder Führer erlebt ein Stück vom Schicksal Coriolans. Diese Verschwörung der Stumpfen gegen den Beweglicheren, der Phantasielosen gegen den Phantasten, der Bürger gegen die Persönlichkeit verbitterte dem jungen Landauer die Freude an der Arbeit. Er war von Natur aus antidemokratisch, und nun lieferte dieser Aufstand der anarchistischen Philister die stärkste Begründung für seinen Instinkt. Alles gärte noch in dem jungen Menschen; von seinem Todespredigertum war er selber schon weit entfernt. Die radikale Großmäuligkeit – und vielfach bedeutet ja Radikalismus nur gewohnheitsmäßiges Benutzen des Lautsprechers –, er hatte das alles über. Von allen Parteien ist die anarchistische Partei die sinnloseste. Anarchismus als tollkühne Vorreiterpolitik eines Einzelnen kann Sinn haben: es muß im Kriege Nachtpatrouillen geben, die auf eigene Rechnung und Gefahr handeln. Aber Anarchismus als Vereinsfunktion oder gar als Vereinsausflug, das erwies sich als ebenso lächerlich wie sinnlos. Dagegen begegneten Landauer und ich um diese Zeit einem unvergleichlichen Mann, der aus dem sächsischen Heere kam. Es war ein Oberst, der den Dienst quittiert hatte, Moritz von Egidy. Man sah dem kleinen energiestrotzenden Mann auf hundert Schritt den früheren Reiteroffizier an. Seine Rede war militärisch knapp, seine Schreibe war vollkommen phrasenlos. Er hatte ein Buch herausgegeben Ernste Gedanken, das die Frucht einer vollkommen selbständigen inneren Entwicklung darstellte. Egidy hatte in Sachsen, wo er in der Nähe des Königs lebte, plötzlich die Verwüstungen des Industrialismus wahrgenommen. Es bedrückte ihn ebensosehr, daß der Waldbestand von Sachsen innerhalb von drei Jahrzehnten auf ein Drittel seiner natürlichen Ausdehnung zurückgegangen war, wie es ihn erschütterte, wenn er bei den Musterungen das kleine Längenmaß der jungen Menschen wahrnahm, die alle Degenerationsmerkmale des jugendlichen Fabrikarbeiters aufwiesen. War es nicht sinnlos, herrliche Wälder niederzuschlagen, um auf dem gewonnenen Papier miserable Zeitungen zu drucken? Was sollte die virtuoseste Textilmaschine, wenn der Brustumfang des Menschen, der sie bedient, kleiner und seine Widerstandslosigkeit gegen die Tuberkulose größer wird. Egidy hatte die herrliche Frische eines Menschen, der sehr wenig gelesen hat, sein Auge war unbestechlich und glänzte vor innerer Rechtschaffenheit. Mit Landauer traf er sich in der Verachtung des Parteiwesens, in einer glühenden Aktionslust und in einem Mangel an Skeptizismus, den beide noch bitter gebüßt hätten, wenn der eine, Egidy, nicht jählings nach einem kurzen kometenhaften Aufstieg gestorben wäre, und wenn der andere, Landauer, nicht rechtzeitig sich von allen Genossen getrennt und von seiner zweiten Frau, der Dichterin Hedwig Lachmann, in eine stillere Welt gelenkt worden wäre. Eine gewisse Pädagogenstrenge war damals in Landauer noch nicht stark ausgebildet. Der stirnrunzelnde Revolutionär mit dem erhobenen Zeigefinger ist er erst später geworden. Auch der literarische Salonredner, der vor Berliner Bankiersfrauen frappierende Kühnheiten wagte, war er damals noch nicht. Ach, welche Entstellungen unseres Selbst malt uns beharrliche Not ins Gesicht! Landauer, geschaffen zum großen Universitätslehrer, mußte die Fülle seines universellen Wissens vor Damen ausschütten, die von Tee zu Tee klapperten und plapperten, wenn er mit Frau und Kindern nicht glatt verhungern wollte.
»Du mußt bei mir wohnen«, das war Landauers Vorschlag am dritten Tag meiner Anwesenheit in Berlin. Als junger Mensch entschließt man sich zu solchen Gemeinschaften, ohne allzuviel nachzudenken. Ich hing in der Luft. Alle vier, fünf Wochen brachte ich einen kleinen Aufsatz zustande, der erste erschien damals in Hardens Zukunft, der zweite, mir noch wichtiger, ein Essay über Montaigne, in der Frankfurter Zeitung. Mit den vierzig, fünfzig Mark, die ich auf diese Weise einnahm, konnte ich kaum leben. Andererseits hätte man es für entehrend gehalten, für die Beiträge in Landauers Sozialist Honorar zu nehmen. Dagegen schien es zulässig, das Angebot des Freundes anzunehmen, ein Zimmer seiner kleinen Wohnung mit Beschlag zu belegen und mitzuessen an seinem kargen Abendtisch.
Mittags war ich nie zu Hause. Wenn wir, Annie R. und ich, von Theaterkanzlei zu Theaterkanzlei sausten, dann pflegten wir einen kleinen greulichen Imbiß in den akademischen Bierhallen, einem Kellerlokal in der Nähe der Universität, einzunehmen. Wir mußten haushalten und durften keine Zeche über eine Mark machen. Aber das Lachen von Annie R. eroberte auch die akademischen Bierhallen, man schaute in unsere Nische, wie ich seinerzeit nach ihrer Ecke im Griensteidl ausgelugt hatte, und wahrscheinlich gab es unter den Studenten auch einige Gabriel Grams, die mit Sehnsucht und ein wenig Neid in unsere Ecke schielten. Aber war ich denn zu beneiden? Meine politischen Freunde, die Unabhängigen, Landauer selbst, sahen mich mit einigem Mitleid an. Ich kam aus der Rolle des armen Asra, der täglich bleich und bleicher wurde, nicht heraus. Vielleicht lag in dieser Schwärmerei, die nicht ihren natürlichen Ausweg finden konnte, ein ungesundes Element. Die Mitarbeiter des Sozialist, die sich zwanglos trafen, beschlossen auch im Interesse der freisozialistischen Bewegung bei Annie R. zu intervenieren. Eines Tages, während ich in der Druckerei war, klopfte eine Deputation von drei Genossen an Annies Tür. Sie war erstaunt. Was wollten die revolutionären Politiker von ihr, die nichts wollte als eine dankbare Rolle im Wallner-Theater? Die Deputation ließ sich nieder. Einer sah den anderen an. Keiner wollte mit der Rede recht heraus. Endlich sagte der energischste der drei Genossen: »Sie müssen nämlich wissen, Fräulein, daß Großmann für die Bewegung viel mehr leisten könnte, wenn …« Er stockte. Der zweite wollte aushelfen: »Es ist nämlich auch vom hygienischen Standpunkt aus gewiß nicht gesund für ihn. Er sieht ja jämmerlich aus.« Schließlich platzte der dritte heraus: »Sie sind es einfach der revolutionären Bewegung schuldig, ihn zu erhören!« Das Lachen, mit dem Annie antwortete, soll, wie mir die Deputation später erzählt hat, über eine halbe Stunde gedauert haben. Ach, sie gab im Grunde der Deputation ganz recht, und mit einem Händedruck versprach sie den Genossen, für die Bewegung so ziemlich alles zu tun, was in ihren Kräften stand.
Ich habe lange Zeit gehabt, aus dem Berliner Traum zu erwachen. Eines Abends legte sich plötzlich unter dem dunklen Stadtbahnbogen der Friedrichstraße eine schwere Hand auf meine Schulter. Ich war verhaftet. Eine halbe Stunde später saß ich in einer Untersuchungszelle auf dem Alexanderplatz. Ich zerbrach mir den Kopf, was ich denn angestellt haben könnte, es war nicht zu erraten. Im Polizeipräsidium hatte man meine Taschen durchsucht, und in einer Brieftasche fand sich eine kleine spöttische Glosse über Wilhelm II., der damals gerade mit Hilfe seines Leibmalers Knackfuß ein Bild unter dem Titel Völker Europas, wahrt eure heiligsten Güter verfaßt hatte, ein dummes Bild gegen die gelbe Gefahr. Aber dieses Manuskript lag ja noch unveröffentlicht in meiner Brieftasche, und ich konnte doch nicht wegen einer Äußerung verhaftet werden, die ich ja noch in den Falten meines Gewandes trug. Ein Kommissar der politischen Polizei verhörte mich, und ich lernte den potenzierten Kasernenton kennen, diese Mischung von Quälerlust und unbewußter Brutalität. Nach einigen Verhören hatte ich eine dunkle Ahnung, um was es sich handelte. Landauer hatte sich vorher den Spaß gemacht, die politische Polizei und ihre Spitzel ein bißchen an der Nase herumzuführen. Irgendein Denunziationsbrief muß bei der Polizei eingelaufen sein, und sie hielt mich für einen Urheber dieser Neckereien. Und da sie keinen Spaß verstand, so nahm sie mich hopp. Nach drei oder vier Tagen stellte sich heraus, daß ein Verfahren gegen mich unmöglich war. Aber da ich Österreicher war, so wurde ich, wie die schöne Formel noch heute heißt, »als lästiger Fremder« ausgewiesen. Es wurde mir eine Frist von drei Tagen gewährt. Als ich wieder auf dem Alexanderplatz stand, bemerkte ich, daß ich nicht einmal eine Geldbörse bei mir hatte. Annie R., von deren Seite ich unter dem Stadtbahnbogen weggerissen worden war, trug sie in ihrer Tasche. Was war zu tun? Ich mußte nach Pankow hinaus. Der Weg vom Alexanderplatz dorthin zieht sich in die Länge. Ich brannte darauf, Landauer und Annie, die sicher bei ihm wartete, die Nachricht von meiner Befreiung zu geben, und nun sollte ich zwei Stunden lang marschieren, weil ich nicht einmal das Geld für die Straßenbahn in der Tasche hatte? Dazu kam, daß ich mich in der Stadt, die allen fremd bleibt, gar nicht auskannte und den Weg nach Pankow nicht wußte. Vorläufig marschierte ich also gegen das Stadtzentrum zu, in der Hoffnung, daß mir allmählich irgendeine Lösung einfallen würde. Bei irgendeiner Gelegenheit drehte ich mich um und bemerkte, daß mir zwei Detektive folgten. Nun also, dann war die Lösung ja gegeben. Ich ging auf die beiden zu und sagte: »Entweder müssen Sie mir das Fahrgeld für die Straßenbahn leihen, oder Sie müssen mich zu Fuß nach Pankow begleiten.« Die Polizisten, über die Zumutung eines so weiten Marsches erschrocken, beeilten sich, mir zwanzig Pfennige zu übergeben, und so fuhren wir wortlos, und doch durch eine gemeinsame Schuld verbunden, zu Landauers Wohnung. Vor oder gar in das Haus des Feindes wagten sich die Agenten nicht. Sie hielten sich in einiger Entfernung von Landauers Haus. Wir hätten gern ihre Gesichter gesehen, als wir ihnen durch ein Mädchen den entliehenen Betrag zusandten, aber die Polizei hielt es nicht für ratsam, sich direkt unter den Fenstern Landauers aufzupflanzen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.