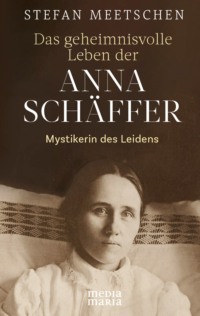Kitabı oku: «Das geheimnisvolle Leben der Anna Schäffer», sayfa 2
4. In der Schule des Leidens (Mai 1902 bis Herbst 1910)
Wie niedergeschlagen und verzweifelt wird Anna Schäffer gewesen sein, als sie erkennen musste, dass ihr Plan gescheitert war: Aussteuer, Ordenseintritt, Mission? Und damit nicht genug: »Wieder daheim in Mindelstetten wurde sie endgültig ein Pflegefall. Sie musste nun dauernd liegen und wurde von ihrer Mutter aufopfernd gepflegt. Dr. Wäldin übernahm die medizinische Betreuung und fing seine Kuren wieder an. Abermals, wie vor Erlangen, musste er mit dem Messer hantieren: Ausschneiden des faulen Fleisches, Abschabung der Knochen, Hautübertragungen von ihrem eigenen Körper, aus den Armen ihres Bruders Michael und ihrer Schwester Kathi. Mit Salben, essigsaurer Tonerde, Höllenstein und Alaun behandelte er das bedauernswerte Mädchen mit viel Geduld. In zwei Jahren musste Anna dreißig Operationen bei schwacher Narkose über sich ergehen lassen. Schließlich verband der Arzt die Füße mit Xeroformgaze, die jeden fünften Tag erneuert werden musste, zweiundzwanzig Jahre lang, das letzte Mal an ihrem Sterbetag. Sie sagte oft: ›Wenn die Gaze auf das offene Fleisch kommt, brennt es drei Tage lang wie Pfeffer und darnach fängt schon wieder der Eiter zu brennen an.‹ Ein neuer Lebensabschnitt hatte nun für Anna begonnen. […] Nicht von heute auf morgen konnte sie sich in diese neue Lebensphase mit Leiden, Schmerz und Siechtum einfügen. Sie schrie zuweilen vor Schmerzen und Qualen und versuchte, wie jeder junge Mensch, Heilung und Erleichterung zu finden. Erst langsam wuchs die Überzeugung, dass das Unheil, das ihr in Stammham durch den Sturz in den siedenden Kessel zugestoßen war, sich als ein unabwendbares Verhängnis zeigte, aber kein von einem toten, herzlosen Räderwerk bewirktes Zermalmen, sondern ein vom Gott der Güte und der Liebe vorgesehenes Geschehen, von Ihm geschickt oder zugelassen sei.«1
Dass Anna Schäffer Zeit brauchte, um den Sinn ihres Leidensweges zu verstehen, wird durch ein mystisches Ereignis im Jahr 1905 deutlich – vier Jahre nach dem Unfall, als Anna 23 Jahre alt war. Sie sah die Muttergottes weinen über die Sünden der Welt: »›[…] und ich frug sie, warum sie so weine.‹ Da antwortete ihr Maria: ›Ich weine deshalb, weil der lb. Jesus durch so viele Sünden von den Menschen beleidigt wird und die Welt so gottlos ist und leide alles mit dem lieben Jesus mit.‹ Anna dürfte damals die Hoffnung auf Heilung noch nicht aufgegeben haben, denn sie berichtet, dass sie die Schmerzensmutter gefragt habe: ›Ob ich gar nicht mehr gehen kann?‹ Maria gab ihr zur Antwort: ›Du musst noch viel mehr leiden als bisher!‹ Anna bemerkte in ihrem Visionsbericht dazu: ›Die darauffolgenden Jahre gestaltete sich mein Leiden so, dass ich noch viel mehr leiden durfte wie vorher.‹«2
Doch es gab für Anna Schäffer, die mit einer Monatsrente von 9 Mark nicht gerade fürstlich unterstützt wurde, noch andere Probleme zu bestehen – nicht nur physische. »Nachdem ihr ältester Bruder, der Schreinergehilfe Michael, sich am 12.12.1904 mit Kreszenz Prüflinger verheiratet hatte, übergab die Mutter das kleine Anwesen traditionsgemäß ihrem ältesten Sohn. Durch die beengten Wohnverhältnisse in dem kleinen Haus entwickelten sich zwischen Anna und ihrer Mutter einerseits und Michael und dessen Gattin andererseits Spannungen. Die schwerbehinderte und nun ständig ans Bett gefesselte Schwester wurde nun von den jungen Leuten als Belastung empfunden, und sie legten ihrem Unwillen keine Zügel an. Das Verhältnis wurde zunehmend so unleidlich, dass es auf Dauer nicht mehr zu ertragen war. So verließen Anna und ihre Mutter, vermutlich nach einer heftigen Auseinandersetzung, noch in einer Nacht das ungastlich gewordene Haus. Gottlob fanden sie im Haus Nr. 37 am Ort bei der frommen Bauernfamilie Forchhammer, ›beim Hartl‹, so der Hausname, eine geräumige helle Stube im ersten Stock. Wohlgemerkt, Mutter und Tochter besaßen nach wie vor das Wohnrecht im ›Baderhaus‹, aber sie verzichteten vorerst darauf um des Friedens willen. Die Übersiedlung fand wahrscheinlich im Jahre 1905 statt. So vertauschten die beiden das winzige Stüberl, das Anna und ihrer Mutter kaum Platz geboten hatte, mit einem gemieteten Zimmer, wenige Schritte vom Elternhaus entfernt.«3
In diesem Zimmer hatte Anna Schäffer alles, was sie fortan für ihr geistliches Leben benötigte: »[…] am Kopfende des Bettes ein kleines Regal mit Andachts- und Gebetbüchern, darunter auch die ›Nachfolge Christi‹; eine Muttergottesstatue, selbstverständlich ein Kruzifix; an der Wand hingen Bilder: Schweißtuch Christi, U. L. Frau von Altötting, Ecce Homo sowie von den ›Drei Heiligen von Griesstetten‹. An der Wand hing ein Rosenkranz. Außerdem befand sich im Zimmer ein kleiner Hausaltar, der einem Altar in der Kirche nachgebildet war.«4
Zu den familiären Spannungen und dem nötigen Umzug kam, wie bereits angedeutet, die angespannte finanzielle Situation: »Die wenigen Ersparnisse, die sich Anna durch ihre Tätigkeit in Stammham erspart hatte, gingen bald zur Neige. Obwohl die zwei Schwestern Kathi und Kreszenz sowie Bruder Hans ihre Mutter und die Behinderte nach Möglichkeit unterstützten, reichte das Geld nicht aus, um die vielen ärztlichen Eingriffe, wenngleich es Dr. Wäldin so billig als möglich machte, begleichen zu können. Bald sagte man im Dorf, mit Anna werde die Gemeinde noch Lasten bekommen, was die Leidende mit großer Sorge erfüllt hat. Aber Pfarrer Rieger, der sich um die Unfallrente erfolgreich bemüht hatte, sorgte zusammen mit seiner Haushälterin Elis Imlauer für das tägliche Essen.«5
Annas Schwester Kathi, die eigentlich eine Stelle außerhalb von Mindelstetten hatte, entschied sich eines Tages dazu, als Störnäherin (Hausnäherin, Anm. d. V.) in Mindelstetten zu arbeiten, um näher bei Mutter und Schwester zu sein und somit effektiver helfen zu können. So gut es ging, unterstützte Anna Schäffer sie bei den Näharbeiten. Es war ihr sehr wichtig, kein staatlicher Sozialfall zu sein. Sie wollte arbeiten, selbst für ihren Unterhalt sorgen. Eine Arbeitsethik, die angesichts ihres Zustands Respekt verdient und überhaupt nicht im Widerspruch stand zu ihrer religiösen Orientierung.
»In der neuen Wohnstatt beim Forchhammer stellten die drei Frauen – auch Kathi hatte hier vorübergehend ihre Bleibe – das Bett von Anna so, dass sie zur Kirche sehen konnte, worüber die Leidende sehr glücklich zu sein schien.«6 Sichtkontakt mit dem Haus Gottes – wenn die Bewegungsfreiheit eingeschränkt und der Radius gezwungenermaßen eng geworden ist, werden Dinge, die sonst ganz selbstverständlich erscheinen, enorm wichtig und kostbar.
Doch was für eine Kirche sah Anna Schäffer eigentlich? Ausgerechnet im Jahr 1905 vollzog sich in Mindelstetten ein Bauvorhaben, das die Gemeinde schon länger in Atem gehalten hatte. Im April 1905 wurde das alte Gotteshaus abgerissen, bis zum Oktober des gleichen Jahres ein neues errichtet und im Juni 1906 kam es zur Einsegnung der neuen Pfarrkirche durch den Regensburger Weihbischof, der bei dieser Gelegenheit auch Anna Schäffer, dem »leidenden Dienstmädchen«, einen Besuch abstattete.7 Anna Schäffer wird dies gefreut haben, doch die zentrale Kraftquelle war etwas anderes für sie: die hl. Kommunion, die Pfarrer Rieger ihr täglich brachte. Der Kommunionempfang war das größte Glück, das zentrale Ereignis des Tages. Wobei man wissen muss, dass die Praxis der täglichen Kommunion der Laien durch das Dekret »De quotidiana SS. Eucharistiae sumptione« des hl. Papstes Pius X. vom 20. Dezember 1905 gerade erst erlaubt und gefördert worden war.8 Pfarrer Karl Rieger war weltkirchlich gut informiert und auf dem neuesten Stand.
Rosa Imlauer, eine Nichte des Pfarrers und eine gute Freundin Anna Schäffers, hat die besondere Beziehung der Heiligen zur hl. Kommunion so beschrieben: »Anna sagte selbst oft, wenn sie noch so qualvolle Nächte durchwacht hatte und auch in der Frühe noch so matt und krank war, dass man meinte, sie könne die hl. Kommunion nicht empfangen, so war es jedes Mal wie ein Wunder: Eine Stunde vor und eine Stunde nach der Kommunion war sie dann jedes Mal körperlich und geistig so gut beisammen, dass sie sich gut auf die hl. Kommunion vorbereiten und hernach wieder danksagen konnte. Erst dann gingen die Schmerzen wieder an.«9
5. Außerordentliche Dinge (ab Herbst 1910 bis 1923)
Nach dem Unfall mussten neun Jahre vergehen, bis sich im spirituellen Leben Anna Schäffers neue Türen öffneten. 1910 war es so weit und sogar dreifach: »Am Portiunkulafest, dem ersten Sonntag im August 1910, wurde sie in den Dritten Orden des hl. Franziskus aufgenommen.«1 Emmeram H. Ritter vermutet, dass entweder Pfarrer Rieger oder die Franziskaner in Ingolstadt, die manchmal auch in Mindelstetten wirkten, dabei eine Rolle gespielt haben könnten.2 »Sie erhielt als Ordensnamen den der hl. Maria Kreszentia Höß von Kaufbeuren, jener großen bayerisch-schwäbischen Mystikerin, die zehn Jahre vorher, am 7. Oktober 1900, seliggesprochen wurde und mit ihrem Taufnamen ›Anna‹ hieß. Sie durfte ebenfalls in ihrem Leben viele psychische und physische Leiden heroisch ertragen. Neun Jahre später ließ Anna am selben Festtag 1919 ihr Ordenskleid weihen und äußerte den Wunsch, man möge sie nach ihrem Tode damit bekleiden und begraben.«3
Die beiden anderen Ereignisse waren noch stärker mystischer Natur. Wie bereits erwähnt, hatte Anna Schäffer in ihren »Träumen« ganz konkrete Begegnungen mit der übernatürlichen Welt. So auch im Herbst 1910 mit dem hl. Franziskus und schließlich mit Christus höchstpersönlich. Dazu schreibt sie: »Am 17. September 1910 träumte mir, ich sah den hl. Vater Franziskus und er ließ mir seine Wundmale sehen und sagte zu mir: ›Kind, an diesen Malen darfst du noch vieles leiden.‹ Ich verstand aber nicht, was der hl. Franziskus meinte, und getraute mir auch gar nicht, daran zu denken, jenes hl. Leiden mitleiden zu dürfen; dafür hielt ich mich arme große Sünderin gänzlich für unwürdig.«4
Bald darauf, Anfang Oktober, hatte Anna Schäffer den nächsten »Traum«, die nächste mystische Begegnung: »Am 4. Oktober 1910, am Feste des hl. Franziskus, hielt ich nachts die Hl. Stunde, wie ich sie täglich halte. Diese und alle anderen Gebetsstunden halte ich stets im Geiste vor dem heiligsten Sakramente. Als ich nun einige Zeit betete, da umgab mich auf einmal ein wunderbares Licht, welches meinen ganzen Geist und Körper durchdrang, und ich sah den Heiland in diesem Lichtmeer. Er sagte zu mir: ›Dich habe ich angenommen zur Sühne meines heiligsten Sakramentes. Bei der hl. Kommunion morgens sollst du fortan jene Schmerzen meiner Passion verspüren, womit ich dich armseliges Nichts erlöst habe. Leide, opfere und sühne in stiller Verborgenheit.‹ Dann verschwand der Heiland. […] Als mir nun morgens der Hochw. Herr Pfarrer die hl. Kommunion brachte und er vor derselben die Gebete betete ›Domine non sum dignus …‹, da sah ich von der hl. Hostie fünf Feuerstrahlen ausgehen, die wie ein Blitz in meine Hände, Füße und ins Herz gingen, und ein unaussprechlicher Schmerz begann sogleich an den genannten Teilen. Als ich nun die hl. Kommunion empfangen hatte, spürte ich im Innern solche Feuersglut, dass ich glaubte, ich müsste verbrennen.«5
»Ohne Unterbrechung«, wie Anna Schäffer weiter mitteilt, durfte sie seit dieser Vision mit Christus leiden, und dabei hatte sie »stets die heftigsten Schmerzen an den Vorderfüßen, Händen, Herz und Kopf«.6 Auch im Alltag bei diversen Tätigkeiten: »Oft wenn ich schreibe, sticke, oder was ich halt mit den Händen arbeiten kann, da ist mir schon oftmals die Stricknadel oder der Federhalter usw. aus der Hand gefallen ob der großen Schmerzen wegen. Ich opferte dann dem lb. Heiland mit einem stillen Seufzer alles Schwere und Leidvolle mit Dank und Liebe auf.«7 Nur eines war ihr von nun an wichtig: »ein Opfer der Liebe« zu sein.8
Die fünf Feuerstrahlen zu erkennen und zu spüren, war eine eindrucksvolle Erfahrung, doch die Intensität der physischen Schmerzen wechselte bei Anna Schäffer, und als wären diese Schmerzen nicht genug, bat Anna um göttliche Diskretion und mehr Schmerzen: Sie wollte die Stigmata unsichtbar tragen. Das Maximum der Selbstverleugnung. »An manchen Tagen ist das Leiden an Händen, Füßen usw. sehr vermehrt, besonders an den Donnerstagen und Freitagen und an den Sonn- und Festtagen. Schon immer einige Tage zur Vorbereitung auf die hohen Festtage ist das Leiden sehr vermehrt. […] Einige Male sah ich an meinen Händen und Füßen blaurote Flecken an den Stellen, wo sie mir immer so wehtun. Ich bat den lb. Heiland bei der Kommunion immer so viel, dass man die blauroten Flecken nicht mehr sehen möchte, dafür dürften die Schmerzen größer sein als sonst. Und von da an sah ich auch keine solchen Flecken mehr an den genannten Stellen. O mein Gott, wie glücklich bin ich, diese unaussprechlichen Schmerzen verborgen leiden zu können.«9
Warum hat Anna Schäffer das verborgene Leiden dennoch schriftlich beschrieben? Eine plausible Erklärung liefert Emmeram H. Ritter: »Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass die Selige, die ja stets ihre Stigmatisation zu verbergen wusste und diese auch kaum äußerlich sichtbar war, erst auf den ausdrücklichen Wunsch ihres Seelenführers, Pfarrer Karl Rieger, hin die Vision schriftlich niedergelegt hat. Anna machte selbst in ihrem Traumheft davon keine Erwähnung, vermutlich deshalb, weil sie im Gehorsam gegenüber dem Heiland nur in völliger Verborgenheit an den Wundmalen leiden wollte.«10
Wie kompliziert ihr theologisch-physischer Wunsch in der Realität zu verwirklichen war, zeigte sich an einem – zunächst vielleicht paradox anmutenden – medizinischen Problem, das sie in ihren Aufzeichnungen nicht verschwieg und mit dem sie schon bald konfrontiert wurde: »Im Juni 1913 sagte der Arzt, wie er ja schon öfter gesagt hatte: die beiden Füße abnehmen! Wegen der Füße abzunehmen war es mir innerlich nicht schwer, sondern nur eins war mir darüber schwer, dass ich nämlich an den Vorderfüßen dann den Schmerz nicht mehr verspüren dürfte, den mir der lb. Heiland von seinem hl. Leiden geschenkt hat. Ich bat den lb. Heiland Tag und Nacht, er möchte es so fügen, wie es für mich arme Sünderin am besten ist. Ein paar Tage darauf sah ich den lb. Heiland nach der hl. Kommunion und ich sagte es Ihm, was mich so sehr bedrückte. Der lb. Jesus sagte: ›Keine menschliche Weisheit (er meinte damit die Ärzte) wird es je begreifen, dass ich Dich als Sühneopfer auserkoren habe.‹«11 Anna Schäffer hatte also keine Angst um ihre physisch-ästhetische Verfasstheit, sie war lediglich besorgt darüber, im Falle einer Amputation nicht genug für Christus leiden zu können. So weit ging ihre Hingabe.
Darüber hinaus war das Jahr 1913 für Anna Schäffer wichtig wegen neuer himmlischer Kontakte: »Vermutlich durch ihren Seelenführer begegnete sie einer großen, bis dahin noch kaum bekannten Heiligengestalt, nämlich Gemma Galgani, die auf ihr geistliches Leben einen richtungsweisenden Einfluss nehmen sollte. Ganz begeistert schrieb Anna am 16. Juni 1913 ihrer Freundin Anna Bortenhauser: ›Übersende Dir anbei 2 Bildchen, von Gemma Galgani, wie ich Dir schon erzählte von ihr, als Du bei mir warst. Eines gehört Dir, das andere für Frl. Mari. Weißt, liebe Anna, die Lebensbeschreibung von Gemma Galgani sollt Ihr euch schon bestellen […] und ich weiß im Voraus, dass Euch dieses Buch recht viel Freude macht. Was diese hl. Jungfrau alles leiden musste; also wirklich erbauend. Gelt, lb. Anna, auch in unseren Tagen gibt es noch Heilige, dass sie halt oft ganz verborgen leben und die Welt dieselben nicht kennt. […]‹ Am Ende des Briefes gab sie ihrer Freundin noch den konkreten Hinweis: ›Das Buch von Gemma könnt Ihr haben von der Verlagsbuchhandlung von Eduard Mager, Donauwörth.‹ Übrigens dürfte es sich dabei um das Werk von Germano di S. Stanislao handeln mit dem Titel ›Briefe und Ekstasen der Dienerin Gottes Gemma Galgani, Jungfrau von Lucca‹, das L. Schlegel ins Deutsche übersetzt hatte.«12 Gemma Galgani (1878–1903) war eine italienische Mystikerin, die wie Anna Schäffer gern in einen Orden eingetreten wäre, doch aus gesundheitlichen Gründen keinen Zugang bekam. In ihrem kurzen Leben wurde die Heilige mit Visionen und den Stigmata beschenkt.
Ebenfalls an die Pfarrhaushälterin Anna Bortenhauser adressiert ist ein Brief Anna Schäffers vom 26. Juli 1913, dem Namenstag der beiden. Neben der »Glückseligkeit« des Kommunionempfangs, den sie ihr schildert, und ihrem Vorsatz, »alles mit Geduld u. Ergebung leiden« zu wollen, »um uns noch manches Verdienst zu sammeln für die Ewigkeit«, kommt sie darin auch auf eine erstaunliche Traumreise zu sprechen, welche an die mystischen Visionen der seligen Anna Katharina Emmerick (1774–1824) erinnert: »Was ist’s mit Dir nach Jerusalem? Diese Woche war ich im Traum dort, es war mir, als sehe ich den Esel, welchen der lb. Jesus hatte, als er seinen Einzug hielt. Auch führte mich eine Klosterschwester in einen großen Saal, sie sagte: ›Da hat Jesus das hl. Sakrament des Altars eingesetzt.‹ Es war der Abendmahlssaal. Sie sagte auch: ›In diesem Saale wird alle Tage der hl. Rosenkranz gebetet zum Andenken.‹ Mein Gott, war es dort im Traum schon so schön; wie muss es dann erst in Wirklichkeit sein?«13 Eine Fernreise der besonderen Art.

So schön und idyllisch wie im Jerusalem-Traum sollte es in Mindelstetten und Umgebung aber nicht mehr lange bleiben. Es »braute sich über Europa ein schreckliches Unheil zusammen. […] Zu Beginn handelte es sich vorwiegend noch um die alten unglücklichen Auseinandersetzungen innerhalb der überlieferten europäischen Staatensysteme. Die Katholiken waren keineswegs unvorbereitet, als am 1. August 1914 die Kriegserklärung des Deutschen Reiches an Russland erfolgte und der Befehl zur allgemeinen Mobilmachung erteilt wurde, nachdem Österreich-Ungarn bereits am 28. Juli Serbien den Krieg erklärt hatte. […] Der Episkopat des Königreiches Bayern rief in einem Hirtenbrief vom 3. August 1914 zu einem Gebetssturm auf. […] Die bayerischen Bischöfe ordneten zugleich regelmäßige Betstunden an, gaben dem Klerus Weisungen und verlangten, dass in allen Kirchen täglich nach der Hauptmesse folgendes Gebet verrichtet werden müsse: ›O Gott, in Deiner Macht liegt es, die Kriege zu zermalmen und die Angriffe zurückzuweisen, Du umgibst alle, die auf Dich hoffen, mit Deinem allmächtigen Schutze, hilf uns, Deinen Dienern, die wir vertrauensvoll zu Dir flehen […] die dem Rufe des Vaterlandes folgend im Felde stehen. Bändige den Übermut des Feindes und lass uns alle wieder in Dank und Demut die Segnungen allseitigen und ungestörten Friedens genießen. Durch Jesum Christum, unseren Herrn. Amen.‹
Pfarrer Rieger hatte bereits von sich aus am Sonntag, dem 2. August 1914, eine Bittandacht vor dem Allerheiligsten um glückliche Wende zur Verhinderung eines Krieges gehalten. Am darauffolgenden Sonntag hielt er die vorgeschriebene Bittandacht für das bayerische Vaterland. Zugleich verkündete er, dass nunmehr wegen des Arbeitskräftemangels laut oberhirtlicher Genehmigung Erntearbeiten, wenn notwendig, auch an Sonn- und Feiertagen gestattet seien.
Am 20. August 1914 wurde die katholische Welt durch die Nachricht erschüttert, dass der fromme Papst Pius X. – […] – das Zeitliche gesegnet hat. […] Zwei Wochen später, am 4. September, wurde die Wahl seines Nachfolgers, Papst Benedikts XV., der als Friedenspapst in die Geschichte eingegangen ist, bekannt.«14 Pius X. (1835–1914) und Benedikt XV. (1854–1922) waren die Päpste, welche die irdische Leidenszeit Anna Schäffers wesentlich prägten.
Emmeram H. Ritter berichtet weiter: »Der Erste Weltkrieg forderte bereits in den ersten Monaten, auch in Mindelstetten, blutigen Tribut. Die ersten Gefallenenmeldungen trafen ein und brachten großes Leid in die Familien. Anna verfolgte das Geschehen mit tiefer Anteilnahme. Ihre leiblichen und seelischen Schmerzen, durch die sie stellvertretende Sühne leistete, waren schon bisher an solchen Tagen besonders schlimm, an denen die gottvergessende Menschheit in Ausgelassenheit sündigte. Nun aber, da Tag für Tag an allen Fronten himmelschreiende Sünden begangen wurden, litt sie mehr denn je. […] Anna, ihre Mutter und die ganze Familie Schäffer wurden auch persönlich schwer getroffen. Am 11. Dezember 1914 erhielten sie von Paul Schlittenbauer, einem Kameraden ihres Bruders Leopold, eine Karte. Er teilte mit, dass Leopold, der bisher als vermisst gemeldet war, mit Sicherheit am 24. September gefallen sei. Dort, wo sich ihr Bruder befunden habe, sei eine Granate eingeschlagen und die ganze Truppe sei getötet worden. Die Erkennungsmarken hätten deshalb nicht mehr abgenommen werden können, weil es so viele Tote gewesen seien und es bereits 10 Uhr nachts war, als sie begraben wurden.«15
Dies war noch nicht alles: »Auch der zweite Bruder Hans wurde schwer verwundet und sein Befinden ließ noch viel zu wünschen übrig. Fünf Schrapnellkugeln und drei Granatsplitter waren bereits entfernt, aber noch immer steckten zwei Kugeln 13 cm tief in seinem Leib. Aber mit bewunderungswürdiger Gelassenheit schrieb Anna darüber ihrer Freundin: »Nun überlassen wir auch jenes Kreuz so ganz und gar, so wie es Jesus mit uns haben will. Über kurz oder lang gibt es ja für alle ein Wiedersehen; und das soll, wie wir hoffen werden, im Himmel sein.«16
Die Mystikerin aus Mindelstetten verknüpfte das durch den Krieg verursachte Leid der anderen aber durchaus auch mit ihrem eigenen Leiden, wie ein Brief an ihre Freundin Anna Bortenhauser belegt: »Bei mir, lb. Anna, ist es immer das Gleiche, im Ganzen 32 Wunden, welche recht stark eitern u. seit Krieg ist, noch mehr. Opfern wir auch unsere Leiden auf für die Schlachtfeldsünden u. um glückselige Sterbestunde für die Soldaten; wollen wir eben dem lb. Heiland recht viel Sühne leisten in dieser gefahrvollen Zeit.«17

Die Vertreter der Kirche blieben angesichts des Krieges nicht stumm. »Am 10. Januar 1915 erließ Papst Benedikt XV. ein Dekret, demzufolge für den Sonntag Sexagesima (7. Februar) ›das von Wunden zerfleischte Europa, dann auf den Passionssonntag die gesamte übrige katholische Welt vor das ausgesetzte hochwürdigste Gut‹ zum Friedensgebet zusammengerufen wurde, ›um Abwendung der über uns gekommenen schrecklichen Geißel‹. Alle Gläubigen, welche die hl. Kommunion empfangen hatten, konnten unter den üblichen Bedingungen einen vollkommenen Ablass gewinnen.«18 Auch auf lokaler Ebene fehlte es nicht an Vernunft und Klarheit: »Im Fasten-Hirtenbrief vom 31. Januar 1915 behandelte der Regensburger Bischof Antonius von Henle (1906–1927) das Thema ›Gottesfurcht‹. Er forderte darin die Gläubigen eindringlich auf, um baldigen Frieden zu beten, denn dies sei geradezu ›eine Pflicht der Gottesfurcht‹ […].«19 Auch Pfarrer Rieger forderte seine Gemeinde in Mindelstetten dazu auf, für den Frieden zu beten. Das Thema Buße und Sühne spielte damals nicht nur im Zimmer von Anna Schäffer eine Rolle – das ganze kirchliche Leben war davon bestimmt.20 Mögen die einzelnen Gläubigen die damit verbundenen Übungen auch auf unterschiedliche Weise umgesetzt haben.
»Anna Schäffer nahm am Weltgeschehen in ihrer Weise ganz besonderen Anteil. Die Ermahnungen des Heiligen Vaters, des Bischofs und ihres Seelsorgers fanden bei ihr nicht nur ein offenes Ohr, sondern vor allem ein weit geöffnetes Herz. Gebet, Opfer, Buße, damals besonders aktuelle Anliegen, waren ihr längst vertraut. Am Weißen Sonntag (11. April) legte sie ein sogenanntes ›Blutgelöbnis‹ ab. Auf einen kleinen Zettel schrieb sie mit ihrem eigenen Blut folgende Zeilen: ›Es lebe Jesus! Ich will nur für Jesus leben, leiden und sterben. Nur wie es der liebe Jesus haben will, so soll alles geschehen!‹ Und auf der Rückseite vermerkte sie: ›Jesus, Maria und Joseph, Euch schenke ich mein Herz und meine Seele!‹ Sie machte das große Anliegen des Heiligen Vaters, die Beendigung des Weltkrieges und den Frieden, zu ihrem eigenen und versuchte auch ihre Freundinnen zu bewegen, gleich ihr zu beten und zu opfern.«21
Emmeram Ritter entnimmt dem »Verkündbuch« von Pfarrer Rieger für das Jahr 1915 einen interessanten Eintrag: »Am 30. Juni ließ Walburga Schäffer, die Schwägerin Annas, für den noch immer als vermisst erklärten und noch immer nicht aufgefundenen Ehemann Leopold Schäffer eine hl. Messe lesen.«22
Doch nicht nur der Krieg wütete. Auch in Anna Schäffer spielten sich offenbar innere Kämpfe ab. Sie haderte nicht mit Gott und mit ihrem Schicksal, aber wie das am 12. Juli 1915 verfasste »Krankheits- und Operationsgedicht« zeigt, versuchte sie, durch Kreativität Sinn und Ordnung in ihr Leben zu bringen:
1.
»Fast noch ein Kind so jung an Jahren –
Stets sorglos und voll Heiterkeit –
Kannt’ ich noch nicht des Lebens Sorgen –
Mein Herz war voll Zufriedenheit!«
2.
»Doch bald soll’s anders kommen –
Die Hand des Herrn hat mich erfasst –
Mich hat der Krankheit Weh und Schmerzen –
Ans bittre Krankenbett gebracht!«
3.
»Mich auf den Operationstisch hinzulegen –
Dazu gehört wohl Mut –
An diesem durft’ ich dreißigmal –
Dort opfern Schmerz und Blut!«
4.
»Nochmals dacht ich an meine Lieben –
Und sagte allen: ›Lebewohl‹ –
Dann noch ein Blick zum Kreuzesdulder –
Aus dessen Wunden Heil mir quoll!«
5.
»Ihm wollt ich stets mein Leben schenken –
Auch für Ihn leiden in dieser Stund’ –
Das waren meine letzten Worte –
Das wünschte ich mit Herz und Mund!«
6.
»Als man das Chloroform mir reichte –
So widerlich erstickend süß –
Da hat sich jeder Nerv gestärket –
Bis das Bewusstsein mich verließ!«
7.
»Bleischwer lag ich in meinen Gliedern –
Im Kopfe grollt’s wie Donner mir –
Und konnte mich nicht mehr befassen –
Was weiter dann geschah mit mir!«
8.
»Und sollt ich das Erwachen schildern –
So finde ich die Worte nicht –
Denn niemand kann es je begreifen –
Wenn man nicht selber hat gefühlt!«
9.
»Lang lag ich da noch fantasierend –
Gab alles kund, was mir am Herzen lag –
Bis dass der Wundschmerz ach so brennend –
Mir das Bewusstsein wiedergab!«
10.
»Ein hartes bitt’res Krankenlager –
Hat mich gefesselt lang und schwer –
So schmerzvoll ob der vielen Wunden –
Und doch so Trostes voll und hehr!«
11.
»Ach eines ist mir stets geblieben –
Ein innig stilles Gottvertrau’n –
Das lässt mich in den schweren Stunden –
Stets fest auf seine Hilfe bau’n!«
12.
»Im heiligen Thron der Liebe wohnt –
Der stets mir seine Gnad’ erweist –
Und täglich meine kranke Seele –
Im Sakrament der Liebe speist!«
13.
»Drum bin ich hier auch nicht verlassen –
In meiner Leidens-Einsamkeit –
Und freue mich auf jene Stunde –
Die schau’n mich lässt: ›Die Ewigkeit‹!«
14.
»Herr, neig’ Dich bald hernieder –
Und nehm mich bei der Hand –
Und führ’ Dein krankes Schäflein –
In Deines Friedens Land!«
15.
»Dann bin ich nicht mehr einsam –
In stiller Seligkeit –
Und ruh an Deinem Herzen –
Dir ewiglich geweiht!«23
Kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember 1915, schrieb Anna Schäffer der Pfarrhaushälterin Anna Bortenhauser einen Brief, der sehr um den Wert des Opfers kreist und in dem sie der Empfängerin ihr unterstützendes Gebet in einem »schweren Anliegen« versichert. Über sich selbst schreibt sie schon mit Blick auf das kommende Jahr: »Im neuen Jahr tritt für mich der 16. Jahrgang meines Leidens heran u. ich opfere dem lb. Jesus wieder alle vergangenen, gegenwärtigen u. zukünftigen Leiden u. Schmerzen auf zur Sühne. Wenn mir oft meine vielen Wunden so arg schmerzen u. mir für viele Nächte den Schlaf berauben, o wie erfrischend ist dann der Gedanke ›Herr, weil Du es so willst!‹. Herz Jesu, ich danke Dir für die Schmerzen, mach aus mir eine Braut Deines Herzens! In solch schweren Stunden u. schlaflosen Nächten ist das schönste Plätzchen vor dem Tabernakel vor Jesus im hl. Sakramente, wir erhalten wieder neue Kraft u. Gnaden, um wieder weiter zu leiden!«24

So richtig und wichtig die Friedensappelle des Papstes und anderer Kirchenvertreter auch waren – der Krieg setzte sich fort. Der Teufel schien ganz Europa in seiner Hand zu haben. Auch im Zimmer Anna Schäffers wütete das Böse, wie man einem vom Schweiß durchtränkten Schriftstück entnehmen kann, das Anna am 2. Januar 1916 verfasste und vermutlich auch auf ihrem Körper getragen hat. Sie verspricht darin, dem Teufel zu widersagen: »Mein lieber Gott, ich kenne meine große Unwissenheit, meine Unwürdigkeit, meine übergroße Schwachheit, ich bin mir meiner vielen großen Sünden bewusst, wodurch ich es verdient habe, von Dir verlassen zu werden, sowie der großen Gefahren, denen ich wegen meines überaus elenden Zustandes ausgesetzt bin; daher komme ich, werfe mich Dir zu Füßen u. beteure vor dem Himmel u. vor der Erde, dass ich keinem Werke des höllischen Geistes je zustimmen will, ich erkläre vielmehr, dass ich mit der ganzen Kraft meines Willens diesem bösen Feinde widersage u. nicht das Geringste mit ihm zu tun haben will. Fern sei er darum von mir, von meinem Verstand, von meinem Herzen, von meinem Leibe. Wenn Du, mein Gott, in Deinem unerforschlichen Ratschlusse zulassen willst, dass der höllische Feind an mich herantritt u. mich belästigt, so erkläre u. beteure ich, keiner einzigen Handlung zustimmen zu wollen, viel weniger noch seinen schlimmen Absichten u. niederen Plänen.«25
Das Jahr 1916 sollte aus mindestens zwei Gründen ein wichtiges Jahr für Anna Schäffer werden, markiert es doch den Beginn ihres sogenannten »Briefapostolats«, also der Verbreitung von geistlichen Impulsen via Postkarten und Briefen, und einer Reihe von – wenn man so will – persönlichen Begegnungen mit Personen aus den mystischen Gefilden des Himmels.
»Die wichtigsten Dokumente des Schriftennachlasses Anna Schäffers sind sicher ihre Briefe. Sie geben Aufschluss über ihr Seelenleben, ihr Denken und Fühlen, nicht zuletzt über ihre Leidensgeschichte.«26 124 Briefe Anna Schäffers liegen heute insgesamt vor. Emmeram H. Ritter stellt in der Einleitung zu den Schriften Anna Schäffers zu Recht fest: »Es ist überaus staunenswert, dass ein einfacher Mensch mit Volksschulbildung und zudem vom Krankenlager aus befähigt war, eine solche Leistung zu vollbringen. Wenngleich ihr Stil, der damaligen Frömmigkeit entsprechend, heute zuweilen als ›süßlich‹ erscheint, sind dennoch ihre grundlegenden Gedankengänge theologisch durchaus richtig und besitzen überzeitliche Gültigkeit.«27 Diese »Briefe, denen sie oft immer geschickter geformte Gedichte voransetzte und sie zuweilen auch mit schönen Zeichnungen, die sie in ihren Visionen sah, geschmückt hat, geben einen Einblick in die Grundthemen ihres geistlichen Lebens: Christus im Sakrament des Altares, das Leiden Jesu und sein Kreuz, die Schmerzensmutter, Betrachtungen über den Sinn ihres eigenen Leidens, die Sterbenssehnsucht«.28
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.