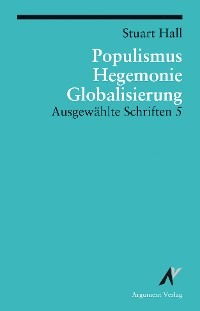Kitabı oku: «Populismus, Hegemonie, Globalisierung»
Stuart Hall
Populismus
Hegemonie
Globalisierung
Ausgewählte Schriften 5
Herausgegeben von Victor Rego Diaz, Juha Koivisto und Ingo Lauggas

Argument Verlag
Übersetzt von Yasar Aydin, Thomas Barfuss, Manfred Behrens, Wieland Elfferding, Stefan Howald, Ines Langemeyer, Ingo Lauggas, Thomas Laugstien, Ulrich Meditsch, Brita Pohl, Victor Rego Diaz, Jan Rehmann, Katrin Reimer, Ingar Solty, Susan Steiner, Kolja Swingle, Markus Weidmann
Dieses Buch entstand mit finanzieller Unterstützung des Instituts für kritische Theorie InkriT e. V.
Stuart Hall – Ausgewählte Schriften bei Argument:
Ideologie, Kultur, Rassismus (Schriften 1)
Rassismus und kulturelle Identität (Schriften 2)
Cultural Studies (Schriften 3)
Ideologie, Identität, Repräsentation (Schriften 4)
Populismus, Hegemonie, Globalisierung (Schriften 5)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der deutschen Fassung vorbehalten
© Argument Verlag 2014
Glashüttenstraße 28, 20357 Hamburg
Telefon 040/4018000 – Fax 040/40180020
Satz: Iris Konopik
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2018
ISBN 978-3-86754-856-4
Erste Auflage 2014
Inhalt
Vorwort
Der Anspruch, theoretische Arbeit mit politischem Eingreifen zu verbinden, lag nicht nur dem Selbstverständnis der frühen Cultural Studies zugrunde, deren Pionierphase eng mit der Entwicklung der britischen New Left verbunden war, sondern auch der Arbeit am 1964 gegründeten, legendären Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies, dem Stuart Hall ab 1968 elf Jahre lang vorstand. Auch der vorliegende fünfte Band der Ausgewählten Schriften Halls trägt dem »politischen Anliegen intellektueller Arbeit« (Hall 1999: 16) Rechnung und ist demnach geprägt von einer Theoriebildung, die im Befreiungsinteresse sich stets politisch eingreifend versteht. Stuart Hall selbst hat wiederholt davon berichtet, wie ganz unmittelbar versucht wurde, »innerhalb der Cultural Studies eine institutionelle Praxis zu entwickeln, die organische Intellektuelle produzieren würde« (2000a: 41). Diese gramscianische Perspektive prägt nicht nur sein politisches Verständnis intellektueller Arbeit, sondern bekanntermaßen Halls ganzes Werk, das, anknüpfend an Gramscis »Erneuerung des Marxismus« (Hall 1989), Kulturanalyse als Gesellschaftsanalyse begreift und Fragen von Ökonomie und Ideologie, Identität und Alltag stets mit jener nach Macht verknüpft. Die hier versammelten Texte nun richten diese spezifische Perspektive auf Staat und Demokratie und gruppieren sich folgerichtig – auch dort, wo sein Name nicht fällt – um Antonio Gramscis Hegemoniekonzept.
Halls Texte zu Staat, Populismus und Globalisierung nehmen die zentralen Elemente und Wirkungsweisen von Hegemonie in den Blick, handeln somit von Herrschaft und Macht, Ideologie und Alltagsverstand, Repräsentation und Partizipation und setzen diese in Bezug zu den wesentlichen strategischen und institutionellen Akteuren in der Gesellschaft: Staat, Parteien, Intellektuelle, kulturelle Szenen usw. Die Arbeit Stuart Halls bewegt sich demnach bis in die Gegenwart nicht nur in »Hörweite des Marxismus« (Hall 2000a: 38), sondern macht sich – nachdem Hall schon vor Jahrzehnten neben Raymond Williams wesentlich zur Verbreitung Gramscis außerhalb Italiens beigetragen hat – auch um dem Nachweis verdient, dass das Hegemoniekonzept, sorgfältig angewendet, heute alles andere denn eine veraltete Kategorie ist. Wenn damit das Gerede von vorgeblich »posthegemonial« gewordenen Machtverhältnissen Lügen gestraft wird, wonach das Konzept lediglich »für eine bestimmte Epoche großen Wahrheitswert besessen hat«, die sich nun jedoch »ihrem Ende zuneigt« (Lash 2011: 96), stehen Halls Schriften gleichzeitig gegen post-strukturelle Verflachungen und Ideologisierungen und treten neu sich herausbildenden Herrschaftsverhältnissen und -weisen kritisch entgegen.
Damit lässt sich das Erbe der als ›politisches Theorieprojekt‹ angetretenen Cultural Studies mit Hall gegen seine Nachfolger verteidigen. Die hier zusammengestellten Texte verweisen anhand einer bis ins Jetzt reichenden Theoriegeschichte auf den heute minoritären Teil der Cultural Studies, der nicht wie ihr Mainstream »weitgehend in den Sog der neoliberalen Hegemonie geraten« ist (Ampuja/Koivisto 2012: 446). Sie nehmen das gesellschaftliche Ganze in den Blick, bringen »die gelebte Erfahrung von Individuen und sozialen Gruppen mit gesellschaftlichen Prozessen, Diskursen und Kämpfen in Zusammenhang« (ebenda) und analysieren deren Vermittlung. Die Kategorie der Hegemonie erweist sich für eine solche Analyse gesellschaftlicher Kämpfe und politischer Konjunkturen als unverzichtbares Instrument.
Die in diesem Band versammelten Texte wurden im Zeitraum zwischen 1980 und 2011 verfasst. Stuart Hall ist in seinen Analysen besonders an »historischen Differenzierungen« (siehe insbesondere Zur Deutung der Krise in diesem Band) interessiert. Mit der vorliegenden Textsammlung haben wir versucht, diesem Interesse in zweierlei Hinsicht Rechnung zu tragen. Zum einen bewegen sich die Texte im zeitlichen Maßstab von historischen Rekonstruktionen hin zu aktuelleren Entwicklungen. Erst die Kenntnis des Vergangenen legt die Spezifik des Neuen offen. Zum anderen sind sie in einer groben chronologischen Reihenfolge geordnet, die es möglich macht, die Entwicklung von Halls Forschungsarbeit nachzuvollziehen. In diesem Vorwort folgen wir nicht der Reihenfolge der Texte, sondern Halls analytischer Arbeitsweise, um herauszustellen, wie er bestimmte Themen und Positionen im Laufe der Zeit immer wieder aufgreift, kritisch umschreibt und erneuert fortschreibt; und wie er danach strebt, Zusammenhänge und Verknüpfungen zwischen seinen verschiedenen Analysen begründet und mit Nachdruck herzustellen.
Ein durchgehendes Anliegen ist die Analyse bestehender und sich verschiebender Kräfteverhältnisse, insbesondere in Perioden grundlegender Krisen bzw. bestimmter Konjunkturen. Auch wenn Krisen immer eine ökonomische Grundlage haben, interessiert Hall das komplexe Gefüge von ökonomischen und sozialen, politischen und kulturellen Verhältnissen und Wechselwirkungen, er fragt nach den darin wirkenden Institutionen und Akteuren, ihren herrschaftssichernden ideologischen oder herrschaftskritisch-emanzipatorischen Strategien und den sich dabei wandelnden Haltungen und Praxen. Ein Beispiel für eine umfassende Krisen- und Hegemonie-Analyse findet sich in Die Entstehung des repräsentativen/ interventionistischen Staates (1984). Hall rekonstruiert die Transformation politischer und industrieller Repräsentation im Zeitraum von 1880 bis 1920 im Kontext des Niedergangs spätviktorianischer Repräsentationsverhältnisse und der sich durchsetzenden Massendemokratie; hegemoniepolitisch ortet er in dieser Zeitspanne die erfolgreiche Durchsetzung der Interessen der popularen Klassen und Bewegungen und zugleich ihre kontrollierte Einpassung in eine neue ökonomische und gesellschaftliche Entwicklungsstufe. – In Die Stadt zwischen kosmopolitischen Versprechungen und multikulturellen Realitäten (2003) wird die Frage diskutiert, wie sich die neoliberalen Globalisierungs- und neueren Migrationsprozesse in der zeitgenössischen ›globalen/multikulturellen‹ Stadt aufeinander beziehen. Hall analysiert die Verschiebung der Kräfteverhältnisse am Beispiel der Stadt London und identifiziert die globale/multikulturelle Stadt als Möglichkeitsraum für »multikulturelle Diversität« und als »Übergangszone« zwischen »komplexen Interaktions- und Verteilungsmustern der Aktivitäten, Ressourcen und Haltungen«; zugleich sieht er aufgrund der sich vertiefenden ökonomischen, politischen und kulturellen Ungleichheiten und Trennungen potenziell explosivere Konflikte auftreten, die insbesondere durch einen ›differenziellen Rassismus‹ angetrieben werden. – In Eine permanente neoliberale Revolution (2011) legt Hall eine aktuelle Krisenanalyse vor: er blickt auf die spezifische britische Konstellation nach der Finanzmarktkrise, dem Ende von New Labour und dem Machtantritt einer Koalition aus Konservativen und Liberaldemokraten. Er schreibt dem derzeitigen Neoliberalismus die herrschaftsmächtige Fähigkeit zu, die Gesellschaft mittels einer ideologischen Arbeit der »Desartikulation und Reartikulation« zu transcodieren, gestützt durch »kulturelle Praxen der Inwertsetzung und des Individualismus« wie auch durch den Zugriff auf eine autoritäre Staatsgewalt und globale militärische Einsätze, um die Märkte und Investitionen zu schützen und die Erfolgsbedingungen für das globale kapitalistische Unternehmertum zu gewährleisten. – In Zur Deutung der Krise (2010) entfalten Stuart Hall und Doreen Massey den Hegemonie-Begriff, um damit historische und aktuelle Konjunkturen bzw. Krisenperioden, die Verknüpfung von ideologischen Strategien zur Eroberung des Alltagsverstandes sowie die bestehenden und sich verschiebenden Kräfteverhältnisse genauer zu verstehen.
Ein wiederkehrendes Untersuchungsfeld ist die Auseinandersetzung mit der Labour Party und New Labour. Ihre besondere Bedeutung erhält die Partei für Hall, weil sie einst die Repräsentation breiter popularer Klassen und Bewegungen im Staat ermöglicht und später ihre emanzipatorische Wirkungskraft im Dunst der Anpassung an Marktideologien und -politiken verloren hat. Während in Entstehung des repräsentativen/interventionistischen Staates der Aufstieg der Labour Party als organisatorische Kraft zu Beginn des 20. Jahrhunderts nachzuvollziehen ist, bietet die Krise der politischen Repräsentation seit den 1970er Jahren Anlass zu einer grundlegenden Kritik des »sozialdemokratischen Managements« der kapitalistischen Krise. In Popular-demokratischer oder autoritärer Populismus (1980) kontrastiert Hall den Hegemonieverlust sozialdemokratischer Regierungspolitiken und -diskurse mit den Strategien des aufsteigenden Thatcherismus. Dem Thatcherismus sei es gelungen, sich in der Phase einer sozioökonomischen Krise auf dem Feld der popularen Ideologien als reorganisierte Kraft darzustellen. Auf der Grundlage bereits existierender Law-und-Order-Politiken der herrschenden Sozialdemokratie artikulierte der Thatcherismus einen nach rechts gewendeten ›autoritären Populismus‹, der die traditionalistischen Elemente des Alltagsverstandes der Volksmoral zu aktivieren vermochte und einen Prozess der ›passiven Revolution‹ von unten konstituierte. – Die Regierungspolitik von New Labour in den 1990er Jahren, nach der neoliberalen Transformation von Gesellschaft und Ökonomie durch den Thatcherismus, ist Kern der Analyse in den Texten Bewegung ohne Ziel (1998), New Labours doppelte Kehrtwende (2003) und »Die soziale Frage soll nicht mehr gestellt werden« (2005). Halls Diskursanalysen durchforsten die Hegemonie der neoliberalen Doktrin in Sprache und Diskursen, in Haltungen der Labour-Politiker und ihrer spezifischen Regierungsweise, in Verwaltungsmodalitäten, Kampagnen und gesellschaftspolitischen Interventionen von New Labour. Die Durchsetzung der ›Modernisierung‹ von Staat, Gesellschaft und Politik im Sinne von New Labour wurde für Hall durch eine zwingende ›Transformation der Sozialdemokratie‹ ermöglicht, die durch semantische Beliebigkeit und (passive) Zustimmung zum ›Markt-Fundamentalismus‹ zugleich eine Deformation der Partei und des Alltagsverstands der Bevölkerung war. Die ideologische Kompetenz hierfür identifiziert er in der hybriden ideologischen Strategie von New Labour: die Propagierung der kapitalistischen Marktwirtschaft, gestützt durch das Anknüpfen an den thatcheristischen ›autoritäten Populismus‹, und die untergeordnete Berücksichtung der Interessen der traditionellen Parteiflügel und der sozial Benachteiligten in der Bevölkerung.
Der Staat ist für Stuart Hall ein zentraler, strategischer Akteur und zugleich ein komplexes, institutionelles Gefüge in hegemonialen Konstellationen und Krisen-Perioden: In Der strittige Staat (1984) rekonstruiert er die Herausbildung des ›liberal-demokratischen‹ Staates und geht dabei bis auf die Ursprünge der Herausbildung staatlicher Merkmale in der Antike zurück. Das Interesse bezieht sich auf den Einfluss bereits bestehender politischer, sozialer und kultureller Hegemoniemerkmale im Zuge der Durchsetzung einer kapitalistischen Ökonomie; und Hall ergänzt diese gramscianische Analyse um die grundlegende Bedeutung patriarchaler Geschlechterverhältnisse. Im Ringen um Hegemonie veränderten sich die Diskurse um die Legitimitätsform der Staatsgewalt genauso wie die um die Reichweite der demokratischen Partizipation der ›Staatsbürger‹. Hall geht hier auch auf den Einfluss der konkurrierenden liberalen, pluralistischen und marxistischen staatstheoretischen Ansätze ein, deren Entwicklungs- und Hegemoniefähigkeit sich an den empirisch stattfindenden Veränderungen ›des Staates‹ messen müssten.
Wissenschaftlich fundierte Positionierung und Kritik ist für Hall grundlegend für eine kritisch fortzuschreibende und zu erneuernde Begriffsbildung, aber auch für ein kritisch-eingreifendes gesellschaftspolitisches Engagement. Stuart Hall nutzt 1980 eine Rezension von Nicos Poulantzas’ Buch Staatstheorie, um dessen kritisch erneuerte Positionierungen in der Auseinandersetzung mit anderen theoretischen Ansätzen, mit historischen Materialanalysen und mit empirischen Untersuchungen sich verändernder Staatsformen zu prüfen. Hall würdigt die neuen Dimensionen in Poulantzas’ Begriffsbildung, die dieser aus der Auseinandersetzung mit Michel Foucault erarbeitet habe, kritisiert aber auch, dass er die theoretischen Probleme und Widersprüche, die sich aus der Kreuzung divergenter Theorieströmungen ergeben, nicht offen dargelegt und diskutiert habe. – In Die Bedeutung des autoritären Populismus für den Thatcherismus (1985) stellt sich Hall selbst der Kritik, und zwar jener, die Bob Jessop u. a. an seiner Begriffsbesetzung von ›autoritärer Populismus‹ geäußert haben. Hall nimmt diese Kritik an und nutzt sie offen, um seine Prämissen zu überdenken, seine politische Haltung zu reflektieren und neue Erkenntnisse für eine fortzuschreibende Begriffsbildung aufzunehmen. Er weist die Kritik aber auch zurück, indem er darlegt, dass einige wesentliche Argumente von Jessop u. a. theoretisch verkürzt, verfehlt oder überbewertet sind, was Hall dazu veranlasst, seine eigenen ideologie- und hegemonietheoretischen Argumentationen zum ›autoritären Populismus‹ bekräftigend darzulegen.
In dem Interview »Jeder muss ein bisschen aussehen wie ein Amerikaner« greift Stuart Hall sein zentrales Anliegen der Theoretisierung und Politisierung des Kulturellen wieder auf und äußert sich zur Bedeutung des Kulturellen fürs Verstehen der Gesellschaft (2007): Eine Analyse historischer und umbrechender ökonomischer und politischer Verhältnisse und der entsprechenden Veränderung der Haltungen und Praxen gesellschaftlicher Akteure ist ohne Einbeziehung des Kulturellen nicht zu denken, ebensowenig die Formulierung menschenwürdiger Lebensperspektiven und demokratischer Gestaltungsverhältnisse, die Gerechtigkeit und Diversität zusammendenken. Hall hebt insbesondere die Bedeutung des Imaginären für das Verstehen des subjektiven Alltagsverstandes und kollektiver Handlungsbegründungen heraus; und diskutiert die für ihn bedeutende Verknüpfung von Kultur bzw. von Cultural Studies und politischer Sujektivität, die durch den neoliberalen Konsumismus umgeformt, gar zersetzt werde.
Wir danken allen Übersetzerinnen und Übersetzern für ihre Beiträge, ohne die das Buch nicht zustande gekommen wäre. Für ihre Unterstützung bei der Planung und Umsetzung des fünften Bandes der Ausgewählten Schriften von Stuart Hall danken wir Thomas Barfuss und Ines Langemeyer.
Hamburg, Tampere und Wien, November 2013
Die Herausgeber
Der strittige Staat
Der Staat ist eine historische Erscheinung: er ist ein Produkt gesellschaftlicher Vereinigung – von Frauen und Männern, die in organisierter Weise zusammenleben; der Staat ist kein natürliches Produkt. Es gab Zeiten, in denen ›der Staat‹ – so wie wir ihn kennen – nicht existierte. Clans und Sippschaften der Frühgeschichte, semi-nomadische Völker oder sesshafte Stämme mit sehr einfachen Formen sozialer Organisation, sie alle bildeten das heraus, was wir heute Gesellschaft nennen – ohne einen Staat zu besitzen. Hieraus muss noch lange nicht geschlussfolgert werden, dass sie führerlos sind oder dass es ihnen an geregelten Verfahren der Auseinandersetzung mangelt. Ordnung und soziale Kontrolle lassen sich durch viele andere Mittel und Möglichkeiten aufrechterhalten als durch eine zentralisierte Autorität oder einen Regierungsapparat. Gewohnheit und Brauch können die gleiche zwingende Macht über menschliches Verhalten erlangen wie das kodifizierte Recht. In einigen staatenlosen Gesellschaften nimmt der Vorstand des Haushaltes oder nehmen Anführer von Abstammungsgruppen die Funktion von Regelungsverfahren ein, ohne die Grundlage einer dauerhaften Herrschaftsordnung herauszubilden.
Diesen Kontrast mit ›staatenlosen Gesellschaften‹ zu bilden hilft uns festzulegen, was der Staat ist. Simon Roberts (1981) definiert den Staat folgendermaßen: »eine höchste Autorität […], die über ein bestimmtes Territorium herrscht; die anerkanntermaßen die Macht hat, Entscheide zu fällen, die ihre Herrschaft betreffen […], die ferner in der Lage ist, ihre Entscheide durchzusetzen und überhaupt die Ordnung im Staate aufrechtzuerhalten.« Demnach ist die Fähigkeit zum Ausüben von Zwangsgewalt ein entscheidendes Element: »Die elementarste Prüfung der Autorität eines Herrschers entscheidet sich mit der Frage, ob er Gewalt hat über Leben und Tod seiner Untergebenen.« (145f.) Dies definiert Staatsgewalt als einen rechtmäßigen Anspruch des Staates auf Gehorsam seiner Untertanen. Alle Staaten hängen von diesem besonderen Verhältnis zwischen Herrschaft und Unterwerfung ab. Herrschaft wird als die Macht verstanden, Entscheidungen über die ›grundsätzlichen Regeln‹ für die ganze Gruppe zu treffen. Zu prüfen ist, innerhalb welcher Grenzen und mittels welcher Personen der Staat seinen Rechtswillen durchsetzen kann. Innerhalb dieser Grenzen ist der Staat die höchste Autorität.
Früh-Geschichten des modernen Staates
Der Staat ist in einem weiteren Sinne historisch: er verändert sich im Laufe der Zeit und im Verhältnis zu spezifischen Bedingungen und Umständen. Seit der Antike existierte in Westeuropa eine organisierte öffentliche Gewalt, die Autorität beanspruchte und kontinuierlich als legitime Herrschaft agierte; obwohl der heutige Begriff ›Staat‹ lange Zeit mit seiner üblichen modernen Bedeutung gar nicht gebraucht wurde.
Aus den Clans und Stämmen der frühen griechischen Zivilisation heraus erschien eine überraschend ›fortschrittliche‹ Form des Staates – der Stadt-Staat oder die polis. Dies gab uns die Saat für zwei mächtige Begriffe, die mit dem modernen Staat verbunden sind: ›Demokratie‹ von demos, die Herrschaft des Volkes oder der Bürgerschaft; und polis, die Wurzel der Wörter wie z. B. ›politisch‹ oder ›Politik‹. Das antike Griechenland stellte auch zwei wesentliche Überlegungen zu Regierung und Herrschaft bereit, die weitgehend als Gründungstexte der politischen Philosophie in Europa angesehen werden: Platons Der Staat und Aristoteles’ Politik.
Die Periode der hellenischen Stadt-Staaten dauerte ungefähr von 800 bis 500 vor Christus. Die frühen ›Tyrannen‹ brachen die Macht des Landadels über die Regierung der Städte, und nahezu die ganze Bürgerschaft, einschließlich der Klein- und mittelgroßen Bauern, erhielt Rechte. In der polis gehörten alle Bürger der Volksversammlung an, konnten wählen und direkt an der Regierung partizipieren: eine ›direkte Demokratie‹, manchmal bis zu 5000 – 6000 Bürger umfassend, mit einer wenig eingreifenden Verwaltung oder Bürokratie. Allerdings hatte die große Zahl der Sklaven, die die Basis der athenischen Demokratie ausmachten, weder Rechte noch den Status eines Staatsbürgers.
Später wurden die Stadt-Staaten durch das athenische und andere Imperien absorbiert, die in der Folge von territorialer Eroberung expandierten. Diese Expansion stellte die griechische Demokratie ernsthaft auf den Prüfstand. Es erwies sich als schwierig, das ortsgebundene Konzept von Bürgerschaft auf die anderen 150 Städte auszudehnen, die das athenische Imperium verschlang. Nach Alexander dem Großen wurde die Herrschaft eines alleinigen Machthabers mit einer königlichen Thronfolge eingeführt. Der königliche Regent wurde mit einem göttlichen Status gekrönt und seine eigene Person zu einem ›Gott‹ erhöht.
Auch Rom entstand aus einem mächtigen Stadt-Staat. Anders als sein griechisches Gegenstück wurde Rom nie ›demokratisiert‹. Die Römische Republik (vom lateinischen res publica; ›die zur öffentlichen Sphäre gehörenden Dinge‹: ein Begriff, der oft gebraucht wird, um das zu bezeichnen, was wir heute ›den Staat‹ nennen) basierte auf einem Senat, der von aristokratischen Mächten dominiert wurde. Später wurde seine Basis erweitert: durch Volksversammlungen gewählte Konsuln wurden eingebunden. Römische Bürgerschaft wurde eher durch das Recht bestimmt und weniger durch strikte Territorialität. Weil es keine ›direkte Demokratie‹ war, war es einfacher, die römische Bürgerschaft um die herrschenden Klassen anderer Städte und Territorien zu erweitern, die von den Römern erobert wurden. ›Civis Romanus sum‹: ein römischer Bürger war ein Staatsbürger, der irgendwo und überall war.
Die soziale Basis der römischen Zivilisation war die grundbesitzende Klasse; das Land wurde von einer abhängigen und verschuldeten Bauernschaft bearbeitet, später ergänzt durch Sklavenarbeit. Die ländliche Gegend wurde zunehmend von Kleinbauern besiedelt, frei im Status, aber ›besitzlos‹. Die Unterklasse der Städte waren die ›proletarii‹ (Herkunft des Begriffs ›Proletariat‹). Das Ausmaß der Land-Transaktionen, der Handelsregulierung und der Vererbung von Privateigentum, die Definition von Staatsbürgerschaft und die Herausbildung von Unterschieden zwischen der öffentlichen Rolle der Grundeigentümer als Bürger und ihrer ›privaten‹ Rolle als Vorstand der Familienhaushalte – pater familias – führten zu einem weiteren wichtigen Beitrag Roms zum europäischen Staat: ein systematisierter Kodex des ›Römischen Rechts‹. Römisches Recht half die Unterscheidung zwischen ›Staat‹ und ›Gesellschaft‹ zu begründen, oder zwischen dem Öffentlichen (dem Staat und öffentlichen Angelegenheiten zugehörig) und dem Privaten (den Beziehungen privater Vereinigungen, der ›Zivilgesellschaft‹ und dem häuslichen Leben der patriarchalen Familie zugehörig).
Innere Spannungen entstanden aufgrund der ungleichen Verteilung von Land, der Forderungen der ›Landlosen‹ und der Sklavenaufstände, auch aufgrund der Probleme, die weit zerstreuten, von der römischen Armee eroberten Provinzen innerhalb eines vereinten Staates besetzt zu halten, sowie der Herausforderungen an die senatorische Macht – all dies trieb Rom zu einer zentralistischeren Herrschaftsform. Unter Augustus bildete sich das römische Kaisertum als neues System heraus. Trotzdem lehnte sich der römische Staat noch an ein System des Bürgerlichen Rechts an, und es wurde weiterhin erwogen, die Gesetze in unbestimmter Weise vom ›Volk‹ herzuleiten – aber nicht im Sinne eines souveränen ›Volkswillens‹, wie wir ihn aus heutigen modernen Demokratien kennen.
Dieser Ansatz, dass Staatsmacht sich aus dem Recht ableitet, war entscheidend für die nachfolgende Entwicklung des ›Rechtsstaatsprinzips‹ und des ›Verfassungsstaates‹. In der Ära der Republik formulierte Cicero die Grundlinie des senatorischen Regimes wie folgt: »Wir gehorchen den Gesetzen, um frei zu sein.« Im spätrömischen Imperium, als die Kaiser volle despotische Herrschaft ausübten und göttlichen Status einnahmen, erfolgte eine signifikante Verschiebung, die im 3. Jahrhundert von dem Philosophen Ulpian formuliert wurde: »Der Wille des Herrschers hat Gesetzeskraft.« Dennoch sollte das Recht weiterhin ein wichtiges Ideal der Herrschaft und des Staates darstellen.
Als die imperialen Grenzen des Römischen Reiches erreicht und geschlossen waren und die begrenzten Möglichkeiten für ökonomisches Wachstum auf der Grundlage der Sklaverei evident wurden, wurde Rom allmählich geschwächt: durch ›Verwässerung‹, da der ›Osten‹ des Reiches auf Kosten des mediterranen ›Westens‹ wuchs; durch Unruhen auf dem Lande und Aufstände der Sklaven; letztlich auch durch barbarische Invasionen aus dem Norden. Das späte Rom bereitete den Weg für ein neues Arbeits-Regime auf Grundlage der großen Grundbesitze: ›Freie Pächter‹ standen unter der direkten Herrschaft der großen agrarischen Grundherren; das Bauerntum (coloni) war an ein Pachtverhältnis mit dem Gutsbesitzer gebunden und zahlte ›Abgaben‹ in Form von Zins und Arbeitskraft. Dieses Element wurde später in den Feudalismus aufgenommen.
Als die Römer gen Norden voranschritten, trafen sie auf die sehr verschiedenen Regierungssysteme, die die germanischen Stämme organisierten. Diese wanderten ins äußere Hinterland des Römischen Reiches ein, siedelten an dessen Grenzen und bildeten möglicherweise einen Teil der barbarischen ›Horden‹, die Rom plünderten und es ins frühe Mittelalter trieben. Die germanischen Völker bestanden im Wesentlichen aus Sippen, d. h. aus großen, verwandtschaftlich organisierten Verbänden, die ihre Mitgliedschaft oft entlang der Verwandtschaftslinie der Mütter bestimmten. Sie besaßen und bearbeiteten das Land gemeinsam, mit wenig privatem Eigentum: eine kommunale oder ›primitiv kommunistische‹ Produktionsweise. Im Vergleich zu Griechenland oder Rom wurden sie eher lose durch aristokratisch besetzte Räte regiert. Ihnen untergeordnet waren mächtige Versammlungen freier Krieger und ihnen wiederum unterstand das Gefolge von Soldaten-Banden, oft mit eigenen ›Chefs‹. Diese Siedler- wie auch ›Krieger-Gemeinschaften‹ mit ihren Bindungen, die auf persönlicher Loyalität wie auch auf ausgeprägter Kriegs- und Schutzbereitschaft bestanden, trugen ein zweites wesentliches Element zum Feudalismus bei: die germanischen Siedlungen legten auffällig viel Wert auf Volksversammlungen. Sie praktizierten auch eine andere Rechtsform. Im Gegensatz zur Formalität des römischen Rechts wurde das germanische Recht sozusagen ›vom Volk‹ gesprochen, auf Grundlage ihres tradierten ›Volkstums‹ und der Summe der gemeinschaftlichen Bräuche. Auf diese Wurzeln lassen sich die ›Parlamente‹ der Engländer und das englische Gewohnheitsrecht (common law) zurückführen.
Feudale Staaten
Der europäische Feudalismus nahm eine Vielzahl von Formen an. Es ist hier nur möglich, die wesentlichen Verhältnisse und ihre Konsequenzen für die Staatsbildung darzustellen, die sich in Europa gegen 800 n. Chr. ausprägten (die Zeit der Krönung Karls des Großen, des Frankenkönigs, zum Kaiser durch den Papst). In diese Zeit fällt das Bemühen, das Römische Imperium – lange schon im ernstlichen Verfall – unter dem Patronat der katholischen Kirche zu erneuern. Dafür sollten die zersplitterten Staaten des westlichen Christentums in einem neuen Heiligen Römischen Reich vereint und zentralisiert werden. Diese Länder und Königreiche, die sich von Spanien bis Deutschland, von Nordfrankreich bis Italien erstreckten, standen unter der Herrschaft verschiedener Grafen, Herzöge und Prinzen, die dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Gefolgschaft schuldeten. Dieses Bestreben, ein politisch einheitliches christliches Imperium zu schaffen, wurde durch die ihm zugrunde liegenden gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse ausgeglichen.
Unter diesen sozio-ökonomischen Bedingungen sprach der Herrscher oder der Lord seinen ihm ergebenen Vasallen Nutz- und Landrechte (›benefices‹) zu, gegen Rückzahlungen in Gold und in der Hoffnung auf fortdauernde Militärdienste. Es gab ebenso ein germanisches ›Vasallen‹-System, in dem führende Krieger sich an ihren Lord banden und ihm im Gegenzug für seinen Schutz ihre persönliche Loyalität und Huldigungen bekundeten. Feudalismus bildete sich aus der Verschmelzung oder Synthese dieser beiden Elemente heraus. Aus den Ländereien wurden ›Lehensgüter‹: begrenzte Lehen wurden als Gegenleistung z. B. für Militärdienste überlassen. Der Lord der Vasallen beutete diese Lehen ökonomisch mittels der Arbeit unfreier Bauern aus, die wiederum ans Land gebunden waren; die Bauern waren gezwungen, im Austausch für Schutz ihre Arbeitsdienste zu leisten und ihre Pacht und Abgaben in Form von Geld und Arbeitskraft zu zahlen.
Diese Kette gegenseitiger Verpflichtung war außerordentlich lang, weil der Lord der einen selbst Vasall eines anderen mächtigeren Feudalherren und dieser wiederum Vasall eines Adligen, eines Herzogs oder eines Königs sein konnte. Die breite Bevölkerung an der Basis, auf der die ganze Pyramide fußte, ist »Objekt der Herrschaft […], aber nicht Subjekt eines politischen Verhältnisses« (Poggi 1978: 23). Das Verhältnis zwischen Herrscher und Leibeigenen war die Kernform der feudalen Ökonomie, das Verhältnis zwischen Herrscher und Vasallen war die Kernform der politischen Herrschaft.
Dieses ausgedehnte Netzwerk aus ineinander verschränkten Verbindungen und Verpflichtungen produzierte eine unvermeidliche »Fragmentierung eines jeden großen Systems der Herrschaft in kleinere, zunehmend autonome Systeme« (27). Macht wurde personengebundener und lokaler. In jedem Bereich ergaben sich konfligierende Systeme der Loyalität – eine »soziale Welt von sich überschneidenden Ansprüchen und Gewalten« (Anderson 1978: 178), auch als ›feudale Anarchie‹ bezeichnet.
Grundsätzlich (und mit einigen wichtigen Ausnahmen, in Nordfrankreich und in England, wo die Monarchie zu einer stärkeren und einheitlicheren Form neigte) war der klassische feudale Monarch von unterschiedlichem Stand als seine Lords – primus inter pares. Obwohl ›von Gott gesalbt‹, war er aufgrund des göttlichen Status nicht von ihnen losgelöst, sondern durch reziproke Verpflichtungen an sie gebunden. Die mächtigsten Lords konstituierten eine wirkliche Quelle alternativer Macht, mit der ein feudaler Monarch stets rechnen musste und die er daher regelmäßig konsultierte, da er ohne sie weder Steuern erheben noch eine Armee aufstellen konnte. Sie wurden zu seinen Beratern, zu seinem Gerichtshof und zu seiner Ratsversammlung. Einige Herrscher mussten eine formale Einwilligung ihrer Volksversammlungen einholen, um Steuern zu erheben. Dies waren in der Tat frühe Formen des ›Parlaments‹, die ab dem 13. Jahrhundert eine zunehmend wichtige Rolle spielen sollten.