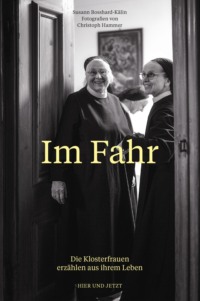Kitabı oku: «Im Fahr», sayfa 2

Schwester Beatrice
«Wer wird einmal das Kloster übernehmen? Den Ruf des Herrn hören nur wenige in dieser lauten Welt.»
geboren am 17. Dezember 1947 als Beatrix Agnes Beerli aus Steckborn (TG)

Das Klosterareal mit den grossen Gärten ist weitläufig. So ist Schwester Beatrice oft mit dem Fahrrad unterwegs. Sie sorgt für die kleine Schafherde.



Bei der Weinlese und im Klostergarten vor der Pforte. Hier hat sie die Schülerinnen der Bäuerinnenschule in Gartenpflege ausgebildet. Sie kennt sich hervorragend aus mit Heilkräutern, Gemüse und Blumen.
Der Garten ist mein Paradies. Da spüre ich Luft, Atem und Wind – Zeichen des Heiligen Geists. Der ist mir seit 48 Jahren ein wichtiger Begleiter im Klosterleben. Wo ist er, frage ich mich, wenn es stürmt und ich im Propsteigarten den Boden lockere?
Zusammen mit Schwester Christa bin ich für unsere Klostergärten verantwortlich. Schwester Christa besorgt die Blumen, ich vor allem das Gemüse. Wir sind beide siebzig, nicht mehr die Jüngsten. Glücklicherweise packt Schwester Monika mit an, und dazu immer wieder Frauen von aussen, die tage- oder auch wochenweise Praktika bei uns im Garten und in den Reben machen. Diese externe Hilfe ist grossartig. Dennoch plagt mich ab und zu der Gedanke: Wer übernimmt, wenn wir nicht mehr können? Unsere Gärten sind seit Jahrhunderten wichtiger Bestandteil des Klosters, sie haben auch schon Anerkennungspreise erhalten. Aber sie sind aufwendig zu pflegen. Ich überlege mir, was ich tun werde, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr im Garten sein kann. Im Haus wäre es mir vermutlich langweilig und in der Küche zu streng. Dann verscheuche ich diese pessimistischen Gedanken schnell wieder und erfreue mich am Jetzt. Der Garten ist Medizin für mich. Ich habe grosse Freiheiten, niemand sagt mir: Das darfst du oder das darfst du nicht. Hier kann ich arbeiten, beten und meditieren.
Ich bin jeden Tag draussen. Auch im Winter, wegen des Nüsslisalats im Tunnel und meiner neun Schafe. Nie hätte ich es mir erträumt, mal Schafe zu pflegen – als Klosterfrau! Wir brauchten «biologische Rasenmäher», da der Garten mit fünfzig Aren zu gross wurde. Wo früher Stangenbohnen, Zwiebeln und Kohl in grossen Mengen wuchsen, säten wir Wiese. Dort weiden nun seit 1998 Schafe. Mir wurden sie anvertraut. Heute habe ich eine kleine Herde. Sie sind meine Freundinnen. Wenn ich «Lump!» rufe, strecken alle neun Tiere ihren Kopf, kommen zu mir und wollen gestreichelt werden. Im Sommer leben sie im Freilaufstall im Garten. Wenn ich abends den Zaun kontrolliere, spazieren sie mit. Sie wissen, ich habe immer ein Stückchen Brot im Sack oder einen Apfel. Solange der Wolf nicht kommt, bin ich zufrieden. Im Winter sind meine Tiere im Klosterstall, neben den Kühen, Säuen und Kaninchen. Bei gutem Wetter dürfen sie auf die Wiesen rund ums Kloster. Tiere gehören einfach ins Fahr, und die kleinen und grossen Besucher haben grosse Freude an ihnen. Das höre ich immer wieder.
Mein Gartenjahr hat über 300 Tage. Im Dezember und Januar ists etwas ruhiger, dann habe ich Zeit für die Sommerplanung und Samenbestellungen. Aber ab Februar geht es im Treibhaus schon wieder los mit Aussäen und Setzen. Dabei richte ich mich nach den Mondphasen, und selbstverständlich kombiniere ich nützliche Mikroorganismen. Wir gärtnern biologisch und in Mischkulturen. Die Beeren, Salate, Gemüse und auch die Kräuter sind fürs Restaurant und für uns. Den Blumenkohl setze ich im Propsteigarten zwischen Ringel- und Sonnenblumen sowie Salvia. Bohnen, Sellerie und Randen wachsen nebeneinander, ebenso Karotten, Zwiebeln und Lauch. Es darf im Beet ungeniert turbulent und bunt sein, Wirrwarr tut den Pflanzen gut. Gegen vieles ist ein Kraut gewachsen, davon bin ich überzeugt. Mein liebstes ist Rosmarin. Auf der grossen Kräuterspirale wachsen ausserdem Dill, Minze, Liebstöckel, Fenchel, Malve, Petersilie, Schnittlauch, Eisenkraut, Kapuziner und Ringelblumen, Thymian und Majoran, ungefähr zwanzig verschiedene Kräuter. Von Mai bis Oktober biete ich Gartenführungen für Interessierte an. «Hereinspaziert in den Fahrer Klostergarten», heisst es dann, und es darf an den Pflanzen gerochen oder ein Kraut probiert werden. Die Leute mögen diese begleiteten Führungen und lassen sich inspirieren. Das Tor zum Propsteigarten steht immer offen. Das ist mir wichtig. Menschen sollen dort Kraft schöpfen dürfen. Ist es nicht eine Armut, wenn Eltern mit ihren Kindern nur noch im Grossverteiler einkaufen und die Kleinen keine Ahnung mehr haben, wie und wo etwas wächst?
Mein Klosteralltag ist dicht und vielfältig. Ich stehe um fünf Uhr auf. Zwanzig Minuten später bete und singe ich mit der Gemeinschaft das erste → Chorgebet in der Klosterkirche. Der Rhythmus von Arbeit und Gebet – Ora et labora – gefällt mir, und er hält mich gesund. Mit dem Älterwerden schätze ich diesen Rhythmus immer mehr. Ich bin ja in erster Linie Benediktinerin und nicht Klostergärtnerin.
Die Arbeitszeiten sind jeweils kurz, ich muss speditiv sein und gut planen. Vier-, fünfmal täglich von draussen ins Kloster und zurück, nicht selten verschwitzt, regennass und dreckig, dann Händewaschen und Tenuewechsel – das ist nicht ohne! Aber ich habe gelernt, fix und flexibel zu sein. Neben dem Klosteralltag gibt mir die Natur den Fahrplan vor, und ich muss mich nach ihr richten. Wenn für den nächsten Tag Regen angesagt ist, gilts noch, vorher den Boden zu lockern. Wenn Setzlinge pikiert werden müssen, dann kann man damit nicht ewig warten, und bei Sommerhitze muss entsprechend oft und gezielt gewässert werden. Um Viertel vor neun Uhr bin ich im Garten, und schon zwei Stunden später heisst es, alles Werkzeug aus der Hand legen, husch, husch, Hände waschen und umziehen fürs Mittagsgebet und das Mittagessen, hopp! Meist bin ich nach ein Uhr wieder draussen, bis kurz vor drei. Und nach dem Zvieri und der geistlichen Lesung ab vier bis zur → Vesper um Viertel vor sechs. Nach der → Komplet um acht gehe ich oft ein letztes Mal in den Garten und schaue zu den Schafen. Wir Schwestern sind wohl alle fleissig und können die Ärmel hochkrempeln – damals wie heute. Wir kommen aus ähnlichen familiären Verhältnissen und sind das Werken gewohnt. Arbeit ist doch auch eine Art Gottesdienst, nicht?
Ich mag es, Neues auszuprobieren. So ging ich auf eine Anfrage ein und betreibe nun in Uitikon zweimal im Jahr einen kleinen Marktstand. Dort verkaufe ich im Frühling meine Setzlinge und eigens gemachtes Kräutersalz, im Herbst Gemüse und meine Wallwurzsalbe. Die Döschen sind jeweils im Nu weg.
Mir ist nie etwas zu viel. Diese Haltung lernte ich schon daheim. Wir waren eine fleissige und sozial denkende Familie, hatten immer ein offenes Haus und oft Gäste mit am Tisch. Am 17. Dezember 1947 kam ich in Hörhausen, auf dem Seerücken im Thurgau, zur Welt. Ich bin das vierte von sechs Kindern. Mit drei Brüdern und zwei Schwestern bin ich aufgewachsen. Ein Bruder starb mit zweieinhalb Jahren. Meine Eltern bewirtschafteten einen grossen und gepflegten Hof. Ich half Vater viel, war ein gesundes, kräftiges Kind und am liebsten draussen. Früh lernte ich melken, die Pferde führen und die Landmaschine, den Rapid, fahren. Ich mochte alles – ausser Stricken. Meine Mutter bedauerte das, sie schämte sich wohl für mich, wenn sie als Schulpflegerin meinen Handarbeitsunterricht besuchte und sah, wie ich mich mit einer halb fertigen Socke herumquälte!
Nach der Primarschule schickten mich meine Eltern ins Internat nach Flüeli-Ranft in Obwalden. Es hiess, mein Lehrer hätte mich nicht ernst genommen. Wer wusste schon, was das bedeutete! Und so kam ich für die siebte und achte Klasse zu Dorothea-Schwestern. Dort plagte mich oft Heimweh. Glücklicherweise besass eine der Schwestern einen Hund, mit dem ich laufen gehen durfte, und auch die Gartenarbeit half mir über die Trauer hinweg. Durch die halbe Schweiz, über Luzern, Zürich und Frauenfeld reiste ich in die Ferien. So lernte ich die Schweiz kennen. Noch heute ist Zugfahren ein grosser Spass für mich.
Anschliessend wollte ich Französisch lernen und wurde im kalten Winter 1963 Volontärin im Institut Guglera der Ingenbohler Schwestern im Freiburgischen. Meine Eltern hatten während dieser Zeit einen Grippevirus, und ich fürchtete, Mutti könnte sterben. So machte ich mich eines Tages klammheimlich davon. Zu Fuss lief ich im Schneesturm Richtung Tafers und nahm den erstbesten Zug in die Deutschschweiz. Zu Hause waren sie gar nicht erfreut, mich zu sehen. Ich musste auf dem Absatz kehrtmachen und zurück ins Internat, wo ich ins Verhör genommen wurde. Im Rückblick weiss ich: Fremdes Brot essen tat mir gut, aber Französisch lernte ich wenig mit all den Deutschschweizerinnen, die mit mir in der Küche, in der Wäscherei und im Garten arbeiteten.
Damals war es in unseren bäuerlichen Kreisen beliebt, die Bäuerinnenschule im Kloster Fahr zu absolvieren. Die Schule hatte einen guten Ruf, und Mutter meinte, sie wäre das Richtige für mich. Ich wäre gerne Gärtnerin geworden, aber ich scheute mich vor der langen Lehrzeit. Warum also nicht für zwanzig Wochen ins Fahr? Mein erster Eindruck des Klosters, als ich zu Fuss von Schlieren mit dem Koffer einrückte: Es wirkte kalt, sah aus wie eine Kaserne, und es hatte nicht mal Vorhänge vor den Fenstern! Bald wurde ich eines Besseren belehrt. Das Leben an der Bäuerinnenschule und die klösterliche Atmosphäre gefielen mir ausgezeichnet.
Am 19. November 1965, während des Ausbildungsgangs, feierte Priorin Elisabeth ihren Namenstag. Uns wurde eine Überraschung angekündigt, und so gab es ein grosses Hallo, als die Schwestern mit einem neuen Schleier auftraten. Bis jetzt waren sie bis auf die Wangen und Augen total verhüllt gewesen. Jetzt sah man plötzlich ein Gesicht. Mit Nina Felder aus Solothurn besuchte die tausendste Schülerin der Bäuerinnenschule unseren Kurs. Bis zur Schliessung der Schule im Jahr 2013 sollten es dann über 4000 Frauen sein, die in fast siebzig Jahren im Fahr die bäuerlich-hauswirtschaftliche Ausbildung absolvierten.
Nach der Bäuerinnenschule wurde ich für kürzere oder längere Einsätze als Familienhelferin gerufen – auch zu einer Familie in Weiningen. Während dieser Zeit schlief ich im Fahr und spürte zunehmend eine Verbindung zum Kloster. Ich fühlte mich an diesem stillen Ort irgendwie gestärkt. Und ich begann mit mir zu ringen: Bäuerin – Gärtnerin – Klosterfrau? Was sollte wohl aus mir werden? Es waren schwierige Monate. Der älteste Bruder hatte Theologie studiert. Meine Eltern stellten sich vor, er würde Priester und ich Bäuerin werden. Aber es sollte anders kommen. Kurz vor der Priesterweihe lernte er seine spätere Ehefrau kennen. Er heiratete, studierte Psychologie und wurde Betriebspsychologe und Berufsberater. Und ich? Es war an Ostern 1969, als ich mit einer Kollegin im Dorf in die Frühmesse ging. Der Pfarrer zitierte aus dem Evangelium: Wenn du meine Stimme hörst, so folge mir! Dieser Satz schlug ein wie ein Blitz, und ich wusste von einer Sekunde zur anderen: Ich will ins Fahr. Es war ein Ruf an mich. Anders kann ich das nicht beschreiben.
Meinen 22. Geburtstag feierte ich als Kandidatin im Kloster Fahr. Am Gertrudstag, dem 17. November 1969, trat ich ein. Mein Radio und eine Truhe aus Birnbaum, die Vater für jede Tochter zur Aussteuer herstellen liess, musste ich zu Hause lassen und natürlich meine liebe Familie. Ich wusste, ich würde nie mehr heimdürfen.
Ich arbeitete während des Noviziats und auch später während der Sommermonate vor allem auf dem Feld. Im Winter strich ich zusammen mit anderen Schwestern unzählige Wände in den Gängen, laugte Dutzende Fensterläden ab und versah sie mit einem neuen Anstrich. Ich galt als Allrounderin im Kloster.
1986 wurde ich von der damaligen Priorin Raphaela ins Benediktinerinnenkloster Müstair «ausgeliehen». Der kleinen Gemeinschaft fehlte es an Unterstützung, weil eine der dortigen Schwestern ins Spital musste. Ob ich bereit wäre, der Gemeinschaft ein paar Wochen unter die Arme zu greifen? Erst war ich geschockt, brauchte Bedenkzeit und wollte nicht alleine hin. Aber ich überwand meine Bedenken und sagte zu. Eine Woche später fuhr ich mit dem Führerschein, den ich habe, seit ich 18 Jahre alt war, und Pater Benedikts Auto über den Ofenpass ins Münstertal. Es gefiel mir dort von Beginn an ausgezeichnet, nicht nur im Kloster, sondern auch auf dem klösterlichen Maiensäss und der hoch gelegenen Alp. Es war eine herrliche Natur. Dort oben kam ich mir vor wie Heidi. Im Laufe der Wochen wurde ich vor allem für Arbeiten im Biogarten eingesetzt, die Liebe zum Boden wuchs noch mehr, und ich lernte viel. Es sollte nicht bei diesem einen Einsatz bleiben. Bis im Sommer 1995 lebte und arbeitete ich jedes Jahr jeweils von Mai bis Oktober in Müstair.
Dann hiess es plötzlich, ich müsse mit dem Frühlingskurs 1996 den Gartenunterricht an der Bäuerinnenschule übernehmen. Eine richtige Gärtnerinnenausbildung hatte ich nie gemacht. Ich war über die Jahre Schritt für Schritt und mit viel Praxis ins Metier hineingewachsen. Ohne Ausbildung als Lehrerin an der Bäuerinnenschule? Das hatte ich einfach anzunehmen. Gehorsam. Punkt. Priorin Irene war damals Leiterin der Schule und schickte mich als Vorbereitung für den Grundlagenunterricht im Winter in den Biogartenbaukurs an der Haushaltsschule in Wipkingen. Frau Verena Burghold, die Dozentin, war extrem hilfsbereit und versorgte mich mit viel Fachwissen. Von Beginn an liefs gut an der Bäuerinnenschule. Den Frauen wurde offen kommuniziert, ich würde als Einsteigerin zu ihnen kommen. Sie waren verständnisvoll und verziehen mir allfällige Patzer. Trotzdem war der Einstieg für mich damals hart. Ich erinnere mich gut, den Winterkurs 1996/97 besuchten 36 Frauen – es war eine Herausforderung, in drei Gruppen praktischen Unterricht im Treibhaus zu halten. Ich hatte ja null didaktische Erfahrung. Die besonnenen Frauen und die Hilfe von Schwester Gertrud, deren Posten ich übernommen hatte, machten mir Mut. Später durfte ich an der EB in Zürich eine Weiterbildung in Didaktik und Methodik besuchen.
Der Spagat zwischen Schule und Kloster machte mir hie und da zu schaffen. Das waren zwei Welten – unten die offene, mit vielen jungen Frauen, und oben die klausurierte, streng geregelte. Aber ich sehe es heute als grosses Plus, dass wir Schwestern diese Schule führten. Ich glaube, nicht zuletzt deshalb sind wir so weltoffen. Im Lauf von fast zwanzig Jahren durfte ich die Freude einiger Hundert Frauen für den Garten wecken. Ich hatte immer einen guten Draht zu den Schülerinnen – und noch heute kommen mich Ehemalige besuchen. Viele von ihnen sind begeisterte Gärtnerinnen. Ehrlich gesagt, es tat mir weh, als wir die Schule schliessen mussten.
Jede von uns ist ein Teil des Klosterpuzzles, steht an einem anderen Ort und gehört doch zur Gemeinschaft. Wir gehen gut miteinander um, respektvoll. Das ist entscheidend. Wir haben einander ja nicht ausgewählt. Und ich glaube, je älter wir werden, umso wichtiger ist der gegenseitige Respekt. Wir sind natürlich nicht immer gleicher Meinung. Aber wir dürfen unsere Meinung heute äussern. Früher mussten wir einfach nicken – man ging gebeugten Hauptes durchs Leben. Heute dürfen wir es sagen, wenn uns etwas bedrückt.
Ich kann mich gut anpassen und finde schnell Kontakt zu den Menschen. Ich bin eine aufgestellte Person, und wenn es mir gut geht, bin ich motiviert. Bei Stress, wenn es zum Beispiel mit meiner Arbeit nicht wie geplant läuft, kann ich aber schon mal explodieren. Ans Austreten dachte ich nie wirklich. Ich stellte den Entscheid fürs Fahr nie grundsätzlich infrage. Aber es gab Zeiten, in denen ich ungeduldig mit mir war. Doch wohin hätte ich gehen sollen? Möglichkeiten des Rückzugs im Kloster selbst gibt es wenige. Die Zelle als Einzelzimmer ist viel wert, und ich kann in den Garten gehen. Wenn ich früher aufgewühlt war oder Abstand brauchte, stieg ich in den Estrich hinauf, wo mich niemand hören konnte, und rief laut aus. Meine Explosivität ist vielleicht eine Schwäche. Es kann vorkommen, dass es in mir drin kocht und ich den Druck am falschen Ort ablasse. Ich spüre es, wenn ich nicht gut atme, dann bin ich überfordert oder übermüdet. Ich mute mir oft viel zu im Garten, und mit dem Älterwerden geht alles nicht mehr so schnell. Dann muss ich mich immer mal wieder disziplinieren und mehr Zeit für die Erholung einrechnen.
Zuletzt habe ich da noch einen Traum: Ich würde liebend gern ein zweites Mal nach Rom reisen. Vor drei Jahren durfte ich mit der ökumenischen Kirchgemeinde Engstringen in meinen Ferien in die Ewige Stadt fliegen – es war der erste Flug meines Lebens, ein unvergessliches Erlebnis, und eine wunderschöne Wallfahrts- und Kulturreise. Papst Franziskus in nur zehn Metern Distanz auf dem Petersplatz begegnen zu dürfen, das war ein besonderes Geschenk für mich. Ich fühle mich ihm sehr verbunden; wir haben am selben Tag Geburtstag!
Wir Schwestern stehen fast alle im Herbst unseres Lebens. Und manchmal mache ich mir schon Sorgen, wie es weitergehen soll bei uns. Auch mit Gottvertrauen ist es nicht so einfach. Wie werden wir die Zukunft bewältigen? Im Moment läuft alles – aber die Situation ist zerbrechlich. Wer wird einmal das Chorgebet übernehmen, das Kloster überhaupt? Wie steht es mit Nachwuchs? Den Ruf des Herrn hören nur wenige in dieser lauten Welt. Sollen wir uns mit der Arbeit stärker zurücknehmen und einen kontemplativen Ort im Kloster schaffen? Fragen über Fragen, die mich beschäftigen. Ich weiss, ich muss lernen, loszulassen und gelassener zu werden. Das ist leichter gesagt als getan. Es gibt ja so viel zu tun jeden Tag.
Eintritt ins Kloster Fahr: 17. November 1969
Einfache Profess: 12. August 1971
Feierliche Profess: 18. September 1974

Schwester Marie-Theres
«Alleinsein zu können, ist entscheidend. Wer viel Gesellschaft braucht, ist bei uns am falschen Platz.»
geboren am 21. Juli 1946 als Theresia Gabriele Koch aus St. Gallen (SG)


Im Refektorium wird der Tisch für das gemeinsame Mittagessen gedeckt (1. Bild). – Schwester Marie-Theres schleudert und füllt den Honig der rund dreissig Bienenvölker ab, die im Klosterinnenhof leben (2. Bild).
Ich bin am Schleudern. 2017 wird als Superjahr in die Klostergeschichte eingehen. Wir kommen nämlich auf 700 Kilogramm Honig. Und der muss sorgfältig von den Waben geschleudert werden. Im und rund ums Bienenhaus arbeite ich seit über 17 Jahren. Anfänglich assistierte ich Schwester Bernadette, die das Imkern von einer Mitschwester erlernt hatte. Heute ist Berta Müller, unsere langjährige Angestellte, der Bienenprofi. Sie stürzte sich kopfüber ins Metier, besuchte Kurse und bildete sich laufend weiter. Sechs Wochen bin ich jährlich für die Bienen auf der Piste. In den nächsten Tagen werden wir die letzten Hundert Kilogramm Honig schleudern. Dann setzen wir das Zuckerwasser für die kleinen Tierchen auf und reinigen alles gründlich. Für die Bienen beginnt ab August die Wintersaison. Was sie jetzt sammeln, lassen wir ihnen als eigenen Vorrat für die kargen Monate.
Fürs Stechen bedanke ich mich jeweils bei den Bienen – ihr Gift beugt Rheuma vor. Man darf natürlich nicht allergisch gegen Bienenstiche sein, sonst kannst du unter Umständen gleich den Schirm zumachen! Bei uns leben aktuell ungefähr dreissig Völker, und unser Honig ist im Klosterladen ein echter Verkaufsschlager.
Mein Leben sehe ich als halb volles Glas, nicht als halb leeres. Seit meiner starken Hörbehinderung und trotz meines gesundheitlichen Zusammenbruchs kann ich noch vieles machen. Ich musste lernen, nicht auf das hinzusteuern, was mir Mühe macht, sondern auf das, was noch gelingt. Mit Schwester Bernadette, die wie ich eine Hörbehinderung hat und zehn Jahre älter ist, verstehe ich mich sehr gut. Sie und ich wissen, dass man sich isoliert, wenn man nicht mehr gut hört; dass Lärm und Geräusche einen irritieren und krank machen. Wir stützen und unterstützen uns gegenseitig. Uns verbindet durch das gemeinsame Schicksal eine schöne Freundschaft. Wir haben einen ähnlichen Humor. Die Gemeinschaft toleriert unsere Freundschaft. Das ist nicht selbstverständlich, und ich schätze es sehr. Wir können beide leider nicht mehr an der → Rekreation teilnehmen. Es ist uns zu laut. Ich höre rechts nichts mehr, und im linken Ohr herrscht Hyperakusis – eine grosse Lärmempfindlichkeit, die auch Gleichgewichtsstörungen mit sich bringt. Mich mit einem Menschen unterhalten geht gut, aber nicht mit mehreren. Das ist Stress pur.
Eine Sklerose zerstörte 1977 in meinem Ohr Amboss, Steigbügel und einen dritten Knochen hinter dem Trommelfell; eine Operation und der Einsatz von künstlichen Gehörknochen wurden nötig. Und vor 13 Jahren, damals war ich 58, erkrankte ich an einer Mittelohrentzündung. Diese Erkrankung, gekoppelt mit einer Grippe und einem Tinnitus, stellte mich komplett auf den Kopf. Die bakterielle Erkrankung verursachte im Hirn eine Veränderung. Es hatte nichts mit meiner Psyche zu tun, dass ich nicht mehr beten konnte und keinen Sinn mehr im Leben sah. Während meines Aufenthalts in der Klinik in Oberwil hatte ich zudem eine Lungenembolie. Und so wurde ich als Notfall ins Kantonsspital Zug eingewiesen. Mein Glück! Innerhalb von einer Woche erholte ich mich fast gänzlich und konnte ins Kloster zurückkehren. Die schwere Hörbehinderung ist allerdings geblieben.
Ich hätte nie gedacht, dass es einem als Menschen so schlecht gehen kann. Aber man weiss nie, was im Leben passiert. Ruhe ist seither für mich entscheidend. An einem regulären Tag im Kloster komme ich gut zurecht. Aber Festtage wie Weihnachten und Ostern sind schlimm: Da herrscht viel Umtrieb, wir können beim Essen reden und singen viel. Dann bleibt mir nichts anderes, als mich zurückzuziehen, zwei, drei Stunden, in die Stille.
Die Schwesterngemeinschaft musste lernen, mich anzunehmen, wie ich bin. Das ist sicher nicht immer einfach. Aber ich schätze ihr Verständnis und ihre Fürsorge sehr.
Heute bin ich die Assistentin von Schwester Monika, arbeite «i. A.», im Auftrag, und helfe ihr mit dem Obst, im Kräutergarten, beim Dörren. Sie kann mich rufen, wenn sie mich braucht. Ich decke auch den Tisch im Konvent für das Mittag- und das Abendessen, benötige dafür jeweils eine halbe bis eine Dreiviertelstunde. Wegen meiner Behinderung leide ich nicht, ich denke, sie muss wohl eine Prüfung sein. Sie wird einen Grund haben. Die Frage nach dem Warum stelle ich mir nie. Aber ich sage dem Herrgott, dass ich hoffe, in meiner Sterbestunde werde das, was ich alles durchgemacht habe, angerechnet. Wer weiss?
Die Sache mit meinem Ohr ist das Schlimmste in meinem Leben. Aber ich nehme alles an, was kommt – auch die Knöchelfraktur am linken Fuss vor einem Jahr. Mit zwei Platten und neun Schrauben im Bein durfte ich nach der Operation für zwei Wochen nach Dussnang in die Rehabilitation. Nicht einen Moment haderte ich. Es war eine gute Zeit dort, ich erholte mich – und musste anschliessend nicht einmal mehr in die Ferien.
Dass ich als Kind scheu war, glaubt mir heute niemand. Aber es war so. Meine Eltern führten das städtische Bürgerheim. Und so bin ich im Armenhaus von St. Gallen geboren, am 21. Juli 1946, an einem Sonntag. Es sei eine schwere Hausgeburt gewesen, eine Risikogeburt in Steisslage. Nach sechs Kindern war ich eine Nachzüglerin, Mutter war bereits in den Vierzigern. Als sie wieder Babysachen zu stricken anfing, fragten meine Geschwister, ob das für die Missionen sei! Wäre ich ein Bub geworden, hätte ich Gerhard geheissen. Auf die Geburt eines Mädchens waren meine Eltern nicht vorbereitet. Und so schlug meine Patin in der Not den Namen Theresia vor. Ein Mädchen, trösteten sich meine Eltern, würde ihnen im Alter beistehen. Und ausgerechnet die Jüngste ging ins Kloster! Bei mir war und ist einfach immer alles ein bisschen anders als bei andern. Ich glaube, das wurde mir schon in die Wiege gelegt.
Unser Familienleben sowie der Betrieb des Heims für Obdachlose und Randständige der Stadt St. Gallen gingen ineinander über. Mutter kochte für die 15 Insassen und für uns, putzte und besorgte einen grossen Garten, zusammen mit Angestellten, und mein Vater führte den Landwirtschaftsbetrieb, in dem die Heimbewohner zeitweise mithalfen. Erst im Kindergarten, 1952, lernte ich andere Kinder kennen. Bis dahin hatte ich fast ausschliesslich mit meiner Familie und den Frauen und Männern im Bürgerheim Kontakt.
Vermutlich war ich schon von klein auf gesundheitlich anfällig. Meine Geschwister nahmen mich als Anderthalbjährige zum Schlitteln mit und vergassen mich. Während sie miteinander spielten, liessen sie mich, auf einen Schlitten gebunden, alleine im Schnee. Ich sei schon blau angelaufen und total verfroren gewesen, als sie mich schliesslich heimbrachten – Bronchitis und Asthma waren seither meine ständigen Begleiter.
In der Primarschule war ich eher eine Mitläuferin, aber ich lernte gern. Mein Knoten löste sich dann in der Sekundarschule. Dort wurde ich zur Klassenchefin gewählt, völlig überraschend. Ich hätte mir das nie zugetraut. Jetzt merkte ich: Die hören auf mich. Das gab mir ungeahntes Selbstvertrauen. Ich spürte plötzlich, ich kann etwas, ich bin wer.
Wie es nach der Schule mit mir weitergehen sollte? Ich hatte keine Ahnung. Mich drängte niemand zu irgendwas. Meine Eltern hatten genug zu tun und konnten sich nicht auch noch um mich kümmern. Meine Freundin Cornelia schrieb mir aus dem Internat in Nordfrankreich, wo sie ein Jahr verbrachte, wie toll es dort sei. Und so meldete ich mich spontan an und fuhr mit einer Gruppe Schweizerinnen im Herbst 1961 für ein Jahr nach Frankreich. Heimweh hatte ich nie. Ich spürte, ich bin gemeinschaftsfähig, obwohl ich ja wie ein Einzelkind aufgewachsen war. In der Gruppe fühlte ich mich geborgen, konnte meine Meinung vertreten und lernte un peu de français. Mein Humor, ein eher trockener Humor, den ich von Vater geerbt habe, half mir sehr.
Ich wäre gerne Clownin geworden oder Dirigentin. In beiden Berufen hat man mit Menschen zu tun. Sie zu erheitern, über die Musik zusammenzuführen, ihnen Freude zu bereiten, das hätte mir gefallen. Aber beide Ausbildungswege waren im Umfeld, in dem ich gross wurde, unvorstellbar.
Ein Onkel vermittelte mich zu einer Familie mit fünf Kindern nach Uitikon-Waldegg. Dann arbeitete ich für kurze Zeit in einem Büro in St. Gallen, wo ich auf einer elektrischen Schreibmaschine Briefe tippte, und schliesslich entschied ich mich, Krankenschwester zu werden.
Als 18-Jährige nahm mich die Psychiatrische Klinik Wil auf. Die drei Jahre als Lernende auf verschiedenen Abteilungen gefielen mir sehr gut. Die Welt in der Klinik war keine fremde für mich – zu Hause im Bürgerheim hatte ich bereits Bekanntschaft mit Menschen aller Art und mit verschiedenen psychischen Krankheiten gemacht. Nur die Drogensüchtigen, so fand ich, waren hier nicht richtig aufgehoben. Aber wo hätte man sie damals sonst unterbringen sollen? Geeignete Institutionen befanden sich in den Sechzigerjahren erst im Aufbau.
In diesen Jahren hatte ich einen Freund, einen sehr lieben. Er wohnte in meiner Nachbarschaft, und wir unternahmen viel gemeinsam. Aber ich spürte, er ists nicht fürs Leben. Das liess ich ihn wissen, was ihn sehr betrübte. Er meinte, ich hätte wohl einen anderen. Ich mochte ihn sehr, hatte aber immer das Gefühl, dass da noch etwas anderes für mich kommt. Keine einfache Situation. Er heiratete später eine liebe Frau, und die beiden kamen mich im Kloster sogar besuchen.
Zwar hatte ich nun mein Diplom als Psychiatrieschwester, aber was ich mit meinem Leben anstellen sollte, war mir nicht klar. Ich fühlte mich wie in einer Sackgasse. In meiner Not fing ich an zu beten: «Herrgott, ich hätte gerne ein Zeichen, wie es weitergehen soll – heiraten, oder was sonst soll ich tun?»
Es klingt fast kitschig. Aber ich bekam dieses Zeichen wirklich. Während einer langen Nachtwache hatte ich im Stationszimmer Zeit, in Zeitschriften zu blättern. Ein Artikel von Schwester Hedwig, der Ordensfrau und Dichterin Silja Walter, fiel mir ins Auge: «Und unten blühen die Königskerzen – ein monastischer Tag im Kloster Fahr». Ich las begeistert, schloss das Heft und wusste: Das Kloster Fahr ist es. Es war eine Gebetserhörung. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, sie beten und es passiere nie etwas, dann kann ich sagen, dass es meistens so sei. Aber es gebe sie auch, die Gebetserhörung.
Ein Leben in einem Kloster konnte ich mir vorstellen, war doch eine meiner älteren Schwestern in jungen Jahren in ein offenes Kloster in Freiburg eingetreten und glücklich mit ihrem Leben. Ich meldete mich also im Kloster Fahr an und spürte, dass die Priorin, Schwester Elisabeth, etwas zurückhaltend war. Sie wusste ja nicht, wer da ins Kloster wollte. Die meisten jungen Frauen, die sich bewarben, waren ihr bekannt, sie kamen über die Bäuerinnenschule ins Kloster. Wenn sie bloss nicht verlangt, dass ich noch diese Schule absolviere!, durchzuckte es mich. Erst als ich meine Schwester erwähnte, die in einem Kloster lebte, wurde es einfacher, und ich konnte mich für die → Kandidatur anmelden.
Meine Arbeitsstelle im Spital kündigte ich mit der Begründung, ich würde ins Ausland gehen. In der Öffentlichkeit von einem Klostereintritt zu reden, traute ich mich nicht. Die Enttäuschung des Oberarztes war gross – hatte er mir doch die Verantwortung für eine Abteilung übergeben wollen.
Für die Zeit vor meinem definitiven Eintritt ins Kloster hatte ich mit einer Kollegin einen Arbeitseinsatz in einem Kibbuz in Israel geplant. Die drei Monate bis Weihnachten 1969 waren ein grosses Erlebnis, und aus Begeisterung blieben wir zusätzliche drei Monate für einen Einsatz in einem Kinderspital in Nazareth.
Am 4. November 1970 trat ich ins Kloster Fahr ein. Der Eintritt wäre schon für eine Woche früher angedacht gewesen, aber ich war an die Hochzeit meiner Freundin Lis eingeladen. Sie und Hanspeter wollten eigentlich im darauffolgenden Frühling heiraten, zogen die Feier aber meinetwegen vor. Nach dem Klostereintritt hätte ich nicht mehr rausgedurft. Es war ein traumhaftes Fest, und wir sind heute noch miteinander befreundet.