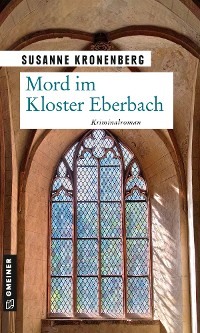Kitabı oku: «Mord im Kloster Eberbach», sayfa 3
7
Sie kamen, kaum dass er sich angezogen hatte. Seine Fischhaut war aufgequollen, der Nachtschweiß pappte zäh zwischen den Schulterblättern. Trotzdem hatte er es nicht fertiggebracht, sich seelenruhig unter die Dusche zu stellen, während ein fremder Wagen gegenüber vor Teubeners Einfahrt stand. Zivilfahrzeug. Kombi. Wiesbadener Kennzeichen. Kriminalpolizei? Zwei Männer verließen das Nachbarhaus, ein Schwergewicht mit pomadiger Mafiosofrisur und ein Beamtentyp mit Schlips und Kragen. Hinter der Küchengardine erspähte Daniel die dürre Silhouette von Annegret Teubener, die ihrem Axel nur wenige Tränen nachweinen würde. Der Schlaksige eilte vorweg und nahm dabei den niedergewalzten Lattenzaun in Augenschein – Teubeners jüngste Monstertat. Obwohl die Gutsschänke seit Alinas Tod geschlossen war, hatte Teubener sich weiterhin von seinen zerstörerischen Launen treiben lassen. In manchen Wochen war nichts geschehen, dann überkam es ihn, und er zertrümmerte Daniels letzte unversehrte Blumentöpfe mit dem Vorschlaghammer. Vor drei Tagen hatte Teubener seinen Weinbergtraktor kurzerhand in den Nachbargarten hineingelenkt, ohne den Umweg über die Einfahrt zu nehmen. Daniels Bemühungen, die Fassung zu bewahren und die hinterhältigen Attacken wie einen Hagelschauer im Weinberg hinzunehmen, fruchteten nie. Das anschließende Wortgefecht war heftig ausgefallen.
Er bat die Männer ins Wohnzimmer, das halbwegs ordentlich aussah, weil Hanna regelmäßig zum Putzen kam, und kehrte in die Küche zurück, um den Kaffeeautomaten in Gang zu setzen. Auch wenn die Männer, die sich als Hauptkommissare Luigi Milano und Dirk Wolfert vorgestellt hatten, nichts trinken wollten – er brauchte Koffein, um das Gespräch durchzuhalten. Nach kurzem Zaudern kippte er einen Schuss Wodka in den schwarzen Kaffee und trug den Becher ins Wohnzimmer. Die Polizisten standen mitten im Zimmer, als hätten sie sich nicht von der Stelle gerührt. Trotzdem war er überzeugt, dass sie sich die Bilderrahmen auf dem Sideboard angeschaut hatten. Alina im Weinberg, Alina mit einem Tablett voller Gläser, Alina einfach nur als Alina: die leuchtenden Augen, das bauschige Haar um die Schultern. Sie war viel zu hübsch, um übersehen zu werden.
Sie setzten sich an den Esstisch, Daniel auf der einen, die Polizisten auf der anderen Seite.
Der Dicke, Milano, machte den Anfang. »Sie wissen, warum wir hier sind?«
Daniel nickte. »Mehr oder weniger.«
»Das heißt was?«, fragte Kommissar Wolfert, dessen Augen hinter den Brillengläsern froschartig hervortraten.
Daniel starrte auf die Tischdecke – ein Lavendelton, Alinas liebste Farbe –, um keinen Blickkontakt mit den Froschaugen zu riskieren, als er so unaufgeregt wie möglich erklärte: »Ich habe eine Vermutung, warum Sie eben mit Annegret Teubener gesprochen haben, frage mich aber, was Sie von mir wollen.«
»Wir helfen Ihnen gern auf die Sprünge, Herr Lenges«, polterte der schwergewichtige Kommissar. »Gestern Abend wurde Ihr Nachbar ermordet. Axel Teubener!«
Daniel duckte sich. Laute Männer schüchterten ihn ein. Was für ein elendiger Morgen. »Ich weiß, meine Schwester hat mich angerufen. Sie hat es in den News im Internet gelesen.«
»Kommen wir zum Punkt, Herr Lenges«, sagte der Froschäugige mit gesenkter Stimme, die nicht weniger bedrohlich klang als das laute Organ des Kollegen. »Sie hatten gestern Abend einen Streit mit Teubener, eine handgreifliche Auseinandersetzung in der Eberbacher Basilika. Dafür gibt es mehr Augenzeugen, als wir nötig hätten.«
»Der Dreckskerl hat mich provoziert«, verteidigte sich Daniel und nahm einen großen Schluck aus dem Becher. Der Kaffee war lau, dafür sickerte ihm der Alkohol prickelnd durch die Kehle. »Dieser Mann ist der Teufel in Person. Er hat mein Leben zerstört und mir die Familie genommen.«
»Sie schwitzen, Herr Lenges«, stellte der Dicke fest. »Ist Ihnen unser Besuch unangenehm?«
»Ich habe schlecht geträumt«, murmelte Daniel. Wie immer schien sich alles gegen ihn verschworen zu haben.
»Ein Alptraum von Ihrer zweiten Begegnung mit Axel Teubener gestern?«, fragte Wolfert bohrend. »Ihr Nachbar hat die Basilika vor dem Ende des Films verlassen. Haben Sie Teubener in der Klostergasse aufgelauert? Wir sind informiert darüber, dass Sie in der Pause gegangen sind. Für beides gibt es Zeugen.«
»Keine Ahnung, wo er hin ist«, widersprach Daniel heftiger als beabsichtigt. Er musste die Nerven behalten. Mit dem Ärmel wischte er sich über die schweißnasse Stirn. »Ich wollte nach Hause. Letztes Jahr habe ich ›Der Name der Rose‹ gemeinsam mit Alina gesehen. Das kam alles wieder hoch.«
»Wir sind über den Unfall Ihrer Frau im Bilde«, bemerkte Milano, nun überraschend milde klingend. Die Kommissare schienen sich darin einig zu sein, abwechselnd zu sprechen. Oder hatte sich das im Verlauf einer jahrelangen Zusammenarbeit so ergeben? »Herr Lenges, Sie waren mit Ihrer schwangeren Frau in den Weinbergen unterwegs, wo Sie mit Teubener aneinandergerieten. Ich verstehe das, Sie waren aufgewühlt, ein rabiater Streit. Danach sind Sie zu forsch angefahren. Der Traktor stürzte um, es war in einer Steillage, und begrub Ihre Frau unter sich. Dann kam der Rettungshubschrauber, brachte sie nach Wiesbaden in die HSK, wo sie leider verstarb. Und mit ihr das ungeborene Kind. Habe ich das richtig wiedergegeben?«
Daniel nickte stumm. In ihm brodelte es. Sein Kopf drohte zu zerplatzen wie ein zu stark aufgeblasener Luftballon. Sein Atem stockte. Am liebsten wäre er zum Hof hinausgestürzt. Die Sehnsucht nach der Stille der Weinberge schien übermächtig.
»Herr Lenges?« Der Schmächtige säuselte ihm ins Ohr.
Daniels Blick versank in Alinas Lieblingsblau.
Milano schnurrte: »Haben Sie Ihren Nachbarn Axel Teubener getötet?«
»Ich will einen Anwalt sprechen.« Das war der einzige Satz, den Daniel in dieser vertrackten Situation herausbrachte.
8
Wiesbaden
Donnerstag, der 16. September
Norma begann den Morgen mit dem Checken der neusten Nachrichten – im Bett und mit dem Smartphone in der Hand. Mehrere Kanäle berichteten über den Mord im Kloster Eberbach. In Details verlor sich kein Artikel, und von möglichen Verdächtigen war ebenfalls nicht die Rede. Falls es entscheidende Entwicklungen geben sollte, hatten die Ermittler sie nicht an die Presse weitergegeben. Kurz wog Norma ab, bei Wolfert oder Milano nachzufragen, entschied sich aber fürs Abwarten. Je weniger sie die Ex-Kollegen mit wissbegierigen Anrufen nervte, desto mehr würden sie später von sich aus preisgeben, hatte sie die Erfahrung gelehrt. So nutzte sie die Zeit, ihren Gedanken nachzuhängen. Seit Tagen war sie ohne Arbeit, ein Umstand, der sie früher nervös gemacht hätte. Mittlerweile war sie entspannt genug, um die freie Zeit zu genießen und darauf zu vertrauen, dass der nächste Auftrag nicht lange auf sich warten ließe. Meistens kam er in Gestalt einer eintönigen, aber profitablen Recherche; ob für eine Versicherung oder einen Geschäftsmann. An diesem Morgen fehlte ihr zur Entspannung nur noch der schnurrende Kater. Zu ihrem Bedauern ließ sich Leopold nicht wie sonst am Dachfenster blicken, um mauzend Einlass zu verlangen. Sofern er nicht über die Biebricher Dächer streifte, hatte er sich womöglich in sein eigentliches Zuhause in der mittleren Etage zurückgezogen. Dort wohnte Eva Vogtländer, der neben dem Haus auch der Kater gehörte. Freilich bestand der Besitzanspruch an dem Tier nur der Form halber. Leopold war sein eigener Herr. Als unabhängiger Geist zeigte er sich mit seinem Personal zufrieden und verteilte seine Gunst auf beide Frauen.
Schläfrig rollte sich Norma in die Bettdecke ein. Lutz und Timon waren bis spät in der Nacht bei ihr geblieben. Aufgewühlt durch das Verbrechen, hatten sie in der winzigen Küche über den Tod und das Leben philosophiert. Die Männer kannten und schätzten sich. Dennoch kam es selten zu gemeinsamen Stunden. Umso mehr hatte sie es genossen, die beiden Menschen, die ihr die liebsten waren, gleichzeitig um sich zu haben. Lutz war zuerst aufgebrochen. Wenig später hatte sich Timon verabschiedet, um vom Biebricher Rheinufer ins Zentrum zu radeln – zu seinem Heim auf Zeit. Seit Jahren führte er ein freiwilliges Nomadenleben und hütete Wohnungen, deren Besitzer für eine Weile im Ausland lebten.
Der Appetit aufs Frühstück trieb Norma schließlich aus dem Bett. Kaum saß sie am Tisch, klingelte die Türglocke.
Vor der Schwelle wartete die Hausbesitzerin. »Hast du einen Moment für mich?«
»Klar, komm rein, Eva.«
Leopold hatte sich ihr angeschlossen. Der Kartäuserkater stolzierte an Eva vorbei und trabte in die Küche voraus. Dort bediente Norma den Kaffeeautomaten. Das Verlangen ihrer Vermieterin nach Koffein war nicht weniger ausgeprägt als ihr eigenes. Mit einem Dank nahm Eva den Becher entgegen und sank auf einen Stuhl nieder.
»Musst du nicht zur Schule?«, fragte Norma und setzte sich ebenfalls. Eva unterrichtete Deutsch und Geschichte an einem Wiesbadener Gymnasium.
»Erst heute Nachmittag, vorher wollte ich etwas Wichtiges mit dir besprechen«, antwortete Eva, während sie den Becher hin und her rückte.
So angespannt kannte Norma ihre Vermieterin nicht. Sie erschrak. War jetzt der Tag gekommen? Würde sie ihr Zuhause verlieren? Seit geraumer Weile trieb sie die Sorge um, Eva könnte die Dachwohnung ihrem langjährigen Partner überlassen wollen. Bislang war er in Köln zu Hause, jedoch hatte Eva in letzter Zeit öfter erwähnt, wie gern sie tagtäglich mit ihm zusammenleben würde. Es wäre ein schmerzlicher Verlust! Norma liebte die urgemütlichen Zimmerchen mit den Schrägen und die Ausblicke auf den Rhein mit seinen vorbeituckernden Lastschiffen. Sie hatte ihre Freude an den krächzenden Schwärmen der wilden Alexandersittiche, die im nahen Schlosspark lebten. Zu den praktischen Annehmlichkeiten gehörte das Büro im Erdgeschoss. Zuvor hatte der Raum als Blumenladen gedient und eine Weile leer gestanden.
Sie bemühte sich, unbekümmert zu klingen, als sie sagte: »Verstehe. Seit Jahren verbringst du jedes Wochenende und die Ferien in Köln. Also habt ihr genug von der Wochenendbeziehung?«
»Du triffst den Nagel auf den Kopf«, bestätigte die Vermieterin.
Sie würde sich nicht querstellen, hatte Norma sich vorgenommen. »Wann soll ich die Wohnung räumen? Ach, auch das Büro?«
Mit einem dumpfen Plopp landete Evas Becher auf der Tischplatte. »Um Himmels willen! Bitte bleibe hier, solange du möchtest«, widersprach Eva entschieden. »Es verhält sich genau andersherum. Ich ziehe nach Köln.«
»Puhh«, machte Norma vor Erleichterung, um sich gleich über eine neue Misere klar zu werden. Bedrückt schaute sie zu Leopold hinüber. Ohne die geringste Vorstellung von den Plänen seines Frauchens hockte der Kater wie eine Sphinx auf dem Fensterbrett und bemühte sich, das heftig turtelnde Taubenpaar hinter der Scheibe mit Missachtung zu strafen. »Dann wird Poldis Revier auf dem Dach bald allein den Vögeln gehören.«
Eva strich sich eine Haarsträhne zurück, eine dieser dichten, roten Locken, dank deren die Lehrerin stets auf perfekte Art unfrisiert aussah. »Das ist der Grund, warum ich hier bin. Ich habe eine Bitte.«
»Raus mit der Sprache!«
»Könntest du dir vorstellen, Poldi zu übernehmen? Ich meine, wo er die meiste Zeit sowieso bei dir verbringt?«
»Keine Frage, das weißt du doch«, sagte Norma erleichtert. Den Kater zu verlieren, hätte nicht nur sie geschmerzt. Auch Timon hätte den Stubentiger vermisst. »Wird es dir nicht sehr schwerfallen, Poldi zurückzulassen?«
»Das wird nicht einfach für mich, leider geht es nicht anders. Er hat hier sein Zuhause. Außerdem leidet mein Freund unter einer schlimme Katzenhaarallergie. Das ist der Grund, warum er mich nie besucht. Bei dir weiß ich Poldi in den besten Händen.«
Eva stand auf, und auch Norma erhob sich. Ob Eva nicht ihre Schule vermissen würde, fragte Norma. Wie oft hatte Eva von ihrem Kollegium geschwärmt.
»Man muss manchmal auch etwas Neues wagen«, erklärte Eva entschlossen. »In Köln werde ich an einer Privatschule unterrichten. Darauf freue ich mich. Danke, Norma! Für den Kaffee, für alles.«
Sie verließen die Küche. Leopold blieb auf seinem Platz, blinzelte träge und rührte keine Pfote.
Im Flur wandte Eva sich um. »Eine Bitte noch. Meine Wohnung … Ich suche einen Mieter. Falls du jemanden weißt …?« Sie wollte das Angebot diskret handhaben, um nicht von Anfragen überrollt zu werden. Sympathischen Interessenten absagen zu müssen, fiele ihr schwer.
Norma versprach, sich umzuhören. In der Küche erklang ein Signalton. »Entschuldigung, mein Handy. Bis bald, Eva!«
Das Smartphone brummte auf dem Küchentisch. Eckhard Winterstein! Ob sie Zeit für ein Gespräch hätte. Wenn möglich zeitnah im Kloster Eberbach.
Norma hatte nichts Besseres vor. Eine halbe Stunde später steuerte sie ihren kleinen Toyota durch den Rheingau.
9
Kloster Eberbach
Donnerstag, der 16. September
Eckhard Winterstein wartete vor der Vinothek, ihrem verabredeten Treffpunkt, und winkte sie auffordernd näher heran.
»Sind Sie einverstanden, wenn wir in meinem Wohnmobil reden?«, fragte er höflich. »Eigentlich könnte ich jeden Tag hierherfahren. Ich müsste nur über den Rhein, ich lebe in Mainz. Aber ich will am Drehort bleiben, Tag und Nacht, um seine Atmosphäre in mich aufzunehmen. Eine allumfassende Inspiration, Sie verstehen doch?«
Norma folgte ihm mit dem Entschluss, das Treffen auf der Stelle abzubrechen, sollte der Regisseur seinem Ruf gerecht werden und sich ausfallend oder cholerisch benehmen. Der Weg führte sie um das ehemalige Hospital herum und am Kleinen Klosterhof entlang.
»Die Fraternei«, erklärte Winterstein und deutete wie ein Gästeführer auf das breite Gebäude, dem sie entgegenstrebten. »Darin befand sich der sogenannte Brüdersaal, in dem die Zisterzienser Bücher abgeschrieben haben und wo, in neuerer Zeit, ein berühmter Film gedreht wurde. Denken Sie an gestern: der tote Mönch im Holzbottich!«
Sie verstand, worauf er anspielte. Schummriges Licht, voluminöse Weinfässer und dazwischen ein Bottich mit Wasser, durch dessen Oberfläche der blasse, aufgedunsene Körper einer korpulenten Leiche schimmerte. »Die Szene mit dem vergifteten Mönch spielt also dort drin?«
»So ist es, der Zuber aus ›Der Name der Rose‹ stand im Cabinetkeller, wie man die Fraternei auch nennt.«
»Hätten Sie selbst gern bei dem Epos mitgewirkt?«, fragte sie neugierig.
Winterstein seufzte leicht theatralisch. »Welcher Filmschaffende träumt nicht davon? Ich war zu meinem Leidwesen nicht dabei. Kloster Eberbach habe ich letztes Jahr erstmals besucht, um für meinen neuen Film zu recherchieren. Kommen Sie!«
Hinter dem Cabinetkeller öffnete sich der Große Klosterhof. Anders als am vergangenen Abend lag der gepflasterte Platz verlassen da bis auf ein Grüppchen Männer und Frauen, allem Anschein nach Touristen, die mit interessierten Mienen umherspazierten. Ob die Besuchergruppen von dem Mord erfahren hatten, fragte sich Norma unwillkürlich. Die zwei halbrunden Durchgänge zur Klostergasse, in der der tote Winzer gelegen hatte, waren durch Gittertore versperrt. Dahinter lag der innere Bereich des Klosters, der nur mit einer Eintrittskarte besichtigt werden konnte. Der Regisseur schritt weit aus wie jemand, der es gewohnt war, seine Arbeit schnell und zielorientiert zu erledigen. Auch Norma hielt sich für gewöhnlich ungern mit Schlendern auf. Nun jedoch ging sie absichtlich langsam. Sie wollte Zeit gewinnen und den Regisseur in ein Gespräch verwickeln, um ihn besser einschätzen zu können, sobald er auf den speziellen Grund seiner Einladung zu sprechen kam. Bisher hatte er nur erwähnt, dass es um sein Filmprojekt ginge.
»Verzeihen Sie meine Offenheit«, begann sie. »Gehen Sie mit Ihrem Dokudrama nicht ein wenig attraktives Thema an? Bei dem Wort ›Irrenanstalt‹ habe ich sofort die schlimmsten Bilder im Kopf. Menschen in Lumpen, verzweifelte Gestalten in Ketten. Was reizt Sie daran?«
Er hatte sich ihrem Schneckentempo notgedrungen gefügt. »Eben genau das ist mein Anliegen. Diese beklemmenden Assoziationen, wer hat sie nicht? Ich will eine vergessene Zeit ins Licht rücken. Mein Dokudrama erzählt die Geschichte der Psychiatrie in authentischen Bildern. Keine Frage, im 19. Jahrhundert gab es menschenverachtende Übergriffe, andererseits hatte die sogenannte Obrigkeit durchaus den aufrichtigen Willen, psychisch Kranken und geistig Behinderten zu helfen. Entscheidende Fortschritte werden wir in Spielszenen darstellen. Im Kloster Eberbach geschah Bahnbrechendes, Frau Tann!«
Hier spricht jemand, der von seinem Stoff überzeugt ist, erkannte Norma und fragte, von seiner Begeisterung mitgerissen: »Sie meinen Entwicklungen, die Persönlichkeiten wie Direktor Lindpaintner zu verdanken sind? Die Hauptrolle, für die Roman Bonheur einspringen wird?«
»Unbedingt! Philipp Heinrich Lindpaintner war 23 Jahre alt, als er in Eberbach zum Direktor berufen wurde – kein Arzt oder Psychiater, wie man vermuten würde, sondern ein Jurist. Das war 1817 und das Kloster mittlerweile säkularisiert. Lindpaintner wollte mit Humanität und Menschlichkeit wirken, ein ehrgeiziges Vorhaben für einen so jungen Mann.«
»Wurde er diesem Anspruch gerecht?«, fragte Norma mit wachsendem Interesse. Die Entwicklung der Psychiatrie war für sie ein unbekanntes Buch, und den Namen des Eberbacher Direktors hatte sie beim Empfang im Mönchsrefektorium zum ersten Mal gehört.
»Natürlich war er ein Kind seiner Zeit«, gab Winterstein zu bedenken. »Aus heutiger Sicht erscheinen uns die Methoden, die Lindpaintner zur Disziplinierung der Patienten angeordnet hat, als brutal und widersinnig. Das reicht von Schröpfkuren und Brechmitteln bis hin zum Hohlen Rad. Aber dennoch: Philipp Lindpaintner war ein Vorreiter, der auf Bildung und Beschäftigung der Patienten baute, anstatt die Kranken in Zellen zu verwahren.«
Norma hielt im Gehen innen, wandte sich um und warf einen Blick auf den dreiseitig geschlossenen Hof, der trotz seiner Pracht und beachtlichen Ausmaße einen Randbezirk bildete. »Ist es nicht ein Glückfall, dass Sie am Originalschauplatz drehen können?«
»Wie ein göttliches Geschenk, Frau Tann! Verzeihen Sie den blumigen Ausdruck. Die Atmosphäre ist wahrhaftig einzigartig. Die Gebäude aus der Zeit Lindpaintners sind alle noch da.«
»Also können Sie ohne große Umstände loslegen?«
Er lachte lauthals, was wie das Meckern einer Ziege klang. »So simpel ist es leider nicht. Wir müssen mit Kulissen nachhelfen. Zwar stehen die Gebäude noch, aber von dem mobilen Inventar ist nichts übrig geblieben. Wie Sie selbst sagen: Das Thema ›Irrenanstalt‹ weckt allenthalben deprimierende Fantasien. Deshalb hat man im 19. Jahrhundert alles entfernt, was an die ›Irren‹ erinnerte. Sogar die alten Mönchszellen im Dormitorium! Darin hatten die Patienten gehaust. Bis auf die nackten Wände wurde alles herausgerissen und fortgeschafft. Danach verfiel das Kloster in einen Dornröschenschlaf und wurde nur noch als Weingut genutzt.«
»Was geschah mit den Patienten?«
»Eberbach war zu klein geworden, zu unmodern. 1849 wurden neue Gebäude bezogen, quasi in Sichtweite, dort drüben auf dem Eichberg. Die heutigen Kliniken haben ihren Ursprung hier in Eberbach. Kommen Sie, wir sind am Ziel.«
Hinter einem von hohem Buchs gesäumten Tor, das ein Stück Bruchsteinmauer durchbrach, wurde das Heck eines Wohnmobils sichtbar. Gestutzte Buchenhecken begrenzten die Fußwege zu den Stellplätzen. Winterstein öffnete die Tür seiner fahrbaren Unterkunft und bat Norma hinein. Solange er mit einem Espressokocher hantierte, schaute sie sich unauffällig um. Neben der Psychiatriegeschichte hatte sich mit dem Wohnmobil eine weitere Wissenslücke aufgetan. So ein Gefährt hatte sie nie zuvor betreten, und es erschien ihr überraschend geräumig. Der Tisch diente Winterstein offensichtlich als Büro. Darauf verteilten sich ein Laptop und mehrere prall gefüllte Ordner. An den Wänden und Fensterscheiben klebten Bleistiftskizzen von Frauen unter breitkrempigen Hüten und Männern mit Zylindern und langen Bärten. Angedeutete Szenen mit Bonheur und weiteren Schauspielern, wie Norma vermutete.
»Sie sind ein talentierter Zeichner«, sagte sie anerkennend und dachte an ihren stümperhaften Versuch, noch in der Nacht die Kohlezeichnung aus der Klostergasse zu kopieren. Selbst wenn sie sich genauer an die Details erinnert hätte, wäre es ihr wohl kaum besser gelungen. Winterstein war eindeutig geübter.
»Was das betrifft, bin ich vom alten Schlag«, bekannte er. »Heutzutage gehören digitale Techniken selbstverständlich dazu, auch für mich. Aber für die Entwicklung einer Szene sind mir Papier und Bleistift immer noch das Liebste. Bitte, nehmen Sie Platz. Zucker?« Ohne die Antwort abzuwarten, stellte er ein Päckchen Würfelzucker und zwei Espressotassen auf den Tisch.
Norma rutschte auf die Bank. Leder. Anthrazitfarben. Ganz schön nobel, das Domizil des Regisseurs. »Ist Ihnen gestern in der Klostergasse die Kohlezeichnung aufgefallen?«
Er hatte den Espressokocher auf die Herdplatte in der winzigen Küchenzeile gesetzt und wandte sich um. »Wovon sprechen Sie?«
»Von einer Kohlezeichnung! Sie hing an einem Pfosten in der Klostergasse. Ich hatte den Eindruck, das Blatt wäre auch Ihnen nicht entgangen.«
Würziges Kaffeearoma stieg ihr in die Nase. Winterstein trug die Kanne an den Tisch und füllte mit elegantem Schwung die Tässchen, ohne etwas zu verschütten. Dann brachte er die Kanne zurück und setzte sich in den einzigen Sessel. Mit Daumen und Zeigefinger schnappte er sich ein Zuckerstück aus der Packung und ließ es in den Kaffee fallen.
Erst jetzt reagierte er auf ihre Bemerkung. »Mir ist gar nichts aufgefallen. Wie kommen Sie darauf?«
»Weil Sie so angestrengt hinübergeschaut haben.«
»Unsinn«, wehrte er ab. »Vergessen Sie Ihren Kaffee nicht.«
Sie schnupperte an der Tasse, aus der es verführerisch duftete. Sie nippte. Espresso kochen konnte er. »Kannten Sie Axel Teubener?«
»Den Ermordeten?« Er schüttelte heftig den Kopf. »Er war ein Winzer aus der Gegend, wie ich gehört habe. Meinen Wein kaufe ich mal in Rheinhessen, mal im Rheingau und auf unterschiedlichen Weingütern. Einem Axel Teubener bin ich meines Wissens nie begegnet.«
»Auch gestern Abend nicht?«
Er lachte sein Ziegenmeckern. »Ist das die Frage nach meinem Alibi? Ich habe bis zum Ende des Films zwischen Nelly und Marielle gesessen und war auch während der Pause mit den Damen zusammen. Zufrieden?« Falls er verärgert war, überspielte er dies geschickt.
»Bitte verzeihen Sie die Neugier einer ehemaligen Mordermittlerin. Ist eine Berufskrankheit.« Sie stellte die Tasse ab. »Kommen wir zur Sache. Also, warum wollten Sie mich treffen?«
»Mein Sicherheitsmann hat mich im Stich gelassen«, erklärte er in sachlichem Ton. »Nicht mit Absicht, er musste kurzfristig zu seiner Familie ins Ausland. Nun brauche ich jemanden, der ein Auge auf das Geschehen am Set hat. Absperrungen aufstellen, Schaulustige auf Abstand halten, so was in der Art.«
»Aha! Und zum Spannen der Flatterbänder brauchen Sie eine Privatdetektivin?«, gab sie zweifelnd zurück.
Auffordernd beugte er sich vor. »Hören Sie, ich habe bedeutende Geldsummen in dieses Filmprojekt gesteckt. Ich bin Regisseur und Produzent in Personalunion und muss Verträge erfüllen, mit dem Sender, mit meinen Mitarbeitern. Ängste und Verunsicherung meiner Leute kann ich mir nicht leisten, nicht einmal, wenn quasi vor den Augen der Mannschaft ein Mord geschah. Das verstehen Sie doch?«
Die berechnende Bemerkung über sein Team hatte ihn Sympathiepunkte gekostet. Andererseits musste der Druck, den ihm das Filmvorhaben bereitete, erheblich sein. Was zudem den Tobsuchtsanfall erklärte, zu dem ihn der Verlust seines Hauptdarstellers getrieben hatte.
»Verzeihen Sie, ich habe Erkundigungen über Sie eingezogen, Frau Tann«, fuhr er fort, als Norma schwieg. »Sie waren eine hoch geschätzte Hauptkommissarin und sind aus freien Stücken aus dem Dienst geschieden. Die Mordkommission habe nur ungern auf Ihre Fähigkeiten verzichtet, hat man mir versichert. Auch Ihre Reputation als Privatdetektivin kann sich sehen lassen.«
Bei wem mochte er nachgefragt haben? Bei seinem Verleger? Vermutlich. Lutz würde ein unverbindliches Lob geäußert haben, ohne sich in Einzelheiten zu verlieren. Diskretion war einer seiner wesentlichen Charakterzüge. Solange Norma mit seinem Sohn Arthur, einem renommierten Wiesbadener Kunsthändler, verheiratet gewesen war, hatte sie ein wohlwollendes, aber distanziertes Verhältnis zu ihrem Schwiegervater. Nähergekommen waren sie sich durch die Trauer um Arthur und die aufwühlenden Erlebnisse, die seinen Tod begleitet hatten. Nach und nach hatte sich ihre Beziehung zu einer tiefen und vertrauensvollen Freundschaft entwickelt. Auch Milano und Wolfert waren ihre Freunde. Wenn es darauf ankam, konnte sie sich auf beide gleichermaßen verlassen. Einem Fremden gegenüber würden sie nichts über ihre Vergangenheit im Polizeipräsidium ausplaudern. Für andere Ex-Kollegen wollte sie nicht die Hand ins Feuer legen. Bis zu ihrer Kündigung hatten Klatsch und unverhohlene Häme die Runde gemacht. Eine Kommissarin, die sich wie eine naive Touristin von südamerikanischen Rebellen entführen lässt! Als ob sie diese Vorwürfe nicht selbst bis aufs Blut gequält hätten. Wo waren ihre Instinkte geblieben, als Arthur sich von einem Künstler zu einer Fahrt in die kolumbianischen Berge hatte überreden lassen? Arthur vertraute dem Maler, dessen Werke er in seiner Wiesbadener Galerie ausstellte. Was für ein Irrtum! Lange Tage saßen Arthur und Norma im Dschungel fest, bedroht und bewacht von einer Horde schwerbewaffneter Männer, die sich als Guerillakämpfer ausgaben und nichts anderes waren als Koka kauende Ganoven. Die Entführung durch angebliche FARC-Terroristen zog weite Kreise durch das Außenministerium, das BKA, das hessische LKA, bis hinein ins Wiesbadener Kollegium. Nach ihrer Befreiung hatte Norma allen Halt verloren und sich unfähig gefühlt, ihre Arbeit zu tun. Wenn also jemand aus dem früheren Umkreis so freundlich Auskunft über sie gegeben hatte, musste er ihr wohlgesonnen sein.
Winterstein hatte sich zurückgelehnt. Mit verschränkten Fingern erwartete er ihre Antwort.
Bedächtig stellte sie das leere Tässchen zurück, bevor sie sagte: »Sie sprechen von Ängsten und Unsicherheit in Ihrem Team, was verständlich ist. Allerdings liegt die Mordermittlung in den Händen der Polizei.«
»Keine Frage«, pflichtete er ihr bei. »Meine Bitte ist: Sie, Frau Tann, halten sich am Set auf und vermitteln dem Team Ruhe und Sicherheit.«
»Also vermitteln, nicht ermitteln?«, entgegnete Norma schmunzelnd. Eindringlich fragte sie: »Fühlen Sie sich persönlich bedroht?«
Er hob abwehrend die Hände. »Gott bewahre! Ich habe Neider und bin so manchem auf die Füße getreten. Aber warum sollte mir jemand nach dem Leben trachten?«
»Sie wollen mich demnach als Sicherheitsbeauftragte engagieren, verstehe ich das richtig?«
»Unterstützt von einer erfahrenen Polizistin wie Ihnen«, sagte er mit breitem Lächeln, »werden wir mit der erforderlichen Gelassenheit und Konzentration arbeiten können.«
»Ex-Polizistin«, stellte sie klar.
Nach kurzer Diskussion stimmte er ihren Honorarforderungen zu. »Meinetwegen, aber unter einer Bedingung: Sie wohnen hier auf dem Gelände. Ich habe vorsorglich ein Zimmer im Hotel Kloster Eberbach gebucht. Sie können heute Mittag einziehen.«
Über den Befehlston ließ sich Norma vom ausgehandelten Verdienst hinwegtrösten. Sämtliche Übereinkünfte tippte Winterstein akribisch in seinen Laptop. Offenkundig verließ sich ihr Auftraggeber nicht auf mündliche Vereinbarungen.
Nachdem sie den Vertrag in zwei Ausführungen unterzeichnet hatten, streckte Winterstein ihr die Hand hin. »Ab jetzt bin ich ›Ecki‹ für dich. Willkommen im Drehteam, Norma!«
So vernuschelt, wie er das Wort aussprach, klang es in ihren Ohren wie »Dreamteam«.