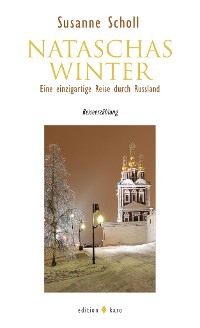Kitabı oku: «Nataschas Winter», sayfa 2
Das weite Land
Wir haben die breiten Boulevards, über denen der Himmel einerseits niedrig und andererseits so unendlich erscheint, längst hinter uns gelassen. An uns vorbei zieht die Weite. Russlands Hügel und Seen, hässliche neue Kleinstädte, Brücken und Dämme.
Adlerauge und die Kartenleserin haben sich in den Schlaf zurückgezogen, alle Versuche, ihnen die überwältigende Freiheit des Blicks über Berge und Wälder schmackhaft zu machen, sind fehlgeschlagen. Sie öffnen ihre Augen zum ersten Mal wieder, als wir von der Straße in einen kleinen Waldweg abbiegen und stehen bleiben.
Ein paar hundert Kilometer haben wir schon zwischen uns und Moskau gebracht. Ein paar hundert Kilometer, auf denen wir weder ein Rasthaus noch eine Gaststätte gefunden hätten, die zum Haltmachen einladen würden. Weil aber der menschliche Organismus bekanntermaßen auf derlei sowjetisch-russische Gegebenheiten keine Rücksicht nimmt, verhalten wir uns wie trainierte russische Reisende und missbrauchen den Wald für unsere tyrannischen körperlichen Bedürfnisse.
Es ist ein dichter Mischwald, in dem es immer noch duftet – obwohl, wie wir feststellen müssen, an dieser Stelle schon viele Reisende vor uns Halt gemacht haben. Adlerauge wagt sich als Erster hinter einen Baum, die Kartenleserin folgt ihm etwas zögernd nach. Schließlich begebe auch ich mich ins Dickicht – und bin von uns dreien schließlich die Einzige, die es zuwege bringt, in diesem duftenden Wald in einen unangenehm riechenden, klebrigen, angeblich Glück bringenden Haufen zu treten.
Trotz aller Zivilisationsschäden finden wir hier viele Pilze. Schließlich hat es in den vergangenen Wochen oft geregnet. Wären wir noch in Moskaus näherer Umgebung, hätten wir hier keinen einzigen Pilz mehr zu Gesicht bekommen. Doch die eiligen Reisenden können, so wie wir, nichts anfangen mit dem russischen Leibgericht in seiner natürlichen Umgebung. Nur ein Witzbold hat einen großen Pilz ausgerissen und mitten in die Sonne an den Rand des sandigen Waldwegs gestellt.
Eine große Möwe, die sich vom nahe gelegenen Flüsschen hierher verirrt hat, beäugt ihn. Da wir alle müde sind und nur wenig und leise sprechen, beachtet sie uns nicht. Langsam und hüpfend nähert sie sich dem für sie wohl verführerisch aussehenden merkwürdigen Gast am Wegrand. Ganz geheuer ist ihr die Sache aber offenbar nicht. Denn als sie den Pilz endlich erreicht hat, pickt sie kurz gegen dessen hübschen hellbraunen Hut und zieht sich dann ebenso hüpfend gleich wieder zurück.
Adlerauge und die Kartenleserin, die nicht nur unglaubliche Tierfreunde, sondern auch ihrem Alter entsprechend geradezu rabiate Tierschützer sind, beobachten die Möwe wie hypnotisiert. Später, wieder im Auto, ergehen sie sich in Überlegungen darüber, ob es denn für eine Möwe tatsächlich gut sein könne, derlei Pilze zu verspeisen. Und ob der Witzbold, der den Pilz so verführerisch aufgestellt hat, denn nun ein Tierfreund oder aber ein Verbrecher sei. Denn ob Möwen tatsächlich Pilze vertrügen – das wüssten sie nicht. Da sind wir allerdings schon längst wieder unterwegs, fahren vorbei an riesigen, hellen Wäldern. Weit und breit kein Haus, nur manchmal steigt in der Ferne ein dünner Rauchfaden in die Luft. Vielleicht von Reisenden, die sich tiefer in die Wälder gewagt und dort ein Lagerfeuer entzündet haben – was Adlerauge und die Kartenleserin als unverantwortlich bezeichnen, denn was würde aus den Waldtieren werden, wenn die dummen Menschen mit ihrem Lagerfeuer möglicherweise einen Waldbrand auslösten?
Da es aber gerade wieder einmal ein bisschen geregnet hat, beruhigen sie sich selbst mit der Feststellung, der Wald sei ohnehin viel zu nass, um zu brennen. Woher aber, so fragen sie sich und mich, woher kommen dann die dünnen Rauchsäulen, die wir hier und da bemerken.
Das Dorf
Das Dorf liegt hinter einem Wald, wo man es eigentlich gar nicht vermutet. Es macht sich nicht bemerkbar; der Rauch aus seinen Schornsteinen steigt nur selten hoch genug, um noch jenseits der Bäume sichtbar zu sein. Die Kühe bleiben auf den Wiesen dahinter, und wenn der Regen sie wieder einmal auf der Weide überrascht, stellen sie sich auf ihrer Seite des Waldes unter. Die Pferde machen gerne etwas weitere Ausflüge, aber auch sie bevorzugen jene Gegenden, in denen kaum Gefahr besteht, Menschen zu begegnen, die sie nicht kennen.
Das Dorf macht ganz den Eindruck, als ob ihm dieses vergessene Dasein gar nicht so schlecht gefiele. Seine Straßen sind Wiesenstücke, an deren Rändern die Holzhäuser aufgereiht stehen. Äußerlich unterscheiden sich die Häuser manchmal durch ihre Farbe, im Inneren aber gleichen sie einander, wie sich Geschwister eben gleichen, die ihr Leben miteinander verbringen.
Menschen, die sich nach langen, quälenden Autofahrten auf ebenso langen und quälend schlechten Asphaltstraßen hierher verirren, neigen in der Regel dazu, die ersten Stunden im Dorf mit Auf-und-ab-Gehen auf den Wiesenstraßen zu verbringen. Weil ihnen die Füße eindringlicher vermitteln, was sie den eigenen Augen nicht glauben wollen.
Die Dorfstraße schmücken in regelmäßigen Abständen alte Ziehbrunnen aus Holz. Einer für jedes Haus. Aus ihnen holen die Dorfbewohnerinnen das Wasser. Immer noch. Obwohl das Dorf seit mehr als zwei Jahrzehnten über elektrischen Strom verfügt. Den braucht das Dorf aber nicht für Wasserpumpen, den braucht es für das Fernsehen.
Denn das Dorf liegt zwar hinter den sieben Bergen, aber seine Bewohnerinnen wissen genau, was in der Welt vor sich geht.
Die Bewohnerinnen. Und wo sind die Männer? Tot.
Das Dorf hat keine Schwierigkeiten mit dieser Wahrheit.
Die Männer hier sterben früh, die Frauen später. Früher hat das Dorf dem Samogon – dem aus Kartoffeln und Zucker selbst gebrannten Schnaps – die Schuld daran gegeben.
Aber jetzt hat sich das Dorf eine neue Ursache aus dem Fernsehen geholt. Die Umweltverschmutzung. »Die hat die Männer umgebracht«, sagen die Frauen im Dorf. »Der Samogon«, sagen sie, »kann es nicht gewesen sein. Denn den trinken wir auch.« Manchmal bis zwei Uhr früh.
Manchmal steht um diese Zeit auch die Kuh plötzlich vor der Tür. Wenn sie am Abend zuvor keine Lust hatte, zusammen mit den anderen von der Weide zurück ins Dorf zu kommen, und in der Nacht schleunigst gemolken werden will. Dann steht Pelageja Iwanowna auf und tut, was die Kuh verlangt.
Pelageja Iwanowna ist rund, trinkfest und siebzig Jahre alt. Und führt einen alten russischen Namen, dem man heute kaum noch begegnet. Was ihr im Leben nicht immer nur Freude gemacht hat. Aber zum Glück hat sie fast nur hier im Dorf gelebt – sieht man einmal von der Zeit ab, als sie zur Schule musste.
Mit den meisten Frauen im Dorf ist sie irgendwie verwandt. Früher war sie die Dorflehrerin. Früher, als es noch eine Dorfschule gab. Als hier noch Kinder zur Welt kamen und junge Familien lebten. Früher, als es auch noch eine Dorfkrankenschwester gab und der Bezirksarzt zweimal im Jahr kam.
Geholfen hat er kaum einem. Aber man konnte ihm die von der Feldarbeit und vom Melken geschwollenen Füße und Hände zeigen und sich von ihm freundliche Ratschläge geben lassen.
Jetzt muss man in die Bezirkshauptstadt reisen, wenn man den Arzt braucht. Vier Kilometer zu Fuß durch den Wald, dann eine Stunde mit dem Bus. Pelageja Iwanowna und ihre Nachbarinnen brauchen den Arzt nicht. »Sterben«, sagen sie, »sterben können wir auch alleine.«
Wenn – ganz selten – Besuch von jenseits des Waldes kommt, gibt es Streit zwischen Pelageja Iwanowna und ihren Nachbarinnen. Wer darf die Gäste bewirten; bei wem sollen sie übernachten; wer sorgt für das Pferd, das den Wagen mit dem Gepäck die vier Kilometer durch den schlammigen Wald zieht; und auch dafür, dass die wenigen noch lebenden Männer sich erst dann betrinken, wenn der Besuch glücklich wieder zur Straße zurückgebracht worden ist?
Schließlich erwartet niemand im Dorf, dass die Gäste zu Fuß kommen. Vier Kilometer durch den Wald. »Wir sind das gewohnt, aber die von draußen …?«, sagen die Frauen.
Wer die Gäste bei sich beherbergt, darf sie den Übrigen nicht vorenthalten. Das ist die Regel im Dorf.
Am Abend kommen die Nachbarinnen bei der Gastgeberin zusammen. Und beweisen, dass der Samogon ihnen nichts anhaben kann. Dann kriegen auch die wenigen Männer ihr Gläschen.
Wenn Gäste kommen, kann es auch passieren, dass man plötzlich über Dinge in Wut gerät, die sonst nicht wichtig sind. Über Dinge jenseits des Waldes.
Eigentlich wissen sie ganz genau, was draußen los ist. Alles kommt mit dem Fernsehen ins Dorf. Oder mit dem Besuch. Manchmal auch mit den Verwandten, die die Kinder im Sommer hierher schicken, wenn die Schulen fast drei Monate lang schließen, und man nicht weiß, was anfangen mit ihnen in dieser langen Zeit. Manchmal auch, wenn eine von den Frauen eine große Reise antritt. Nach Moskau. Vier Kilometer zu Fuß durch den Wald, eine Stunde mit dem Bus, einen Tag mit dem Zug.
Früher sind sie gerne in die Hauptstadt gefahren. Jede hatte dort auf dem Markt ihren festen Standplatz. Da verkauften sie ihre Holzlöffel, Holzschatullen, Holzpuppen. Und nahmen Wurst, Zucker und Dosen mit Fisch mit zurück. Für das ganze Dorf. Einen Tag mit dem Zug, eine Stunde mit dem Bus und vier Kilometer zu Fuß durch den Wald, den voll gepackten Rucksack auf den Schultern.
Heute fahren sie nur noch selten. Die Wurst, der Zucker, das Salz sind jetzt zu teuer. Und ihre Holzlöffel, Holzschatullen, Holzpuppen will keiner mehr. Die kaufen die Moskauer jetzt viel billiger in den Geschäften.
Pelageja Iwanowna, die früher Lehrerin war, kann das erklären. Aber irgendwie will keine ihrer Nachbarinnen ihre Erklärungen hören.
»Lass gut sein«, sagen sie freundlich und schalten das Fernsehgerät erst ein, wenn es Zeit für Maria, die Seifenoper aus Brasilien, ist. Dann machen es sich die Kinder, die gerade da sind, auf dem Ofen hinter den Blumentüchern bequem und die Alten auf den Sesseln und dem Bett. Und nichts kann sie davon abhalten, sich mit Maria aus Brasilien zu freuen und zu kränken. Auch Pelageja Iwanowna nicht.
Deshalb besteht Pelageja Iwanowna darauf, Besuch von jenseits des Waldes bei sich zu Hause zu empfangen. Dort steht kein Fernsehapparat.
Wenn Besuch da ist, holt Pelageja Iwanowna eingelegte Gurken und selbst gebackenes Brot hervor. Und erzählt von ihrem Mann, der – wie die anderen – tot ist; vom Sohn, der in der großen Stadt lebt und versprochen hat, das Holzhaus winterfest zu machen; von der Schule damals, als es immer hieß, das Dorf gehöre zur nahen Kolchose.
Viel bemerkt haben sie nicht davon. Damals sind die Kühe genauso wie heute auch allein auf die Weide gegangen und wieder zurückgekommen. Die Pferde streunten genauso frei herum, und gegessen haben sie auch damals die Kartoffeln, die sie selbst angebaut haben, und die Pilze und Beeren aus dem Wald.
Ein paar junge Männer sind wohl gefallen. Damals im Krieg gegen Hitlers Deutschland. Aber keiner ist weggeholt worden, als Stalin den Krieg im eigenen Land führte. Das Dorf war damals schon genauso vergessen, wie heute. Also hat sie auch die Geschichte mit dem großen Anfangsbuchstaben gnädig vergessen. Sie haben Pilze, Beeren und Kartoffeln gegessen, und ihre Kühe gemolken. Zuzeiten waren sie auch froh darüber, nicht zu wissen, was jenseits des Waldes vor sich geht.
Ganz still, ganz unbemerkt sind sie alt geworden, Pelageja Iwanowna und ihre Nachbarinnen. Ganz still und unbemerkt ist das Geld, das sie von der Kolchose bekommen haben, immer weniger geworden. Irgendwann hat sich die Kolchose in Genossenschaft umbenannt, aber auch da haben sie keine Änderung bemerkt. Ganz still und fast unbemerkt sind die Jungen weggegangen und die Männer nach und nach weggestorben. Ganz allmählich haben sie aufgehört, die Holzlöffel, Holzschatullen und Holzpuppen zu bemalen.
Pelageja Iwanowna hat nie Löffel oder Schatullen bemalt. Sie war die Lehrerin. Die Nachbarinnen, die beherrschten die Kunst der Holzmalerei. Jede von ihnen hat sie von ihrer Mutter gelernt. So wie die Männer vom Vater die Kunst gelernt haben, aus dem Holz der Birken Löffel, Schatullen und Puppen zu schnitzen. Die immer gleichen Formen mit der immer gleichen Bemalung. Nur die Frauen im Dorf konnten nach einem flüchtigen Blick sagen, aus welchem Haus welcher Löffel, welche Schatulle, welche Puppe kam.
Jede Frau hat die Kunst an die Tochter weitergegeben, jeder Mann an den Sohn.
Jetzt aber arbeiten die Söhne und Töchter in den Fabriken der Stadt und die Kunst, dem Löffel, der Schatulle oder der Puppe die eine oder die andere Blume mit der einen oder der anderen Farbe aufzumalen, wird nicht mehr weitervererbt.
Die letzten Schatullen, Puppen und Löffel, die sie noch selbst bemalt haben, schmücken jetzt die Bretter vor den kleinen Fensterchen, so dass man, wenn man durch das Dorf spaziert, an vielen bunten, hölzernen Erinnerungsstücken vorbeigeht, die ganz langsam verblassen.
Nur bei Pelageja Iwanowna stehen keine bunten Holzschatullen oder Puppen im Fenster. Und das tut ihr jetzt manchmal ein bisschen Leid. Aber eine von der Nachbarin als Geschenk annehmen, das würde die Lehrerin nie.
»Na ja, früher, da war viel los hier«, sagt Pelageja Iwanowna, aber es klingt gar nicht traurig. »Seit zwanzig Jahren versprechen sie uns eine Straße bis hierher«, sagt Pelageja Iwanowna auch. Und auch das klingt nicht traurig. Wer will die Straße schon? Ein Krankenwagen wäre dann schneller zur Stelle, wenn eine der Alten ihn brauchen sollte – aber keine der Alten will den Krankenwagen.
»Die Straße – die brächte dem Dorf viel«. Sagen die, die im Nachbardorf leben, direkt an der Hauptstraße.
»Viel, was uns bisher erspart geblieben ist«, sagt Pelageja Iwanowna.
Und die vier Kilometer durch den Wald, wenn im Dorf einmal der Zucker, das Salz, die Seife ausgegangen sind?
»Wir haben ja Vorräte – einmal alle paar Monate kann man den Spaziergang schon machen«, sagen die Alten und zucken mit den Schultern.
»Schön findet ihr es hier bei uns?«, fragt Pelageja Iwanowna die Besucher von jenseits des Waldes und zeigt dann ein bisschen geniert und amüsiert zugleich durch das kleine halb blinde Stubenfenster hinaus auf ihren Innenhof.
Im Sommer, wenn der Regen ununterbrochen fällt, versinkt er im Morast. Im Winter, wenn Frost und Schnee kommen, wird er spiegelblank vom Eis. Und ganz hinten in der Ecke steht ein windschiefes Holzhäuschen mit einer ebenso windschiefen Tür.
Auf das zeigt Pelageja Iwanowna, die frühere Lehrerin, geniert und amüsiert, wenn ihr die Besucher von jenseits des Waldes die Ruhe und die Schönheit der Landschaft rund um das Dorf vorloben.
»Schön?«, fragt Pelageja Iwanowna und sucht eine Antwort. »Schön ist Maria aus Brasilien. Wir hier, wir sind nur weit weg von allem.«
Wenn die Gäste von jenseits des Waldes nach ein paar Tagen wieder abreisen, gut verpackt gegen den Regen und mit einem Mann, der von den Frauen nüchtern gehalten wurde, damit er den Pferdewagen sicher durch die tiefen Wasserlachen im Wald kutschiert, steht Pelageja Iwanowna am Abhang.
Mit ihr stehen die Nachbarinnen.
Ein bisschen wehmütig werden sie, wenn wieder jemand weggeht, der wahrscheinlich nicht mehr zurückkommt. Ein bisschen verloren sehen sie aus, im Regen auf der Wiese.
»Und gebt dem Kerl auf dem Wagen ja kein Geld! Sonst betrinkt er sich, bevor er das Pferd zurück gebracht hat«, ruft Pelageja Iwanowna, als der Wagen schon fast in den Wald eingetaucht ist, und winkt dann, bis sie ihn zwischen den Bäumen endgültig aus den Augen verliert.
Das Ende eines russischen Reisetages
Noch hundert Kilometer bis Petersburg.
Adlerauge und die Kartenleserin rumoren im Auto herum. Die aus Moskau mitgebrachten Kirschen sind längst aufgegessen, die Dosen mit den süßen Getränken leer.
»Nicht wegschmeißen«, sagt Adlerauge. Schließlich stünden die weltweit bekannten Namen auf diesen speziellen, in Moskau gekauften Dosen in zyrillischen Buchstaben. Eine Erinnerung, die man nicht wegwerfen dürfe.
Aber etwas von ihrer Trauer darüber, dass die Arbeit ihrer Mutter sie zwingt, das Land zu verlassen, in dem sie sich sechs Jahre lang irgendwie zu Hause gefühlt haben, ist Adlerauge und der Kartenleserin inzwischen abhanden gekommen. Vielleicht, weil die Fahrt schon so lange dauert, vielleicht, weil sie jetzt doch so etwas wie Neugierde empfinden angesichts einer Stadt, in der ich einmal gelebt habe und die sie selbst zum ersten Mal sehen werden.
Sicherlich aber haben sie genug vom Auto und von der Landstraße, deren Umgebung sich seit Moskau nicht sehr verändert hat.
Und dann bemerke ich, dass unser Benzin knapp wird. Adlerauge muss also Ausschau halten. Die erste Tankstelle, der wir begegnen, sieht gut aus, ist aber geschlossen.
»Wie kann das sein?«, fragt die Kartenleserin, die mit dem Auto bisher nur in Gegenden unterwegs war, in denen man alle paar Kilometer Benzin kaufen konnte, so viel man nur wollte.
»Na ja«, sage ich noch ziemlich unaufgeregt, »wahrscheinlich hat man ihnen heute kein Benzin geliefert.«
Noch fährt das Auto, auch wenn es immer deutlicher zu verstehen gibt, dass es bald aufgefüllt werden sollte.
Adlerauge hält weiter Ausschau, und auch die Kartenleserin hält den Blick starr auf den Straßenrand gerichtet, um die nächste Möglichkeit nicht zu übersehen. Wieder entdecken wir ein Schild und biegen von der Straße ab.
Drei rostige Tanksäulen stehen vor einem kleinen Betonhäuschen, dessen Fenster, hinter dem sich tatsächlich jemand aufhält, dicht vergittert ist.
»Die ist offen«, sagt die Kartenleserin erfreut.
Ich steige aus und frage beim vergitterten Fensterchen, aber die junge, bleiche und leicht ungehaltene Person dahinter gibt mir kurzerhand zu verstehen, dass sie jenes Benzin, das mein Auto benötigt, nicht anzubieten hätte.
Etwas betreten kehre ich zum Auto zurück, und Adlerauge und die Kartenleserin sehen mich entsetzt an, als ich den Wagen wieder starte und davonfahre.
»Was war denn jetzt los?«, fragt die Kartenleserin.
»Nicht das richtige Benzin«, sage ich und versuche, Haltung zu bewahren. Obwohl ich bereits überlege, wie weit wir wohl noch kommen werden und woher wir Hilfe bekommen könnten, falls wir hier, mitten in Russland auf einer – wie ich jetzt plötzlich feststelle – doch einigermaßen einsamen Landstraße, stranden sollten.
Adlerauge und die Kartenleserin scheinen Ähnliches in ihren Köpfen herumzuwälzen, denn plötzlich fragen sie mich sehr genau nach unserem Auto aus, und wie viel Benzin es denn eigentlich verbrauche und ob wir vielleicht doch noch bis Petersburg kämen.
Ich weiß es nicht, und das Auto macht mir wenig Mut. Die Benzinanzeige leuchtet ununterbrochen hellgelb, aber noch bewegen wir uns weiter.
»Da – vorne!«, schreit Adlerauge, aber nach den bisherigen Erfahrungen wage ich es noch nicht, erleichtert aufzuatmen.
Wieder drei rostige Tanksäulen, wieder ein fest vergittertes Fensterchen, und dahinter eine etwas ältere, darum aber nicht freundlichere Person.
Ja, sie hätte jenes Benzin, das ich benötige, sagt sie mürrisch – und ich atme erleichtert auf.
Zwar bedarf es unserer vereinten Kräfte, den Tankdeckel abzuschrauben und das Auto aufzufüllen, aber wir fühlen uns, als ob man uns gerade aus einem Hochwasser führenden Strom gefischt hätte, in dem wir hilflos dahintrieben.
Als wir endlich wieder auf dem Weg nach Petersburg sind, das nun wirklich in erreichbare Nähe zu rücken beginnt, ergehen sich Adlerauge und die Kartenleserin in stirnrunzelnden Überlegungen über dieses Land, von dem sie nur so schwer Abschied nehmen können. Wie die russischen Reisenden es denn ertragen könnten, so ganz und gar unsicher unterwegs zu sein, fragen sie sich. Oder wer sich denn da noch freiwillig auf Reisen begeben würde.
In Moskau kann einem so etwas nicht passieren, stellen sie dann fest und rechtfertigen so vor sich selbst die Tatsache, dass sie immer noch – und trotz derlei Erlebnissen – leiden an dem Abschied.
»Früher«, sage ich, »früher, als wir gerade angekommen waren, gab es doch viel weniger Autos hier.« Aber das genügt ihnen nicht als Erklärung. Straßen gebe es ja schließlich auch. Schlechte zwar, fügen sie hinzu, aber doch Straßen.
»Also ist man auch früher gereist!«
»Ja«, sage ich, »aber jede Autofahrt war eben ein Abenteuer.«
Na ja, meinen sie, das habe sich ja nicht wirklich geändert.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.