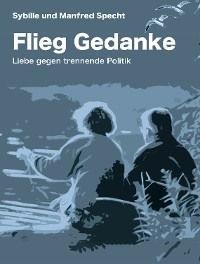Kitabı oku: «Flieg Gedanke», sayfa 3
Das siebte Semester war für ein Praktikum bestimmt. Hans und ich erhielten eine Anstellung bei der damals noch privaten Baufirma Louis Schneider in Riesa. Zu Beginn arbeitete ich auf einer Brückenbaustelle, wechselte danach zum Gerüstbau und die restliche, etwa halbe Zeit, durfte ich im Konstruktionsbüro mitwirken. Dessen Leiter war ein ehemaliger Professor aus Rostow am Don. Er hatte in Karlsruhe studiert und sprach sehr gut deutsch. Auch seine Familie lebte in Riesa. Der erwachsene Sohn arbeitete ebenfalls bei Louis Schneider. Anfangs war er sehr zurückhaltend und beschränkte sich auf die notwendigen technischen Anweisungen. Mit der Zeit aber öffnete er sich mehr und mehr, es entstand in der Tat ein Vertrauensverhältnis.
Eines Tages überraschte er mich sogar mit der Prognose, dass ich eine große Zukunft vor mir hätte. Von ihm hörte ich dann auch seinen Lebensweg: festgenommen und eingekerkert während der Oktoberrevolution. Ein nachträglich empfundener Glücksumstand, denn der Kerker war ein unerwartet sicherer Ort. Nur weniger seiner Gefährten hatten die verderblichen Unruhen überlebt. Danach arbeitete er als Bauleiter an verschiedenen Orten. Amüsant, wie fehlendes oder unpassendes Material auf russische Art beschafft oder passend gemacht wurde. Nach einigen Jahren erreichte ihn ein Ruf an die Rostower Technische Hochschule als Professor für Baukonstruktionen. Als die deutschen Truppen Rostow am Don erreichten und sich später wieder zurückzogen, schloss er sich mit seiner Familie dem Rückstrom an und galt später in der DDR als Heimatvertriebener aus den deutschen Ostgebieten. Stets plagte ihn die Sorge, unter den sowjetischen Offizieren könnte ihn ein ehemaliger Student durch einen unglücklichen Zufall wiedererkennen. Es erfüllt mich noch heute mit ehrendem Erstaunen, von ihm auf diese Weise ins Vertrauen gezogen worden zu sein.
Meine Studienjahre waren zwar angefüllt mit ernsthaftem Bestreben und aufsteigendem Erfolg, ließen aber auch Raum für studentisches Lebensgefühl. Das Vordiplom feierten wir auf der Bastei in der Sächsischen Schweiz. Zur Eröffnung sangen wir gemeinsam „Gaudeamus igitur“, zogen später mit brennenden Fackeln auf Bergeshöhe, wo ein Kommilitone die „Bergpredigt“ verkündete.
Meine Unterkunft im Studentenheim konnte ich schon nach zwei Semestern mit einem Vierbettzimmer in einer alten Villa tauschen. Wiederum zwei Semester später bezog ich ein Privatzimmer bei einem Ehepaar. Der Mann war mir bestens bekannt, denn es war mein ehemaliger Trainer beim Fußballklub, sowohl in Riesa als auch später bei Tabak Dresden. Zufälle gibts. Als vier Jahre nach mir mein Bruder ebenfalls an der TH Dresden ein Studium für Radiochemie aufnahm, konnte ich ihm in Absprache mit meinen Vermietern das Zimmer überlassen, da es mir gelang, ein anderes Privatzimmer zu finden. Bei der Zimmersuche hatten es Erstsemester sehr viel schwerer als Altsemester, eine Privatunterkunft zu finden. Mein neues Zuhause war ein gut möbliertes Zimmer, allerdings mit einer Waschkommode am Bett. Dafür wurde ich aber von meinen beiden Wirtinnen, zwei alleinstehenden, schon etwas älteren Schwestern im Ruhestand, wie ein Herr Studiosus alter Prägung umsorgt. Nach dem Aufstehen ging ich gewöhnlich zur Toilette auf halber Höhe im Treppenhaus. Zurückgekehrt stand ein Kännchen mit heißem Wasser zum Nassrasieren neben der Waschschüssel. Etwas später, nie zu früh, wurde das Frühstück serviert und der Herr Studiosus begab sich gestärkt auf den Weg zur Universität. Die überaus fürsorgliche Betreuung erstreckte sich allerdings auch auf die übrige Zeit. Die Beaufsichtigung kannte keine Unterbrechung. Damenbesuche waren ohnehin strikt untersagt. Das letzte Semester war hauptsächlich für das Anfertigen der letzten Belegarbeiten und für die Vorbereitung der Diplomarbeit vorgesehen. Planmäßige Lehrveranstaltungen blieben nur noch für Nachzügler im Programm.
Die Einteilung des Tages oblag nunmehr der persönlichen Neigung und dem Vorwärtsstreben, sofern keine Wiederholungen anstanden. Einige Studienkameraden wohnten ganz in der Nähe, und so verabredeten wir uns mal beim einen, mal beim anderen zum geselligen Abend bei Schach, Skat, Plausch und selbstredend auch zum Junggesellentratsch und so manchen studentischen Träumen. Bier zu trinken war üblich, höherprozentigen Alkohol gab es nur zu ausgesprochenen Ausnahmesituationen. Ich habe nie einen betrunkenen Studienkameraden erlebt. Rauschgift war völlig unbekannt. Es war noch nicht einmal ein Thema. Über Politik sprachen wir selten, obwohl jeder von uns eine Vorstellung von der übereinstimmenden Grundüberzeugung des anderen hatte. Keiner wollte sein Studium leichtfertig gefährden, hielt gesellschaftspolitische Kritik in unserer Situation ohnehin für fruchtlos. Noch war es für einen normalen, intelligenten Kopf einigermaßen machbar und erträglich, im Strom der vorgegebenen Sichtweisen mitzuschwimmen. Der heutige Leser muss bedenken, wir gehörten zu den Überlebenden eines furchtbaren Krieges, unser Land war größtenteils zerstört, der Wiederaufbau hatte gerade begonnen und wir wollten als zukünftige Bauingenieure daran nach besten Kräften mitwirken.
Hin und wieder flog mitten in der Nacht ein Steinchen an meine Fensterscheibe. Unten stand meistens mein Kommilitone Paulchen und forderte mich auf, unverzüglich zu ihm zu kommen. Es fehlte der dritte Mann zum Skat. Der Trainingsanzug war schnell über den Schlafanzug gezogen und ich stand zur Verfügung. Hatte ich doch selbst Freude und Vergnügen am Skatspiel und der Geselligkeit. Gegen elf Uhr am Morgen machten wir uns dann auf zur Mensa, noch immer im Trainingsanzug, um uns zu stärken. Wieder im heimatlichen Quartier erschien eine meiner Wirtinnen mit erhobenem Zeigefinger und der Ermahnung: „Manfred, Sie leben wieder sehr unsolide.“ Es blieb bei dem Tadel, Konsequenzen hatte er jedoch keine.
Die Osterfeiertage 1960 verbrachte ich zusammen mit meinem Bruder bei unserer Mutter in Riesa. Nach dem üblichen Osterspaziergang auf dem Gröbaer Elbdeich war ein Besuch im örtlichen Kino geplant. Viele Mitbewohner schlossen ein Wochenende oder einen Feiertag mit einem besinnlichen Kinobesuch ab. Vorausgesetzt, ein akzeptabler Film stand auf dem Programm. Dieses Mal wurde „Fanny“ angeboten. Nach Schluss der Vorstellung standen noch einige Grüppchen zusammen und unterhielten sich angeregt über private Begebenheiten. Mit uns unterhielten sich ein mit unserer Mutter sehr gut befreundetes älteres Ehepaar und stellten uns seine Enkelin Sybille aus Berlin-Rahnsdorf vor. Ein sehr charmanter, aparter und dazu noch sehr hübscher Teenager mit strahlenden Augen kurz vor seinem sechzehnten Geburtstag. Sie gefiel mir auf Anhieb. Ich war aber völlig unvorbereitet, da mich das Studium total ausfüllte, und empfand leichte Hemmungen, einmal wegen ihrer Jugend und zum anderen wegen des zusprechenden Interesses meiner Mutter. Ja, so war ich nun einmal gewickelt. Meine Mutter kannte Sybille bereits von gelegentlichen Einkäufen bei ihr. Gefragt nach meinem Eindruck erfand ich die Ausrede, Sybille sei wohl eine sympathische Person, sie habe aber eine deutliche Knollennase. Meiner Mutter war meine Ausflucht sofort klar. Sie schwieg zwar, vereinbarte aber einen Familienbesuch bei Sybilles Großeltern anlässlich einer Fernsehübertragung von Goethes Faust schon am nächsten Abend. Brav saßen wir beieinander, die Gedanken ganz sicher nicht bei der Darbietung im TV. Diese Begegnung sollte sich als glückliche Fügung des Himmels erweisen. Sybille hat bis zum heutigen Tag mein weiteres Leben bestimmt, in Liebe, Zufriedenheit und Dankbarkeit. Näheres darüber etwas später auch von ihr.
Zurück in Dresden schlich sich eine „schöpferische Pause“ ein. Unversehens bemerkte ich im Fach Statik einige Lücken, die mein weiteres Vorankommen in diesem Fach hemmten. Meine Idee war: Ich musste etwas organisieren, was mich zwang, vermehrt zu arbeiten. Die Lösung: Ich bewarb mich am Lehrstuhl für Statik als Hilfsassistent zur Betreuung jüngerer Semester in Übungsstunden und wurde angenommen. Die Lösungen der gestellten Übungsaufgaben mussten anschließend von einem der Hilfsassistenten im Schaukasten des Lehrstuhls ausgehängt werden. Das war für mich der schweißtreibende, aber heilsame Zwang. Außerdem gab es ein willkommenes Salär. Nun, Ende gut, alles gut.
Zur Diplom-Abschlussfeier nach Ende des erfolgreichen Studiums versammelten wir uns zusammen mit unseren Professoren in einer Gaststätte an der Tharandter Talsperre. Ein eigens verfasstes Schattenspiel in mehreren Bildern schilderte das erlebnisreiche Studentenleben von der Immatrikulation bis zum Finale in Versform, erschaffen von einem eigenen, begabten Team. Das Stück trug den Titel „ Stud. ing. Flasche“. Mir kam die ehrende Auszeichnung zuteil, den Titelhelden zu spielen. Der Auszug im folgenden Kapitel soll es dem Leser nahebringen und ihn sicher auch erfreuen.
Den Höhepunkt der Feier bildete der symbolische Abschied von den Lehrfächern unserer Disziplin. Alle Teilnehmer einschließlich unserer Professoren, unserer Gäste und die Kapelle bestiegen um Mitternacht bereitstehende Ruderkähne und fuhren weit auf den See hinaus. Mitgeführt hatten wir für jedes Fach eine mit Steinen bewehrte Holzkiste, mit deutlicher Aufschrift. Unter Dankesworten und Musikbegleitung wurde nacheinander jede einzelne Kiste symbolisch und feierlich auf den Grund des Sees versenkt. Sollte das Holz widerstandsfähig genug sein, dann liegen unsere Reliquien noch heute dort unten.
„Stud. ing. Heinrich Flasche“– ein Schattenspiel
Amor hominis
Flasche hat sich vorgenommen,
heut zu einem Weib zu kommen. …
Jetzt fragt er, ob sie’s interessiere,
dass er an der TH studiere …
Doch als er nun auf Tröstung wartet,
da ist die Schöne schon gestartet.
Ganz anders ist hier cand. ing. Bock,
der hat die Hand schon unterm Arm,
das zeugt von ganz besonderem Charme.
Prüfung
Nach dieser kleinen Ouvertüre
büffelt er die Fachlektüre,
denn am Mittwoch, welche Qual,
muss er zur Prüfung noch einmal.
Ach, lieber Gott, hab doch Pardon
mit mir und mit dem Stahlbeton. …
Nach dergestalter Vorbereitung
naht sich für Flasche die Entscheidung.
Der gute Anzug wird geplättet,
mit Freunden wird um Bier gewettet,
dass man `ne Fünf baut, garantiert,
und dann wird prüfungswärts marschiert.
Am Ort der Handlung angekommen,
ist Flasche etwas arg beklommen.
Er wünscht da drinnen den zur Hölle
und sich selbst an dessen Stelle.
Doch nichts ist jetzt mehr aufzuhalten,
die Tür geht auf, er steht vorm Alten.
„Sie sind Herr Flasche? Sehr erfreut!“
So heuchelt man voll Freundlichkeit.
Drauf setzt man allerseits sich hin,
auf dass die Folterung beginn.
Und auf Herrn Flasche treu und bieder,
senkt drohend sich ein Schatten nieder.
Und salbungsvoll und voller Tücke
ertönt‘s: „Was ist denn eine Brücke?“
Die Frage trifft ihn wie ein Hieb,
er duckt sich und glotzt merklich trüb.
„`Ne Brücke? Das ist sozusagen“,
warum so Schweres immer fragen?
„Nun ja, man spricht von einer Brücke,
wenn im Gelände eine Lücke
– man nennt dies Tal – vorhanden ist,
welch Selbes man dann kunstvoll schließt.
Wobei man darauf achten muss,
dass, wenn im Talesgrund ein Fluss
sich tummelt, vielerorts derselbe,
als Beispiel denk ich an die Elbe,
naturgemäß sehr dankbar ist,
wenn man beim Bauen nicht vergisst,
die Brücke also anzulegen,
dass er sich drunter kann bewegen.
Zu welchem Zweck man oft bei Brücken
gar große Löcher kann erblicken.
Wobei man noch auf diese Art
sehr viel des Materials erspart.“
„Das reicht, Herr Flasche! Denn fürwahr,
die Antwort scheint mir ziemlich klar.“
Bejahend nickt der Assistent,
der nebenan am Tische pennt.
Und bloß damit er auch was spricht,
sagt er: „Mehr weiß ich selber nicht!“
So naht der große Augenblick,
der Delinquent wird rausgeschickt,
denn Ordnung muss ja schließlich sein.
Gleich drauf, da muss er wieder rein.
Was falsch war, wird ihm offeriert,
– man hat im Buch sich informiert –,
dann reicht man ihm mit Gönnermiene
`ne Vier, weil mehr er nicht verdiene.
Worauf er froh verlässt den Saal
Und denkt – ihr alle könnt mich mal.
Ein Wunsch, wie später er versteht,
der doch nicht in Erfüllung geht.
Finale
Dies jedoch war nicht der Schluss,
denn jetzt kommt nun, was kommen muss.
Flasche spricht zu Schulz und Staufen:
„Los, jetzt geh´n wir einen saufen.
nach der alten Väter Weise,
wandert man, nicht grade leise,
eben zu besagtem Zwecke
zur Kaschemme an der Ecke,
auf dass man nach bestand´nem Werke,
mit Korn und Bier sich gütlich stärke …
Flasche brüllt: „Ich geb `ne Runde!“
Freude herrscht ob dieser Kunde,
und mit einem Liter Bier,
feiert man die neue Vier …
Leicht verworren, die Gedanken,
sieht man sie nun heimwärts schwanken.
In der Tür vor lauter Lust
Singt Flasche noch aus voller Brust:
(– alle singen ein Studentenlied –)
Sybille:
Geboren in Sachsen, aufgewachsen in Berlin
Ich, Angela Sybille Tischer, wurde am 14. Mai 1944 in Riesa an der Elbe geboren. Meine Eltern Helmut und Ursula Tischer hatten im Februar 1943, noch während des Krieges, geheiratet und lebten in Leipzig.
Da mein Vater zu dieser Zeit als Soldat in Großenhain stationiert war, hielt sich meine Mutter zur Zeit meiner Geburt bei ihren Eltern Margarethe und Paul Marx in Riesa auf. Auch die Eltern meines Vaters, Camilla und Paul Tischer, lebten in Riesa an der Elbe. Ihr Wohnhaus befand sich tatsächlich in unmittelbarer Nähe zum Elbufer, das nur durch das Eisenbahngleis einer Werksbahn zur Mühle nebenan getrennt war.
Während meine Mutter als Einzelkind aufwuchs, war mein Vater jüngstes Kind von acht Geschwistern. Von allen neun Kindern erreichten aber nur sechs das Erwachsenenalter.
Mein Vater selbst konnte zum Zeitpunkt meiner Geburt leider nicht in Riesa sein, deshalb war die Unterstützung meiner Großeltern von großem Wert. Nach Überlieferung waren sie sehr stolz über die Geburt ihrer ersten Enkelin, und das blieben sie auch bis an ihr Lebensende. Die Liebe zu mir begann allerdings mit einem Schock. Am Tag nach meiner Geburt besuchten sie meine Mutter im Krankenhaus und wollten auch das kleine Würmchen Sybille begrüßen. Man fand mich aber nicht! Es war Krieg und alles ging einfach drunter und drüber. Letztlich wurde ich dann doch gefunden – in einem Pappkarton!
Da mein Kopf nach den Geburtsanstrengungen noch etwas deformiert war, behauptete mein Opa, das könne unmöglich seine Enkeltochter sein. Hat sich dann aber alles verwachsen. Glaube ich zumindest.
Auch Leipzig wurde von den Alliierten schwer bombardiert, daher blieb meine Mutter mit mir bis zum Ende des Krieges bei meinen Großeltern in Riesa. Im Zuge der Vertreibung aus den deutschen Ostgebieten (ein Kriegsverbrechen, das bis heute als solches nicht anerkannt ist) nahmen Oma und Opa Marx die vierköpfige Familie seiner Schwester aus Schlesien auf. Die Wohnverhältnisse in einer Dreizimmerwohnung waren dadurch sehr beengt, und da unser Haus in Leipzig in einer Trümmerstraße zum Glück nicht betroffen war, zogen meine Mutter und ich zurück nach Leipzig.
Mein Vater geriet zu dieser Zeit vorerst in amerikanische Gefangenschaft, wurde anschließend von den Sowjets „übernommen“ und nach sechs Wochen im KZ Sachsenhausen nach Tiflis in Georgien verschleppt. Vier lange Jahre musste er unter schwierigsten Umständen und Bedingungen dort verbringen, ohne ein Lebenszeichen geben zu können. Auch für die Daheimgebliebenen eine unerträgliche und unmenschliche Zeit. Nur einer geringen Anzahl der Kriegsgefangenen war eine Heimkehr, oftmals schwer gezeichnet und krank, überhaupt möglich. Mein Vater gehörte zu den wenigen Glücklichen, die 1949 nach Hause zurückkehren durften. Er war körperlich unversehrt, das Aufarbeiten der seelischen Wunden der Gefangenschaft sowie der Bilder der neben ihm im Feld gefallenen Kameraden hat aber noch viele Jahre gebraucht.
Immer wieder hat er uns über diese Zeit seine Erlebnisse geschildert. Das war sicher seine Art, diese schlimme Zeit zu verarbeiten.
1949 kehrte er also heim. Fünf Jahre hatte ich mit meiner Mutter allein verbracht und mit ihr zusammen im Schlafzimmer in einem Bett geschlafen. Ich kann mich noch heute daran erinnern, wie verletzt ich war, nun allein in einem anderen Raum schlafen zu müssen, und ein „fremder“ Mann durfte neben Mutti meinen Platz einnehmen. Aber auch für meinen Vater war es nicht einfach, denn an meinen ersten frühkindlichen Entwicklungsjahren hatte er nicht teilnehmen dürfen. Nach einer kurzen Übergangszeit spielte sich alles ein, Vati wurde akzeptiert und es begann ein normales Familienleben.
Auch außerhalb der Familie normalisierte sich das Leben auf niedrigem Niveau. Vati bekam Arbeit als ausgebildeter Kaufmann in der Farbenfabrik Wolfen, was eine tägliche Bahnfahrt von Leipzig nach Wolfen bedeutete. Aber es gab ein regelmäßiges bescheidenes Einkommen.
Wovon Mutti mit mir die Jahre während Vatis Abwesenheit gelebt hat, ist mir leider nicht bekannt; ich hatte sie nie danach gefragt. Ich kann mir vorstellen, dass sie so eine Art Soldatengehalt bekommen hat. Wahrscheinlich wurde sie auch von ihren Eltern unterstützt, wobei diese auch ihr gesamtes Sparvermögen verloren hatten. Nach dem Krieg gab es eine Währungsreform – sprich: Man wurde enteignet.

Bild 2 – Sybilles Einschulung im September 1950
1950 begann für mich mit meiner Einschulung ein neuer Lebensabschnitt. Die Schule hatte die Bombardierung nur zur Hälfte überstanden, aber im unversehrten Teil konnte wieder Unterricht stattfinden. Es musste halt etwas zusammengerückt werden. Unsere Lehrer waren jedoch hoch motiviert und konnten uns Schüler schnell fürs Lernen begeistern. Das ABC erlernten wir nach alter Väter Sitte, Ganzheitsmethode und Legasthenie waren noch unbekannt. Auch stand das Einmaleins auf dem Lehrplan, mit Mengenlehre mussten sich erst unsere Kinder plagen. Bei ihnen war zwar auch wieder Kopfrechnen angesagt, während heute schnell mal zum Handy gegriffen wird.
1952 wurde mein Bruder Matthias geboren. Oma Camilla kam hochbetagt mit der Bahn von Riesa nach Leipzig angereist, um den damals letzten Stammhalter der Familie Tischer in Augenschein zu nehmen. In dieser Generation ist er auch der einzige Nachkomme der Familie Tischer geblieben. Zu dieser Zeit war gewöhnlich die „Thronfolge“ männlich, und somit rückte ich als Erstgeborene automatisch ins zweite Glied.
Zur gleichen Zeit wurde Vati von seiner Firma nach Berlin (natürlich Ost, denn Leipzig gehörte zur sowjetischen Besatzungszone) versetzt und übernahm als kaufmännischer Leiter das Außenbüro der Farbenfabrik Wolfen. Nach mehrmonatigem Pendeln zwischen Leipzig und Berlin (immer mit der Bahn, denn ein eigenes Auto oder ein Firmenwagen waren bis dahin außerhalb des Vorstellbaren) ging Vati auf Wohnungssuche, was im immer noch bombenzerstörten Berlin eine fast unlösbare Aufgabe war.
Vor dem Krieg war Vati allerdings stolzer Besitzer eines eigenen Autos einschließlich eines auch damals schon notwendigen Führerscheins. Am Ende des Krieges beschlagnahmten die Russen den Wagen und haben das Auto während der Zeit, als Vati in Gefangenschaft war, einfach verkauft. Bei einem Besuch in Riesa sah Vati sein Auto am Straßenrand und machte den Fahrer ausfindig. Es war der neue Besitzer, der den Wagen von den Russen gekauft hatte. Somit hatte Vati keinen Anspruch mehr!!!
Zurück zur Wohnungssuche:
Er hatte Glück und ergatterte eine schöne Zweieinhalbzimmerwohnung in einem Zweifamilienhaus – allerdings für damalige Verhältnisse jwd. Der unmittelbare Zugang zu Wald und Wasser (Müggel- und Dämeritzsee) war für uns Kinder einfach paradiesisch und ließ uns in nahezu unberührter Natur aufwachsen. Im Sommer ging es mit den Eltern und Großeltern in die Beeren und Pilze, die damals noch reichlich vorhanden waren. Oma und Opa Marx verbrachten regelmäßig ihren dreiwöchigen Urlaub bei uns, und wir Kinder freuten uns immer riesig auf ihren Besuch. Wie das Schlafproblem mit sechs Personen in unserer Wohnung gestaltet wurde, ist mir heute nicht mehr in Erinnerung, es wurde aber wohl gelöst und wir hatten immer eine wunderbare Sommerzeit.
Bei bedecktem Himmel ging es also in die Pilze und die Ausbeute war immer reichlich, sodass auch für den Winter eingeweckt werden konnte. Manchmal besuchte uns auch eine entfernte Cousine aus Niesky und zeigte uns als offizielle Pilzberaterin viele uns unbekannte Pilze. Dazu gehörten auch die giftigen, damit wir vor Verwechslungen sicher waren. Dieses Wissen war uns noch viele Jahre später sehr hilfreich, als wir die schwedischen Wälder erkundeten.
Bevor wir nun diese wunderbare Umgebung in Rahnsdorf erleben konnten, stand erst einmal der Umzug von Leipzig nach Berlin an. Vati war schon ein Jahr vor der Familie in seiner neuen Arbeitsstelle tätig und wohnte die Woche über bei einem Arbeitskollegen und seiner Frau. Am Wochenende fuhr er zu uns nach Leipzig. Mit der Übersiedlung nach Berlin im Februar 1953 begann nun auch ein wirkliches Familienleben für uns, die Wochenenden konnten genossen werden, wobei samstags noch bis mittags gearbeitet werden musste. Auch wir Schüler drückten bis zum Schulabschluss jeden Samstag die Schulbank.
Meine Umschulung nach Berlin bereitete mir keine Schwierigkeiten, zumindest was den Lernstoff betraf. Allerdings war ich mit meinem wohl breiten Sächsisch ein Exot. Die „herzliche“ Art der Berliner Gören machte es mir aber leicht, mich innerhalb kurzer Zeit auf „icke, icke“ umzustellen. Eigentlich ist Sächsisch ja ein liebenswerter Dialekt (was nicht viele so sehen), und bei Bedarf kann ich es heute noch sprechen und viele Begriffe auch verstehen.
Mein Bruder Matthias war beim Umzug erst drei Monate alt und hatte noch keine Sprachprobleme. Allerdings weigerte er sich lange, überhaupt zu sprechen, er wurde sogar mal beim Arzt vorgestellt, weil meine Eltern sich Sorgen machten. Mit gut zweieinhalb Jahren kam dann die Erlösung und er sprach sofort ganze Sätze!
Mein Einleben in die neue Schule gelang also ohne Probleme, und die ersten Sommerferien wurden intensiv am Müggelsee verbracht. Da ich als Leipziger Stadtkind bis zu unserem Umzug keine Möglichkeit hatte, schwimmen zu lernen, bot sich nun dazu die erste Möglichkeit, zumal ich mit meinen Schulkameraden auch allein ohne meine Eltern zum See fahren wollte. Also wurde ich zum Schwimmunterricht angemeldet und kam „an die Angel“. Auf einer schwimmenden Insel (unter dem Begriff Prahm im Strandbad bekannt) war ein Ausleger wie eine steife Angelrute befestigt. Statt Angelschnur hing am vorderen Ende eine Schlinge an der langen Leine, die um die Brust gelegt wurde. So wurden nach den ersten Trockenübungen die ersten Schwimmversuche im tiefen(!) Wasser gemacht. Beim drohenden Abgluckern wurde man sofort nach oben gezogen. Ich fand es eine tolle Erfindung, sie wurde aber schon nach einiger Zeit aus mir unbekannten Gründen nicht mehr praktiziert. Jedenfalls präsentierte ich bereits nach zwei Wochen stolz meinen Fahrtenschwimmer. So ausgestattet konnten wir Kinder jeden Sommer im und am Wasser ausgiebig genießen. Ich entwickelte mich zu einer ausgesprochenen Wasserratte! Nach Schulschluss, wenn die Hausaufgaben erledigt waren, fand sich immer eine Clique fürs Strandbad. Damals war das Wasser auch noch glasklar und sauber. Waren wir in den Ferien den ganzen Tag im Bad, so packte mir Mutti immer acht bis zehn Schrippen ein. Abends war ich dann so kaputt, dass ich die zwei Kilometer kleine Steigung nach Hause mit dem Rad zu unserer Wohnung am Püttbergeweg kaum geschafft habe. Das Fahrrad war ein alter „Brennabor“ aus Vorkriegszeiten, natürlich ohne Gangschaltung. Diese gabs damals noch nicht. Das Rad bestand aus Rahmen, bereiften Rädern, Lenkstange, hartem Sattel, Lampe mit Dynamo und Klingel! Aber toll war es dennoch, denn die Alternative war Laufen. Busfahren war zwar billig, aber es fuhr kaum einer und wenn, dann war er überfüllt und oft wurde man dann gar nicht mehr mitgenommen.
Da dieses von einem Freund meines Vaters geschenkte Fahrrad (wie schon erwähnt ein Vorkriegsmodell) schon deutliche Rostspuren aufwies, musste langsam an eine Neuerwerbung gedacht werden. In Osten gab es zwei Fabrikate von Fahrrädern. Ein „Diamant“ für 450 Ostmark oder ein „MIFA“ für 250 Ostmark. Beides waren Festpreise, genannt EVP (Endverbraucherpreis). Mit zwölf Jahren fing ich an zu sparen, meine Eltern konnten es mir nicht finanzieren. Meine Großeltern sponserten mich für gute Zeugnisnoten, und für jeden Brief, den ich ihnen schrieb, gab es drei Mark. Da ein Telefon zu bekommen die absolute Ausnahme war, wurden Oma und Opa auf diese Weise recht ausführlich unterrichtet. Ja, damals schrieb man noch lange Briefe.
Da Vati schon gleich mit unserem Umzug nach Berlin geschäftlich ein Telefon bekam, waren wir natürlich sehr glücklich. Von meinen Klassenkameraden hatte meines Wissens nur noch Christine ein Telefon, ihre Eltern hatten einen Kohlenhandel. Um am Nachmittag mit meinen anderen Freundinnen zu kommunizieren, waren wir also gezwungen, uns zu verabreden und zu treffen. Gespielt haben wir draußen, bis es dunkel wurde und der Hunger uns nach Hause trieb.
Nun zurück zum Fahrrad. Eine weitere Möglichkeit der Finanzierung war das Stopfen von Socken. Herren- und Kindersocken hatten damals viele Löcher und stets neue Socken zu kaufen war einfach nicht drin. Da Mutti viele andere Sachen zu flicken hatte (mein Bruder Matthias war inzwischen im Hosenverschleißalter), bot ich meine Unterstützung an. Natürlich nicht kostenlos! Kleine Löcher wurden mit 1 (einem) und große Löcher mit 2 (zwei) Pfennig vergütet. So kam ein Groschen zum anderen und eine Mark zur anderen. Am Ende konnte ich so gut stopfen, dass ich mich sogar zur gewerblichen Kunststopferin hätte melden können.
Zu meinem 15. Geburtstag stand dann das neue „MIFA“-Fahrrad vor der Tür. Eltern und Großeltern hatten den noch relativ kleinen Fehlbetrag ergänzt. Diesmal war das Rad nun auch mit einer Drei-Gang-Schaltung ausgestattet! Bei so langer Ansparzeit und so viel Eigenanteil habe ich es gehegt und gepflegt und bis zu meinem Auszug wie meinen Augapfel gehütet. Ein Fahrrad zu besitzen war schon ein kleiner Schatz, Fahrraddiebstähle waren zwar recht selten, kamen aber doch vor.
Das Schulsystem in der DDR bestand aus einer achtklassigen Grundschule. Mit überdurchschnittlich guten Noten gab es nach erfolgreichem Abschluss die Möglichkeit zum Besuch der vierjährigen Oberschule. Noten allein genügten jedoch nicht, sowohl die Schüler als auch die Eltern mussten sich schon als linientreue Staatsbürger zu erkennen geben.
Die Regel war, mit 14 Jahren nach Abschluss der Schule einen Beruf zu erlernen. Die Plätze auf der weiterführenden Oberschule bis zum Abitur waren sehr beschränkt und in einem Arbeiter- und Bauernstaat vorzugsweise für Kinder dieser Klasse vorgesehen. Vati war als kaufmännischer Angestellter, wenn auch in einem volkseigenen Betrieb, weder das eine noch das andere. So fiel ich nicht in diese Kategorie, obwohl ich Zweitbeste der Klasse war.
Kurz vor dem Ende meiner regulären achtjährigen Schulzeit wurde die sogenannte Polytechnische Oberschule (10 Klassen) – im Gegensatz zur Erweiterten Polytechnischen Oberschule (12 Klassen) – eingeführt. Im Westen waren das traditionell Realschule und Gymnasium.
Da ich weder Junger Pionier noch FDJ-Mitglied war, blieb vorerst mein Traum, weiter in die Schule gehen zu können, unerfüllt. Engste Verwandte meines Vaters, sein Bruder und zwei Schwestern, lebten im Westen. Ein Umstand, der uns im täglichen Leben oft hinderlich war. Außerdem war unsere Fernsehantenne nach Westen gerichtet, was erwarten ließ, dass wir dem Aufbau des Sozialismus nicht mit Nachdruck dienten. Aber Vati ließ nicht locker, für meine weitere Schulbildung zu kämpfen. Nach einem mehrstündigen Gespräch mit meinem damaligen Schuldirektor (straffer Parteigenosse der SED) konnte Vati erreichen, dass ich die „Realschule“ besuchen durfte. Besser als nichts, aber meinen Wunsch, Sprachen zu studieren, musste ich begraben, da mir das Gymnasium verwehrt blieb.
Mittlerweile wurden die Einschränkungen im täglichen Leben und in der Zukunftsplanung immer umfangreicher, sodass in der Familie über eine Umsiedlung in den Westen immer öfter nachgedacht wurde. Aber innerhalb Berlins gab es noch Freizügigkeit, und die Hoffnung, dass die Teilung Deutschlands bald ein Ende haben könnte, ließ meine Eltern immer noch zögern. Auch fiel Mutti der Gedanke nicht leicht, ihre Eltern allein in Riesa zurückzulassen, war sie doch die einzige Tochter.
Der Familienrat beschloss dann, ich solle eine Ausbildung beginnen und abschließen, dann würde ein Neuanfang im Westen leichter fallen. Nun stand auch bei mir wie bei allen jungen Menschen die Frage der Berufswahl an. Da ich schon damals gerne gezeichnet habe und mich auch für Kunst interessierte, erschien mir das Berufsbild der Schaufensterdekorateurin als recht geeignet, zumal es meinen praktischen und handwerklichen Veranlagungen sehr entgegenkam. Da man sich in der DDR auch sprachlich gerne von der BRD absetzte (ein Brathähnchen etwa nannte sich dort Broiler), hieß die genaue Berufsbezeichnung Gebrauchswerber. Mein Schulabschlusszeugnis war sehr gut, aber für die Lehrstelle musste doch eine Eignungsprüfung abgelegt werden.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.