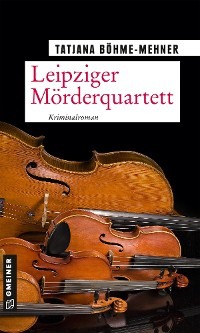Kitabı oku: «Leipziger Mörderquartett», sayfa 2
4
Inzwischen machte es für Anna auch keinen Sinn mehr, der Vibration des Hochdruckreinigers nachzuspüren. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal so durch den Wind gewesen war, oder besser, dass sie jemals zuvor so durch den Wind gewesen war. Klebrigkeit, das Mozart-Debakel und dann Ha-ba-kuk und der Rotwein auf ihrem Kleid – das waren deutlich mehr außergewöhnliche Vorfälle als üblich in ihrem Job.
Der Spot flackerte noch immer. Anna stellte sich die Frage, ob das bei LEDs überhaupt möglich war und ob ein moderner Scheinwerfer noch ohne LEDs funktionierte.
Im Saal verdichtete sich die Anspannung spürbar, ein untrügliches Zeichen, dass die Musiker des Kleistenes-Quartetts im Anmarsch auf die Bühne waren. Mit Anna hatten sie gemein, dass dieser Samstag auch nicht ihr Tag war. Der Bratscher Thorsten Steinmüller hatte es tatsächlich fertig gebracht, in der »Kleinen Nachtmusik« den Faden zu verlieren. Ein lebendiger Bratscherwitz. Anna stellte amüsiert fest, dass dieser Tag so etwas wie ein Tag der Bratscher war: erst der Fauxpas Steinmüllers, dann die nasse Begegnung mit Habakuk C. Brausewind. Ein schräger Zufall, denn die Zahl der Bratscher, mit denen man es in ihrem Job zu tun bekam, war denkbar gering, verglichen mit Pianisten, Geigern, Bläsern oder gar Komponisten. Ironie des Schicksals! Aber folgte man dem Klischee, so musste man sich sagen: Kein anderer Musikertyp wäre besser geeignet gewesen, ihr das Kleid und die »Kleine Nachtmusik« zu versauen.
Anna Schneider schämte sich für diesen Gedanken und bezichtigte sich eines musikalischen Chauvinismus, der jemandem wie ihr nicht gut zu Gesicht stand. Als Journalistin war sie verpflichtet, vorurteilsfrei zu Werke zu gehen, was besonders schwer war, wenn man einen Komponisten oder ein ganzes Genre oder den Klang eines bestimmten Instruments nicht mochte. Wie sollte man da offen und ohne betrübliche Vorahnungen ins Konzert gehen? Den Klang der Bratsche jedoch mochte Anna, genau wie Mozart und Brahms. Also konnte der Abend durchaus noch eine positive Wendung nehmen.
Wie die Umsitzenden wusste Anna, was sich gehört: Sie applaudierte den Quartettspielern artig, die sich in einer bemerkenswerten Umständlichkeit miteinander, nebeneinander und aneinander vorbei an ihre Plätze manövrierten. Anna ertappte sich bei dem Gedanken, dass das im Mendelssohnsaal weniger umständlich gewesen wäre. Warum bitteschön mussten jetzt alle noch einmal an Stühlen und Notenpulten herumruckeln? Na endlich …
Anna würde heute mit Sicherheit nicht mehr in den Rang eines Zen-Meisters erhoben werden. Sie hoffte, dass ihre Geduld ausreichte, um den Konzertabend verhaltensunauffällig zu absolvieren.
Doch irgendjemand wollte das anscheinend verhindern. Welcher Geisteskranke war auf die Idee verfallen, einen albernen Drehscheinwerfer – so bezeichnete das Unterbewusstsein der Musikexpertin die angesagten Moving Lights des Clubs – lustig übers Publikum kreisen zu lassen, als säße Kleistenes unter einem Leuchtturm und die Zuhörer wären der wogende Ozean? Wenigstens war Brahms Norddeutscher und hatte Leuchttürme gekannt. Innerlich schüttelte Anna den Kopf über das In-and-Out. Auf wessen Mist sollte sonst so ein Schwachsinn gewachsen sein? Nichts anderes war das in ihren Augen. Obendrein verursachte das Teil, während es sich bewegte, unüberhörbare Geräusche.
Anna versuchte, keine weiteren Gedanken darauf zu verschwenden, denn angesichts von etwa 70 Druckzeilen, die ihr für ihre – wohlgemerkt musikalischen – Erkenntnisse zur Verfügung standen, wäre es ungebührlich, über das Licht zu schreiben. Hätte sie bloß eine Sonnenbrille dabei – das wäre im versauten Kleid auch egal …
Jetzt hoben die vier gemeinsam den Bogen als Zeichen des Beginns. Gleich würden sie diesen auf die Saiten setzen, um die dicke Luft des In-and-Out mithilfe von Schallwellen umzuschaufeln. Doch dazu kam es nicht.
Es gab einen Riesenschlag, einen wie er in klassischen Konzerten nicht vorkommen sollte. Anna konnte nicht sagen, ob es zuerst rumste oder das Licht ausging oder die allgemeine Panik, das jämmerliche Geschrei aller Anwesenden einsetzte. Das hatte vermutlich auch damit zu tun, dass sie noch immer nicht auf ihre eigentliche Aufgabe konzentriert war und sich, als es passierte, gerade fragte, aus welchem Grund dieser alberne Drehscheinwerfer nun auch noch so unelegant schaukelte. Wahrscheinlich wurde Anna allmählich paranoid, was heute kein Wunder mehr wäre.
Dass der Scheinwerfer sich nach dem Schaukeln aus seiner Befestigung löste und zur Ursache des allgemeinen Drunter-und-Drübers wurde, sah sie genauso wenig wie alle anderen. Denn mit dem Sturz des Scheinwerfers ging das Licht aus.
5
»Aaaaaahhhhhh!!« – »Ein Arzt! Ist hier ein Arzt??« – »Polizei!« – »Hilfe!!!«
Angesichts dessen, was jetzt geschah, erwies es sich als keine gute Idee, das Saallicht wieder einzuschalten. Der Anblick, der sich auf dem Konzertpodium bot, war auch für Hartgesottene nicht leicht zu ertragen, schien einem Horrorfilm entsprungen. Nicht nur, dass die Bratsche von Thorsten Steinmüller zu Kleinholz gemacht worden war, der Musiker selbst hatte den besagten Scheinwerfer mit einer so beachtlichen Wucht und Präzision auf seinen Kopf bekommen, dass es diesen wie einen Nagel in den Steinmüller’schen Rumpf geschlagen hatte und der Markenscheinwerfer der Firma Bero mit Logo jetzt an Kopfes Stelle zwischen den Schultern ruhte.
Wie eingefroren saßen die drei übrigen Musiker um das Opfer, während das Personal vom In-and-Out mit bemerkenswerter Effizienz eine Massenpanik verhinderte. Anna beobachtete die Szene wie durch eine Glocke und stellte fest, wie gut es war, dass der Scheinwerfer nicht mehr leuchtete, wobei sie sich die Absurdität der Szene vorstellte. Sie sah, dass erstaunlich wenig Blut im Spiel war, wohl, weil der Scheinwerfer wie eine Art Stöpsel oben auf Steinmüller saß. Steinmüller wiederum hatte – wenn auch etwas lasch – ebenfalls die Sitzposition beibehalten.
»Bitte bewahren Sie Ruhe und bleiben Sie auf Ihren Plätzen, ein Notarzt ist schon unterwegs!«
Als ob der noch etwas ausrichten könnte! Anna wunderte sich selbst über ihren kaltschnäuzigen Hintergedanken und schüttelte den Kopf, froh, dass sie das mit dem eigenen noch tun konnte.
Ein schrulliges spitzbärtiges Männchen sprang um den reglosen Steinmüller herum. Es hatte sich sofort bei dem Ruf nach einem Arzt mühselig, aber durchaus effizient durch die viel zu engen Sitzgelegenheitsreihen gequetscht. Man hatte für das Konzert nicht nur Stühle, sondern auch Sessel, Hocker und Sofas – Markenzeichen des In-and-Out – herangeschleppt. Das Männchen, offenbar Arzt, zählte zu den ebenfalls unpassend gekleideten Klassikfreaks – der Smoking wäre sogar für den Mendelssohnsaal zu dick aufgetragen gewesen. Besonders damit errang der bemühte Ersthelfer jedoch Annas unterbewusste Sympathien.
Das Männchen schüttelte den Kopf, nachdem es den Bratscher mehrere Male umrundet und am herabhängenden Bratscherarm keinen Puls mehr gefühlt hatte.
Den Notarzt brauchte eher Sebastian Mönkeberg. Der zweite Geiger war aus seiner Schockstarre direkt in eine Ohnmacht gefallen und wurde in bemerkenswerter Routine und Eile von den mittlerweile eingetroffenen Rettungskräften fortgetragen, zumindest verschwand er recht schnell aus dem Sichtfeld. Überhaupt ging man jetzt dazu über, die grausige Szenerie vor den Augen der Betrachter zu verbergen.
Mit den Rettungssanitätern war auch eine beachtliche Zahl an Polizisten in den Saal gekommen. Diese forderten abermals auf, Ruhe zu bewahren und auf den Plätzen zu bleiben.
Anna klebte im wahrsten Wortsinne in ihrem Sessel und ging zu etwas über, das sie so gut wie nie tat: Sie dachte gar nichts mehr. Nicht, dass sie nicht mehr in der Lage gewesen wäre, einen Gedanken zu fassen, vielmehr war es eine bewusste Entscheidung angesichts der bizarren Ereignisse, denen Anna an diesem Abend ausgeliefert war. Außerdem wäre sie ansonsten unwillkürlich in einen Modus verfallen, in dem die Journalistin bereits an Formulierungen und sprachlichen Bildern gefeilt hätte. Sollte sie in der Redaktion anrufen, um zu sagen, dass sich hier im In-and-Out ein spektakuläres Unglück ereignet hatte? Wahrscheinlich schon, mit Sicherheit sogar. Doch erstens wusste Anna Schneider aus einschlägigen Erfahrungen in diesem Club, dass sie hier keinen Handy-Empfang hatte, und zweitens war sie von Ordnungskräften ausdrücklich dazu aufgefordert worden, auf ihrem Platz zu bleiben – journalistischer Auftrag hin oder her. Jetzt war es ohnehin zu spät, der Polizeifunk dürfte längst seine Schuldigkeit getan haben. Den hörten die Kollegen im Lokalen mit großer Begeisterung ab, obwohl das illegal war. Die offensichtlich maroden Sicherheitsvorkehrungen im angesagten In-and-Out waren eindeutig ein Thema fürs Lokale. Im Lokalen wollte Anna auf keinen Fall landen. Da war ihr der intellektuelle Anspruch des weit weniger rezipierten Kulturteils lieber, auch wenn sie sich regelmäßig darüber aufregte, dass es genau an diesem Anspruch fehlte.
Anna hatte ihre Nicht-denk-Haltung also längst aufgegeben, um für sich einfallsreich zu rechtfertigen, warum sie die Redaktion nicht ins Bild gesetzt hatte. In dem Moment erklomm ein ansprechend unauffällig gekleideter, attraktiver Mittdreißiger die halb verdeckte Szene und richtete das Wort an die allmählich etwas enervierten Besucher.
Er sei Kriminalhauptkommissar Schmiedinger und bitte alle, so lange im In-and-Out zu bleiben, bis die Kollegen in Uniform die Personalien zum Zwecke etwaiger Zeugenbefragungen erfasst haben. Man möge ihnen gleich einige Fragen beantworten, das sei wichtig bei einem so dramatischen Unglücksfall, weil jetzt die Eindrücke noch frisch und unverfälscht seien.
Was sollte Anna gesehen haben? So traurig es war … Licht aus … Licht an … Scheinwerfer ab. Anna wurde langsam wieder Anna, und die hatte heute endgültig die Nase voll. Mehr Pietät machte den armen Thorsten Steinmüller auch nicht mehr lebendig. Anna wollte nur noch nach Hause. Den Terrassenplan hatte sie längst gestrichen – immerhin wartete das Publikum im stickigen In-and-Out mittlerweile schon so lange, dass man zwei Akte von Wagners »Götterdämmerung« hätte hören können.
6
Wenigstens saß Anna dicht an der Tür, vermutlich würden die Befrager dort anfangen. Ein Gedanke, der sich als der nächste Irrtum erwies, denn die Polizisten arbeiteten sich vom Podium nach außen. Es dauerte eine weitere Stunde, bis Anna artig ihren Ausweis zeigte und zu Protokoll gab, was sie wahrgenommen hatte – also nicht viel. Dass der unselige Steinmüller aus dem Leben geschieden war, ohne eine Chance zu bekommen, den fatalen Bratscherfehler durch eine nachfolgende musikalische Leistung zu relativieren, tat ja hier nichts zur Sache. Das würde nicht einmal Platz in einem Nachruf finden, denn in solchen Texten wurde nicht über Fehler des Verstorbenen geschrieben.
Die junge Uniformträgerin dankte – wie oft sie sich wohl an diesem Abend immer wieder dasselbe anhören musste? Am Ende interessierte sich nur noch die Versicherung dafür, falls das In-and-Out eine solche hatte. Der Club war an diesem Abend in der Gunst der Kritikerin keinesfalls gestiegen. Das ziemlich spießige Klischee von Oberflächlichkeit und Nachlässigkeit solcher Clubs, das Anna wie auch immer entwickelt hatte, wurde an diesem Abend noch verstärkt.
Bevor sie gehen durfte, stellte die Polizistin noch eine Frage – was das auf Annas Kleid sei. Der Rotwein. Den hatte Anna fast vergessen. Sie rang sich zu einer absurden Erklärung durch, weil es ihr zu dämlich erschien, zu sagen, dass ihr ein Mensch namens Habakuk C. Brausewind ohne Vorwarnung Rotwein übers Kleid gegossen hatte. Blödsinn! Niemand gab eine Vorwarnung, bevor er einem Rotwein übers Lieblingskleid schüttete. Gut, dass sie das nicht gesagt hatte!
Die Polizistin machte sich eine Notiz, während Anna ihren Schritt endlich Richtung Tür lenken konnte. Langsam leerte sich der Saal. Kraftlos schlichen die unfreiwilligen Zeugen eines bizarren Unglücks von dannen.
Da hörte Anna in ihrem Nacken deutlich den eigenen Namen. Die Stimme kam ihr bekannt vor. Eine gefühlte Ewigkeit, aber eigentlich nur knapp drei Stunden war es her, dass sie die feucht-anregende Bekanntschaft dieses Herrn gemacht hatte. Habakuk C. Brausewind – die Lautfolge entlockte Anna ein müdes Lächeln.
»Anna, ich darf doch Anna sagen? Würden Sie so freundlich sein …«
Den Rest nahm Anna nicht mehr wahr, denn gerade wurde der Metallsarg an ihnen vorbeigetragen. Das hatte sie bisher nur im Fernsehen oder auf Fotos gesehen, die die Redaktionstische anderer Ressorts zierten. Unweigerlich dachte sie an ihr Vergehen: Sie hatte die eigene Redaktion nicht informiert! Keine gute Werbung für eine Journalistin. Fragend starrte sie Habakuk an, der sich höflich zu ihr herunterbeugte.
»Ihre Karte. Wegen der Reinigung. Ich will den Schaden wiedergutmachen.«
Reflexartig zog Anna ihre Visitenkarte aus der Tasche und gab sie Habakuk – lächelnd, aber abwesend nickend. Sie wollte einfach nach Hause.
7
Es war das Brodeln des Wasserkochers, das Anna aus ihren Gedanken riss. Nicht das erste Mal an diesem Sonntagmorgen. Schon die vierte Tasse Klarer-Kopf-Tee sollte ihr helfen, einen roten Faden für ihren Text zu finden. Diesen Faden musste sie haben, bevor sie Kramer zurückrief. Der hatte den Rückruf mittlerweile neunmal auf ihrem Anrufbeantworter eingefordert. Viermal bereits gestern Abend. Nein, sie hatte weder gut noch lange geschlafen.
Als sie sich aus dem In-and-Out geschleppt hatte und endlich eine riesige Brise Frischluft schnappen wollte, hatte ihr die Signalfunktion ihres Handys unmissverständlich klargemacht, dass hier draußen das Leben weitergegangen war. Sieben neue Nachrichten; das war auch für die Journalistin eher ungewöhnlich, noch dazu um diese Uhrzeit. Zweimal ihre Mutter, seit vier Tagen hatte Anna vergessen, sie davon in Kenntnis zu setzen, dass sie noch lebte, es ihr gut ging und sie viel zu tun hatte. Einmal die automatische Ansage vom Sushi-Laden, der sie freundlich darauf aufmerksam machte, dass sie den einzigartigen Gutscheincode für treue Kunden durch Nichtstun aufs Spiel setzte. Zwei Maki gratis seien bald verloren. »Nur noch bis Happy Wednesday!«, hatte die Ansagestimme mit ihrem asiatischen Akzent gesagt. Ob man die Akzente von Chinesen, Koreanern, Japanern, Vietnamesen im Englischen oder Deutschen eigentlich genauso unterscheiden konnte? Schließlich erkannte Anna auch am Akzent, ob sie es mit einem Italiener, Franzosen oder Engländer zu tun hatte. Ob ihr Gutschein tatsächlich von einem Japaner kam? Im Moment wohl ihr geringstes Problem …
Die Frischluft hatte Annas graue Zellen wieder in Gang gebracht und sie hatte sich entschlossen, über die Verwendung des Gutscheins zu entscheiden, falls sie nächste Woche ihren Job noch haben würde. Die anderen vier Anrufe waren nämlich von Kramer gewesen. Andreas Kramer, Ressortleiter Kultur beim »Täglichen Anzeiger«. Normalerweise war das Oberhaupt des hiesigen Feuilletons entspannt, ein Allrounder ohne spezielles Fachgebiet; er konnte zu allem etwas sagen – Literatur, Theater, bildende Kunst. Ein bisschen auch zur Musik, aber da überließ er Anna gern das Feld und vertraute dem aus einem langen Musikwissenschaftsstudium erwachsenen Spezialwissen, das er hin und wieder gern monierte, weil man an den Leser denken müsse und nicht jeder die Lebensdaten von Beethoven auswendig kenne. Zeitgemäßer, spannender Journalismus war sein Schlagwort im Schlepptau von Chefredakteur Schrottheimer, der, wie aktuell unter Chefredakteuren nicht ungebräuchlich, von Spezialwissen recht wenig hielt. Genau wie von kleingliedriger Ressortstruktur und der Versorgung von kaum anzeigenrelevanten Minderheiten. Mit Anna persönlich hatte jedoch keiner der beiden ein Problem, und deshalb hatte die Musik noch immer ihren Platz im »Täglichen Anzeiger«. Auch Anna kam mit beiden klar. Bis jetzt. Denn Anna wusste, dass man sich mit Mitte 30 einen solchen Anfängerfehler nicht leisten konnte. Da machte es wenig Sinn, sich mit den ungewöhnlichen Umständen des gestrigen Tages herauszureden. Fehlende Professionalität wäre das Geringste, das man ihr vorwerfen würde.
Kramers erster Anruf hatte noch besorgt geklungen. Wie Anna es vermutet hatte, hatten die Lokalen den Polizeifunk ausgeschlachtet. Harald, gewiefter Lokalreporter, der die Nase bei der Nachrichtenbeschaffung gern nicht ganz ethisch einwandfrei vorn hatte, hatte bei Kramer angerufen, um zu erfahren, ob der »da jemanden drin« habe. Zu diesem Zeitpunkt war nicht klar gewesen, was »da drin« passiert war. Man hatte aber mitbekommen, dass ein Großaufgebot an Polizei, THW und Rettungswagen auf dem Weg zum In-and-Out war. Daraufhin hatte Andreas Kramer, durchaus besorgt um seine Mitarbeiterin, zum Hörer gegriffen. Beim vierten Anruf des Abends – es war inzwischen nach draußen gedrungen, dass man bei diesem Konzert nicht versucht hatte, die Kritikerin zu meucheln – war der Chef eher konsterniert gewesen. Man hätte wenigstens die Internetausgabe, die es auch am Sonntag gab, mit einem kleinen Bericht direkt vom Geschehen verzieren können. Dafür sei es nun zu spät. Anna hatte die drei Fragezeichen in seiner Stimme gehört, und weil sie nicht gewusst hatte, was sie sagen sollte, verschob sie den Rückruf seit gestern Abend.
Gestern hätte sie noch sagen können, dass im In-and-Out kein Empfang … dass die Ordnungskräfte … Aber mittlerweile, zehn Stunden später, war das nicht mehr möglich. Sie konnte sich bestenfalls herausreden mit notwendigen Recherchen und einer einzigartigen Erkenntnis, die eben Zeit brauche. Und die noch nicht gefunden war, doch das würde sie für sich behalten.
Kurz und gut: Anna Schneider hatte ein Problem. Sie scrollte durchs Internet, fand aber nichts, was sie nicht selbst schon gewusst hätte. Die Veranstalter drückten tiefstes Bedauern aus, von den drei verbliebenen Musikern war keine Stellungnahme zu erhalten. Nichts Überraschendes also. Sie musste irgendetwas anderes finden. Auf jeden Fall verbot es sich, über die vorher stattgefundene Musikdarbietung zu schreiben, vor allem angesichts der streitbaren Qualität. Noch eine Tasse Klarer-Kopf-Tee? Das brachte wohl auch nichts, vermied aber das Kaninchen-vor-der Schlange-Gefühl, denn sie hatte dann etwas zu tun. Und danach würde sie Kramer anrufen – sicher. Also doch den Wasserkocher noch einmal füllen.
Anna war gerade auf dem Weg in die Küche, als der Summton der Haustürklingel signalisierte, dass unten jemand Einlass begehrte. Kam Kramer jetzt schon persönlich, um nachzuschauen, ob sie noch lebte, schoss es Anna durch den Kopf. Sie konnte sich nicht im Entferntesten erinnern, wann sie zum letzten Mal am Sonntagmittag unangekündigten Besuch erhalten hatte. Die meisten ihrer Freunde wussten, dass Anna Schneider gerade dann vor ihrem Computer brütete, und der Paketbote kam keinesfalls am Sonntag. Sollte sie sich tot stellen und Kramer weiterhin ausweichen? Angesichts der Tatsache, dass sie ihren Job behalten wollte und morgen ohnehin in die Redaktion gehen musste, war das nicht ratsam. Es hieß also, dem Tiger, der Kramer beim besten Willen nicht war, ins Auge zu sehen und zu öffnen.
»Hallo?«, flötete Anna zögerlicher als sonst in den Hörer der Sprechanlage.
Nicht weniger zögerlich tönte es zurück: »Hallo …«
Das war keinesfalls der wild entschlossene Kramer.
»Hallo, hier ist Heinz …«
Anna überlegte. Heinz?
»Heinz, Habakuk, der Mann mit dem Rotwein von gestern Abend. Ich wollte das Kleid zur Reinigung abholen …«
Teufel, auch das noch. Offenbar hatte Anna es fertiggebracht, einem wildfremden Menschen ihre private Visitenkarte zu geben – nur weil er Bratscher war, harmlos wirkte und Habakuk hieß. Nach allem, was zwischenzeitlich ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, hatte sie es versäumt, im Saisonprogramm des Gewandhausorchesters nachzusehen, ob da tatsächlich ein Brausewind in der Bratschengruppe geführt wurde. Was blieb ihr anderes übrig, als ihn hereinzulassen? Jedoch – allein mit ihm nach der ersten Bekanntschaft? Trotzdem drückte sie auf den Türöffner, und Habakuk stieg in den fünften Stock, einen Fahrstuhl gab es nicht. Ein merkwürdiger Anfang für eine Bekanntschaft … Was, wenn dieser Habakuk ein gemeiner Wäschefetischist war und lediglich ihr Leinenkleid erbeuten wollte? Immerhin hatte er sie als die Musikkritikerin Anna Schneider erkannt.
In der Zwischenzeit war Habakuk angekommen, weit weniger schnaufend als die Mehrheit von Annas Besuchern. Die Entscheidung war gefallen. Anna ließ den unerwarteten Gast ein. Strahlend streckte er ihr eine große flaschenförmige Geschenktüte entgegen. Was für einen Wein dieser Typ wohl mitbringt?
»Rotwein wäre ein wenig provokant gewesen.« Habakuk strahlte. »Waschbär-Cola – auch kein schlechter Tropfen«, scherzte er weiter.
Anna überlegte, wann sie jemals ein abgefahreneres Gastgeschenk erhalten hatte. Vermutlich hatte sie diese Edel-Cola mit ihrer gestrigen Getränkebestellung selbst provoziert. »Ich hole Gläser…«, sagte sie. Wenn er schon einmal da war, konnte man auch ein Glas Cola mit ihm trinken. Vielleicht gelang es ja einem Bratscher, sie aus ihrer festgefahrenen Kramer-Steinmüller-Text-Gedankenschleife zu reißen.