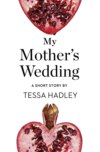Cilt 310 sayfalar
Zwei und zwei

Kitap hakkında
Seit 30 Jahren sind sie befreundet, die stille Malerin Christine, ihr Mann Alex, der sich zum Dichter berufen fühlte und nunals Lehrer arbeitet, der erfolgreiche Kunsthändler Zachary und seine flamboyante Frau Lydia. Die vier führen in London ein gutbürgerliches Leben, parlieren über Kunst und Literatur, bekommen Kinder und fahren gemeinsam in die Ferien. Alles ist gut. Dann stirbt Zachary, vollkommen unerwartet. Lydia zieht zu Christine und Alex. Aber der Verlust des Freundes und Ehemanns schweißt die drei nicht enger zusammen. Die Vergangenheit holt sie ein, alte Wunden brechen auf. Haben sie die richtigen Entscheidungen getroffen? Trifft man die je? Was ist aus ihren Sehnsüchten, den Lebensentwürfen ihrer Jugend geworden? Und was ist eigentlich damals in Venedig geschehen? Tessa Hadley hat einen wunderbar elegischen Roman über die ganz normalen Irrtümer und Missverständnisse des Lebens geschrieben, eine »comedy of manners«, in der die kleinen Gesten alles erzählen, ein Buch, dessen Lebensklugheit und feiner Ironie man sich nicht entziehen kann.