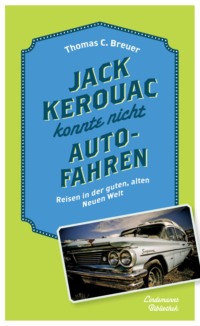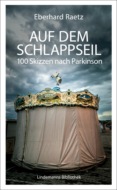Kitabı oku: «Jack Kerouac konnte nicht Auto fahren»


Thomas C. Breuer, 1952 in Eisenach geboren, lebt als freier Schriftsteller in Rottweil und den Abteilen von DB und SBB. Seit 1977 auch als Kabarettist unterwegs auf Kleinkunstbühnen in Deutschland, der Schweiz und Nordamerika. Über 3.000 Auftritte, 31 Bücher, regelmäßige Rundfunkarbeit für WDR, SWR und Schweizer Radio SRF. Preisträger 2014 des Internationalen Radio-Kabarettpreises „Salzburger Stier“.
Thomas C. Breuer
Jack Kerouac
konnte nicht
Auto fahren
Reisen in der guten,
alten Neuen Welt

It’s just another w along the road.
Danny O’Keefe
Für Celia und Beatrice
und meine reisefreudigen Eltern.
und für
Penny Hill. Doug Temkin.
Jaime, Paulie & Paul Seibert.
Denice Franke, Julie Ann Brown.
Hansjörg Malonek, Kerstin Richter.
Judith & Reinhard Maiworm.
Horst Hamann. Joachim Latka.
Geri Stocker. Bänz Friedli.
The Thorweihes. Stefan Hiss.
Nina Wurman, Jean-Michel Räber.
Danny O’Keefe. John Gorka.
Karl Obrath. Fred Taub.
Daniel Cantor. Barry Booth.
Mark Bittner. Daniel Chaffey.
Tom Schröder. Sigi Christmann.
Cornelia Hanske. Walter Kühr.

Coming In
Meine Mom hat immer gesagt, in Amerika schreibe man erfolgreich, wenn man Geschichten mit dem Satz „Meine Mom hat immer gesagt...“ anfängt, wahlweise auch „Mein Dad etc...“ Großeltern folgen auf Rang drei. Vielleicht funktioniert das in Deutschland ja auch. Meine Mom hat das natürlich nie gesagt, aber sie kennt sich aus mit Amerikanern, denn sie hat kurz nach dem Krieg in Heidelberg in der Bibliothek der Army gearbeitet und deshalb später jahrzehntelang AFN gehört. Das war meine frühkindliche Prägung. Viele ihrer Freundinnen sind zudem in die U.S.A. ausgewandert, und ich war immer aufgeregt, wenn Post von drüben kam. Ach ja: Am Ende des Buches solle der Satz stehen: „Mit Gottes Hilfe können wir alles erreichen.“ Damit könne man alles erreichen.
Dank des „Visa Waiver“-Programms darf man für 90 Tage visumfrei in die U.S.A. reisen, dort aber natürlich nicht arbeiten. Da Schreiben Arbeit ist, brauche ich ergo ein R-I-Visum. Die Sicherheitssysteme der Amerikaner greifen weit vor dem Zielflughafen, der Weg in die Staaten führt für mich über Frankfurt, so oder so. Von Frankfurt aus starten nicht nur die Flieger, hier werden auch die Eintrittskarten verteilt, im Konsulat in der Siesmayerstraße. Kaum tritt man an der Bockenheimer Warte aus dem U-Bahn-Schacht, begrüßt einen ein Hinweisschild zum Restaurant Zenobia, welches syrisch-libanesische Spezialitäten offeriert. Ausgerechnet. Gleich am Eingang zur Siesmayerstraße befindet sich jener in Fachkreisen bekannte Kiosk, an dem derjenige gegen geringes Entgelt Handy oder leichtes Gepäck deponieren kann, der die strikten Regeln für die Visa-Antragsteller nicht gelesen hat: Mit hineinbringen darf man nämlich gar nichts. Biegt man als Autofahrer in die Straße ein, sieht man sich mit einer Art Betonschikane konfrontiert, die wohl seinerzeit am Checkpoint Charlie demontiert wurde. Sowieso fühlt sich der Reisenwollende während des ganzen Prozedere an die Gepflogenheiten der guten, alten Deitschndemokrotschnreblik erinnert, es wird aber Momente geben, in denen er sich nach deren Betulichkeit sehnt. In Vierergrüppchen darf man in den Vorhof, ein Purgatorium, das mit massiven dunkelgrünen Gitterstäben umschlossen ist. Ähnliche Gestänge kennt man vom Frankfurter Zoo. Die Dame beim Vorchecking ist hypernervös, vielleicht hat sie heute ihre kugelsichere Weste vergessen. Pass vorzeigen, ein paar Minuten warten, schon darf man ins Allerheiligste. Immerhin. Sicherheitscheck. Wertsachen, Schlüssel etc. wandern separat an der Schleuse vorbei. Bei mir piepst es, also muss ich den Gürtel ausziehen, Schnürsenkel darf ich anbehalten. Sicherheitsprozeduren, die man von Flughäfen und aus Gefängnisfilmen kennt. Ich hoffe, die Hose hält auch so.
Durch einen sarrasaniartigen Gittergang gelange ich ins Innere in die Lobby, die von Fahnen und Fotos geschmückt wird. Dazu fällt mir ein Satz von Robert Altman ein, unmittelbar nach 9/11: „Wenn ich noch einmal eine amerikanische Fahne sehen muss, muss ich kotzen!“ Den zitiere ich jetzt besser nicht. Bemerkenswert: In der Lobby gibt es einen Trakt, der ausschließlich Amerikanern vorbehalten ist, folglich hängt dort ein Fernseher von der Decke, der die Wartenden mit Dumpfmucken und Klingeltönen traktiert. Dem Rest der Zivilisation bleibt derlei erspart. In Abu Ghraib hätte man mich nur zwei Stunden diesem Programm aussetzen müssen, ich hätte alles gestanden.

Ich halte eine grüne Karte in der Hand, die freilich keine Greencard ist. Die meisten anderen haben blaue und sind vor mir dran. Meine Karte berechtigt mich zum späteren Zugang zur vorderen Schlange. Ich habe Zeit, mich umzuschauen, mehr als mir recht ist. Dämlicherweise habe ich meine Zeitungen hinter ein paar Mülltonnen in der Siesmayer deponiert, weil ich mich daran erinnert habe, dass die Vopos früher rigoros sämtliche Druckerzeugnisse beschlagnahmt haben. Die Lobby vermittelt dem Reisenwollenden einen schönen Vorgeschmack auf den Trip, hat man doch bis ins letzte Detail, Türgriffe inbegriffen, alles über den Teich geflogen, weshalb das Geläuf stark an die Greyhound-Busstation von Idaho Falls erinnert. Die transpirationsfördernden Kunstledersitze sehen aus, als habe man sie 1957, als der Inlandsflughafen von Houston (Hobby) renoviert wurde, irgendwo zwischengelagert, in der Hoffnung, irgendein Blödmann würde sie schon abnehmen – eine Hoffnung, die sich erfüllte. Anteile an einer Firma müsste man haben, die Plastikhüllen herstellt, denn die sind hier der letzte Schrei, alle Antragsteller haben ihre Unterlagen in Klarsichtfolien geordnet, Papierumschläge scheinen streng verboten.
Endlich dürfen sich die Grünkartler einreihen. Die Anspannung steigt, der allgegenwärtige Druck bleibt nicht ohne Wirkung, mit grimmigen Gesichtern oder ernsten Mienen erzeugt der Amerikaner ein latentes Klima von Geständnisbereitschaft. Plötzlich liegt der Ball in meinem Feld, und obwohl ich entsprechend instruiert und präpariert bin, das ist ja nicht mein erstes Visum, spüre ich den eisigen Wind, zumal der Trottel von Passfotograf zuhause mit dem aktuellen Anforderungsprofil anscheinend doch nicht vertraut ist, und ich, mea culpa, habe es wohl ein wenig schleifen lassen: Auf meinem Porträtfoto fehlt ein Ohr, d.h. es ist nicht zu sehen, und falls ich die Absicht haben sollte, die Vereinigten Staaten beidohrig zu betreten, benötige ich unbedingt ein anderes Passfoto. Gut, die Schalterdame ist sehr freundlich, eine Deutsche, und weist mich auf den Fotoautomaten hin, der irgendwo auf dem Flur zu finden ist. Tatsächlich, da stehen sogar zwei Kabinen, davor eine kleine Schlange, denn der eine Automat ist ganz kaputt, und der andere fordert irgendein Speichermedium ein, das natürlich kein gewöhnlich Sterblicher bei sich trägt, und wenn, hätte er es natürlich am Eingang deponieren müssen. Ich könne auch ein Foto nachreichen, sagt die Dame schließlich, und entlässt mich in die nächste Schlange. Hier herrschen die Amerikaner, das Vorsortieren hat man einheimischen Ortskräften überlassen, jetzt wird es ernst.
Vor dem Schalter steht gerade ein Mensch offensichtlich arabischer Herkunft, der, die Akustik trägt gut, seinen Beruf mit „Chemiker“ angibt. Mit dem würde ich jetzt nicht tauschen mögen. Der Nächste ist ein Inder oder Pakistani, und der Schalterbeamte verschwindet mit seinem Pass in der unendlichen Verwaltungsprärie des Konsulats. Und bleibt verschwunden. Bleibt länger verschwunden. Es würde niemanden überraschen, wenn sich plötzlich unter dem Mann aus dem Mittleren Osten eine Falltür öffnen würde. Schließlich kommt der Beamte wieder, no problem.
Nun komme ich zu meinem sog. Interview. Der Inquisator: Ein eher sympathischer Mittdreißiger mit wahrscheinlich levantinischen Vorfahren. Zuerst die Fingerabdrücke, bitte. Ob sie auf diesem Weg – via Schmauchspurenanalyse – gleich die Raucher aussortieren? Daumenkino durch meine Papiere. Stempel. Vom Passfoto kein Wort, dem Mann scheint ein Ohr zu reichen. Fragt als Erstes, was das sei, Kabarettist. Ich bediene mich gegen meine Überzeugung des Begriffs „Comedian“. „Really?“ Er zieht die Augenbrauen hoch, aber eher aus Enthusiasmus, lächelt. Hoffentlich muss ich nichts vorspielen, ich habe nichts einstudiert. Er will alles wissen, wie lange schon, hauptberuflich, es fehlt nur die Frage: Was machen Sie tagsüber? Was ich in den U.S.A. wolle? Eine Reportage über den Greyhound schreiben. Oh, da hätte er auch schon seine Erfahrungen gemacht. Seine Augen rollen, strahlen aber. Wohin ich denn wolle? Houston. Oh, seine Schwester wohne dort, sie sei begeistert. Von Houston?? Okay, alles ist möglich, aber wer interviewt hier eigentlich wen? Jetzt wieder er: Wann denn mein Artikel erscheinen würde? Wohl nicht mehr dieses Jahr. Er scheint ehrlich bestürzt. So, da müssen wir wohl noch ein wenig warten, sagt er, und: Viel Erfolg.
Das war’s? Dafür der ganze Aufstand? „Did I shave my legs for this?“, sang Deana Carter 1996, wenngleich in anderem Zusammenhang. Mir fällt ein Steinchen vom Herzen, man kennt die rigorose Einreisepraxis der letzten Jahre, Cat Stevens z.B. haben sie aus dem Flieger geholt und zurückgeschickt, vielleicht nicht einmal islamistischer Umtriebe wegen, sondern als nachträgliche Strafe für seine Musik. Im österreichischen Fernsehen haben sie vor Jahren die Geschichte eines Mannes gebracht, der in den 60ern als Austauschschüler in Maine artig bei den Behörden angefragt hatte, ob er vielleicht ein wenig jobben dürfe, was man ihm unter Androhung sofortiger Ausweisung vehement verbot. Obwohl er all die Jahre nicht auffällig geworden war, verwehrte man ihm fast 40 Jahre später die Einreise mit dem Hinweis, er habe schon einmal versucht, in den U.S.A. zu arbeiten. Gut, ich bin also einerseits erleichtert, andererseits aber offenbaren sich hier natürlich große Schwächen in der Dramaturgie. Erst der Einstieg in eine martialische Welt, einschüchternd wie die Polunski Unit in Huntsville, ein grummelnder Bordunton von Bedrohung liegt in der Luft, als Höhepunkt der scheinbare Klimax wegen des fehlenden Ohres, ein Handlungsstrang indes, der ins Nichts führt, und die Auflösung unpassend versöhnlich, ein belangloser Abgang. So wirkt die nervös fingertrommelnde Aufbewahrungszippe am Aus- bzw. Eingang absolut überbesetzt. Auf ins Land der begrenzten Unmöglichkeiten!

Einreise
Es ist nicht leicht, in dieses Land hineinzukommen. Der Mann von der Immigration mustert mich, als hielte ich einen kubanischen Pass zwischen den Fingern. Das kümmert mich wenig, dies ist nicht mein erstes Rodeo. Schon beim Einchecken in Deutschland hat man mich misstrauisch beäugt: „Haben Sie etwas bekommen von jemanden, den Sie nicht kennen?“ Blöde Frage – ich kenne gar niemanden, den ich nicht kenne. Die Fragerei will kein Ende nehmen, in früheren Jahren schon im Flugzeug auf dem offiziellen Einreiseformular, heutzutage auf der Homepage des Heimatschutzministeriums: „Wollen Sie einen terroristischen Akt vollziehen? Wollen Sie in den U.S.A. ein Verbrechen begehen? Handeln Sie mit kontrollierten Substanzen? Steht hinter Ihrer Einreise die Absicht, sich an strafbaren oder unmoralischen Handlungen zu beteiligen? Waren oder sind Sie in Spionage, Sabotage oder sonstige Aktivitäten verwickelt?“
Mal abgesehen, ob nicht die unkontrollierten Substanzen generell die interessanteren sind – diesen ganzen Quatsch fragen einen die Amis seit Jahrzehnten, und mehr denn je erscheint es ratsam, alle Fragen mit „Nope!“ zu beantworten. Nicht bekannt ist die Anzahl der Terroristen, die bei der Frage nach dem terroristischen Akt schafbrav das „Ja“ ankreuzten. Demnächst verlangen sie Haarspitzenanalysen, die nicht älter als drei Wochen sein dürfen. Amerikanische Fluglinien sollten ausschliesslich Gerichte mit Schweinefleisch anbieten, damit könnten sie mögliche Islamisten im Vorfeld rauskegeln. Verheerend kann indes der Versuch ausgehen, „Kinder-Eier“ ins Land zu schmuggeln. In den U.S.A. ist deren Verkauf nämlich verboten, da die Spielzeugkombination mit Schokolade als gefährlich eingestuft wird. Zwei U.S.-Bürger mussten im Juli 2012 15.000 $ Strafe zahlen – 2.500 $ pro Ei. Im Jahr 2011 wurden über 60.000 Eier konfisziert. Derzeit haben die Behörden elektronische Geräte mit leeren Akkus im Visier.
Wer hat eigentlich das Märchen von den Deutschen als bürokratischste Nation der Erde in die Welt gesetzt? Das einzige, was z.B. ein ehemaliger Bürgermeister von D.C. jemals erfolgreich auf den Weg gebracht hat: Das „Department for Recreation & Parks“ umzuwandeln in ein „Departement for Parks & Recreation“. In den U.S.A. gibt es Gesetze, von denen macht man sich keine Vorstellung. So ist in Vermont z.B. Pfeifen unter Wasser illegal. Ebenso ist es ungesetzlich, die Existenz von Gott zu leugnen. Es gab Zeiten, da war es nicht gestattet, eine Giraffe an einem Telefonmast anzuleinen und Frauen brauchten eine schriftliche Erlaubnis ihres Ehegatten, um falsche Zähne tragen zu dürfen.
Keine Bange: Wichtig ist, beim Grenzübertritt adrett angezogen zu sein und sich ordentlich zu benehmen und auf gar keinen Fall die gelbe Linie zu übertreten. Lassen Sie sich auf keinen Fall von Pedanterie, Ignoranz oder Idiotie provozieren. Unterlassen Sie die Frage, ob es gestattet sei, Granatäpfel mit ins Land zu bringen.
Amerikareisende sollten unbedingt den Fallstricken der politischen Korrektheit gebührende Aufmerksamkeit schenken, denn die greift seltsamerweise noch immer, d.h. unter gar keinen Umständen diskriminierende Witze erzählen wie z.B. den folgenden: „Was passiert, wenn eine Blondine von Deutschland nach Amerika auswandert?“ (Diese Frage wird später beantwortet. Man sollte bei Büchern stets einen Spannungsbogen aufbauen.) Let’s do it! Keine Minute zögern sollten Sie! Und leinen Sie Ihre Giraffe um Himmels Willen nicht an einen Telefonmast an, zumindest nicht in Vermont.

Küss mich, Käfer (1993)
Auf dem ersten Trip 1987 habe ich angefangen, mit einer schäbigen Kamera alte Straßenkreuzer zu fotografieren – und mit meiner Penetranz eine Beziehung aufs Spiel gesetzt: „Halt sofort an!“ Mir schien es albern, irgendwelche Naturwunder oder Bauwerke runterzuknipsen, die längst auf Postkarten, Kalendern und vorfabrizierte Dias gebannt sind. Auf Tassen, wenn du Pech hast. Strassenkreuzer allerdings auch, wie ich rasch feststellen musste. In Anchorage, Alaska, geriet mir ein elfenbeinfarbener Käfer vor die Linse. Och, dachte ich, wie goldig, und so fern der Heimat! Ich konnte nicht ahnen, dass sich Käfer zu einer fixen Idee auswachsen sollten. Über ein paar Jahre hinweg liefen sie mir in anderen Staaten zu, dann war ich
angefüttert. Irgendwann fielen mir die Poster ein, die sich sehnsüchtige Lehrer gerne in ihre Arbeitszimmer hängen: Türen auf Mykonos oder irische Fensterläden. Warum also nicht ein Plakat mit 50 verschiedenen Käfern aus allen 50 Staaten zusammenstellen? Mit den verschiedenen Nummernschildern, die ja optisch wesentlich mehr hergeben als unsere öden Bleche, könnte das hübsch aussehen. Fortan orientierten sich meine Reisen am Käfer. Wir sprechen natürlich vom VW-Käfer. The Beetle. The Bug. Den Kosenamen hat er übrigens von der Amerikanern: Am 1. Juni 1942 tauchte diese Bezeichnung erstmals in der New York Times auf.
Das Plakat habe ich nie verwirklicht. Aber ein Verleger ermunterte mich zu einem Buch mit Geschichten über den Käfer und meine Reise. Okay, dachte ich schließlich im Jahre 1993, dieses Mal machen wir es aber richtig! Ich werde alle 50 Staaten in einem Aufwasch erledigen. 57 Tage habe ich dafür benötigt, Alaska (Juneau, morgens) und Hawaii (Honolulu, abends) sogar selbigen Tages, mit dem Umweg über Seattle und Los Angeles. Ich gebe zu, ich habe ein wenig getrödelt, vor allem im Nordwesten, außerdem war ich ein paar Tage krank, aber mich trieben keine Guinness-Ambitionen um.

Man macht sich vorher nur schwer ein Bild von der Größe dieses Landes. Darüber hinweg fliegen kann jeder, das ist imposant genug, wobei Profis den kompletten Mittleren Westen ohnehin als „Flyover-States“ abtun. Aber „coast-to-coast“, also praktisch „drive-thru“ auf dem Erdboden, das ist schon was anderes. Warum fahren eigentlich so viele Leute nach Amerika? Manche suchen die Leere, die Weite, die Unendlichkeit. Andere die Unberührbarkeit. Wieder andere verwirklichen ihre Jugendträume und möchten sozusagen Lassie die Pfote schütteln oder Flipper die Flosse. Für Leute, die Bewegung lieben, ist Amerika ideales Terrain. „Kein Stehenbleiben. Nur wer in Bewegung ist, spürt die Gegenwart und die Zukunft ist nie unerreichbar. Vergangenheit hingegen bedeutet Stillstand, und wer stehen bleibt, geht rückwärts.“, meinte schon Studs Terkel, die Radiolegende aus Chicago. Amerika ist ständig auf Achse. Ein beliebter Mythos: „Wir schließen niemals...“, sagt der Besitzer des Truckstops, „... wir wissen nicht einmal, wo die Schlüssel für die Eingangstüren sind!“ Wer außer Englisch keine andere Sprache spricht, darf Tausende von Meilen reisen, ohne den Sprachraum zu verlassen. Wieder andere suchen die sengende Sonne oder wilde Wasser. Lukullischer Genüsse wegen reisen die wenigsten in die Staaten, obwohl ich hartnäckige Vorurteile meines Bekanntenkreises bezüglich amerikanischer Kost keinesfalls bestätigen kann.
Meine Freunde meckerten eine Zeit lang über meine Neue-Welt-Reisen: „Was willsten da?“ Japaner sind sogar einen Schritt weiter, sie haben eigens einen Begriff für „Amerikaner nicht leiden mögen“ erfunden: „kenbei“. Dabei bietet Amerika so viel Platz – man kann sich alles raussuchen, die Orte, das Essen, den Umgang. Man muss nur mit offenen Augen und Ohren reisen, dann kriegt man schnell raus, wo man findet, was man sucht. Bzw.: ob.
Die Versorgung mit internationalen Nachrichten ist allerdings bescheiden, lieber behält man das eigene Land im Blick: Über eine Exekution in Virginia verlieren sie in U.S.A. Today armselige drei Zeilen. Über einen Hund, der in New Hampshire einen Hahn getötet hat und deshalb eingeschläfert werden soll, wobei sich der Gouverneur per Veto eingeschaltet hat, in derselben Rubrik doppelt so viele. Geschlagene fünf Minuten nahm auf CNN die Nachricht über ein krankes Rennpferd ein, das irgendwann das Kentucky-Derby gewonnen hatte. Am Ende des Berichts forderte die Besitzerin alle Amerikaner auf, das Tier in die Gebete einzuschließen. Die Nachrichten im Fernsehen bestehen aus kleinen Häppchen: Eine Nachricht, dann die Vorschau auf die Nachricht im nächsten Block und dann gleich die Werbung für Mittel gegen Magenübersäuerung, die man bei solchen Sendungen dringend braucht.
Trotz alledem habe ich einen Amerikatick, da ich wie viele deutsche Dreikäsehochs meine Jugend unter amerikanischem Einfluss verbracht habe: Musik, Idole, Cola, Zigaretten, Beat, wir ließen nichts aus. Amerika kam mir schon vor meiner ersten Landung 1987 bekannt vor. Außerdem, da muss ich mir nichts vormachen, bin ich ein Sammler: Ich wollte mir alle 50 Sterne von der Flagge pflücken. Ein Held meiner Kindheit war einmal mit einem alten Lloyd „mit 19 PS um die Welt gereist“ – in der Art wollte ich das auch. Nur nicht unbedingt im Auto, eher mit dem Auto als Medium. Folglich reiste ich wie ein Ami in Europa: „Wenn heute Dienstag ist, muss dies Wichita sein!“
Autos sind kein allzu ausgefallenes Thema in einem Land, dessen Bewohner durchschnittlich sechs Monate ihres Lebens vor roten Ampeln warten. Das Glaubensbekenntnis „Drive to live, live to drive“ habe ich auf einem Aufkleber entdeckt. Ein deutsches Auto in den U.S.A. – nicht, dass ich übertrieben patriotisch wäre, mir ist ja schon die Silbe „Volks“ peinlich, aber ein besseres Vehikel für die Begegnung deutscher mit amerikanischer Alltagskultur lässt sich kaum finden, von Elke Sommer und Detlef Schrempf einmal abgesehen. Nowitzki spielte damals noch in den Kinderschuhen. Wir haben nach dem Krieg – völlig zu Recht – alles von den Amis übernommen.
Der Käfer war umgekehrt das erste deutsche Produkt, das seinen Weg in den Staaten machte. Leider sind Autos nicht sonderlich dialogfähig, weswegen mich mehr die dazugehörigen Menschen interessierten. „Jeder hat eine Käfergeschichte!“ – diesen Satz sollte ich immer wieder hören. Käferfahrer sind eine besondere Spezies. Der Käfer hat mir Türen aufgetan zu einem renommierten kubanischen Saxofonspieler im Exil in New Jersey, einem Ex-Senator in Connecticut, einem österreichischen Auswanderer in Alaska, einer einfachen jüdischen Familie in Delaware, die trotzdem deutsche Autos mochte, einem Millionär und Käferbesessenen in Seattle, einem Anthropologen im südlichen Illinois mit eigenem Käferfriedhof, einer Radio-Ikone aus West Virginia, einem Folk-Rock-Duo aus Buffalo, New York – ohne Käfer hätte ich deren Bekanntschaft vermutlich nie gemacht. Einige Begegnungen waren zufällig, andere Ergebnis hartnäckiger Recherchen und minutiöser Planung, der alte Balanceakt zwischen Höflichkeit und Penetranz, und, das kam erschwerend hinzu, alles in der Zeit vor Handy und Mail.
Aufs Geratewohl prescht man bei so einem Unterfangen nicht los. Selten erschien mir ein Faxgerät sinniger als in den Wochen der Vorbereitung. Die Adressen von Käferverrückten entnahm ich amerikanischen Magazinen wie Hot VWs oder VW Trends. Ich schrieb Clubs an, die mich mit Kontakten versorgen. Sogar Leute in Deutschland hatten „Bug-Buddys“ in Amerika, die welche kannten usw. Ich war optimistisch: Schließlich hatte Wolfsburg von 1949 bis 1974 fünf Millionen Käfer nach Amerika verschifft – irgendwo mussten die ja geblieben sein. Übrigens ohne Freihandelsabkommen. Wer wissen will, wie es ist, mit den Amis Handel zu treiben, sollte die Indianer fragen. Bescheiden hatte es angefangen, mit ganzen 352 Exemplaren im Jahre 1950. Wie ist also der Erfolg zu erklären?
Als mir Perry Clough in Rhode Island stolz sein Cabrio zeigte, das er seit eineinhalb Jahren restauriert, meinte er lakonisch: „Wenn ich fertig bin, habe ich circa 15.000$ in den Wagen gesteckt. 8- bis 9.000 wird er dann wert sein. Davon habe ich ein Auto, das langsam ist, laut, schrecklich kleine Scheibenwischer hat, schwach glimmende Scheinwerfer und keine Wärme“. Na, wenn das keine Liebe ist. Ich hatte das Gefühl, die Käfermaniaks waren vor allem stolz darauf, der Perfektion eins auszuwischen. Seine Wirtschaftlichkeit mag in Studentenkreisen ausschlaggebend gewesen sein, aber letztlich begründete die Schwäche der Amerikaner für spleenige Ideen den Erfolg. Außerdem bedeutete das Autofahren im Käfer stets eine Herausforderung.
Das Projekt fraß Geld. Ich suchte Sponsoren. Delta Airlines winkte ab, das war ihnen zu popelig. Ich bin trotzdem mit ihnen geflogen, der Standby America Pass für zwei Monate war einfach nicht zu toppen. Nein, ich habe die fünfzig Staaten nicht mit einem Käfer abgeklappert. Wenn ich sage, dass die beiden häufigsten Sätze meiner Reise „Wir entschuldigen uns für die Verspätung!“ und „Vielen Dank für Ihre Geduld!“ waren, so ist das überraschenderweise einmal nicht auf die Deutsche Bahn gemünzt. Ich möchte mich nicht in kleinlicher Rachsucht üben: Über 70-mal bin mit Delta gestartet und gelandet, da kann das schon vorkommen. Bei Standby gilt: Sämtliche Tage vor Feiertagen meiden, generell Zurückhaltung üben am Wochenende und sowieso nach Möglichkeit antizyklisch fliegen. Frühflüge und Feierabendflüge sind oft überbucht, am bequemsten reist es sich zwischen zehn Uhr morgens und drei Uhr nachmittags.
Die Amerikaner haben ihr Land zum Glück recht übersichtlich gestaltet: Regierung in D.C., Computer in Seattle, Austin oder im Silikon Valley, Glücksspiel in Las Vegas, Film in Hollywood, Jazz in New Orleans, Soul in Detroit, Country in Nashville. Jede Stadt ist von Strip-Malls umzingelt – mit zahllosen points of uninterest – und verfügt über eine Downtown. Man kennt sich rasch überall aus, auch in Hotels und Restaurants. Die Angst der Amerikaner vor der Gleichmacherei des Kommunismus muss verwundern, denn das Alltagsleben der Amerikaner ist streng genormt. Die Amerikaner verfügen über ein komplizierteres Gürtelsystem als Karatesportler. Es gibt den Baumwollgürtel oder den Bibelgürtel, die nahezu identisch sind, wobei Letzterer sich stündlich verbreitert, sogar nach Norden hin, wo er auf den Rostgürtel trifft.
Verlassene Häuser, von der Natur fast vollständig zurückerobert, umringt von einem verrosteten Fuhrpark – man fragt sich, womit die früheren Bewohner sich eigentlich aus dem Staub gemacht haben. Es lebe die Korrosion! Nüchtern betrachtet bildet Rost lockere Gefüge von geringer Festigkeit, und Salze erhöhen die Leitfähigkeit des Wassers und die Leidensfähigkeit des Autobesitzers. Der sog. „Rust Belt“ hat seinen Namen dem Winter zu verdanken und dem exzessivem Streuen von Salz. Rost arbeitet ja nicht nur bei den Autos, überall ist der Lack ab. Ganze Industrieanlagen zerbröseln vor sich hin oder werden als Industriedenkmäler touristisch genutzt wie der Gas Works Park in Seattle. Sicher sind auch stillgelegte Fabriken von Rostschutzmittelherstellern darunter. Vielleicht haben die Amerikaner mit den Staaten hinter dem Eisernen Vorhang (der ja selbst längst korrodiert ist) in Wettstreit treten wollen, sie lieben ja den Wettbewerb. Andere Baumaterialien haben sich dem Rostton angepasst: Holzhäuser sind rostbraun, Backsteinhäuser rostrot, man sieht im Nordosten auf alt getrimmte Lobster Houses und im Süden wird in ähnlichen Schuppen Blues gespielt. Blut fällt da gar nicht weiter auf. Manchmal kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass viele Gegenstände vorvergammelt wurden oder von Hand abgeblättert wurden, dass man ihnen liebevoll Patina aufgetragen hat, um sie mit einer Art Geschichte auszustatten. Vielleicht haben Amerikaner längst die Kunst entwickelt, Rost auf Holz zu züchten und bestimmte Produkte gleich verrostet herzustellen. Komischerweise hat der Gilb nie eine vergleichbare Rolle einnehmen können.
Rost ist längst ein Herausstellungsmerkmal. Verfall bedeutet Verlust. Verlust bringt Verklärung. Eine einfache Rechnung. Verlust als Kunstform. Bei uns vergammelt das Thema in den Klauen geifernder Heimatvertriebener. Das Geschäft mit der Sehnsucht funktioniert besonders im akustischen Bereich und macht jährlich Millionenumsätze. Bekannt dürfte folgender Nashville-Witz sein: Was passiert, wenn du einen Countrysong rückwärts spielst? Der Held kriegt sein Auto und sein Haus wieder, die Frau kehrt zu ihm zurück, der Hund konnte wiederbelebt werden – und das alles, nachdem er frisch aus dem Knast raus ist. Country-Music wimmelt von Verlusten und handelt oft davon, dass man gerade in St. Louis sein muss, viel lieber aber in Tulsa oder Flagstaff wäre. Na, vielleicht nicht gerade in Tulsa. Der Faktor „Sehnsucht“ in der Country-Musik ist nur schwer nachvollziehbar, denn – s.o. – irgendwie sehen die Käffer alle gleich aus – warum sollte man sich da ein spezielles rauspicken? Rusty war lange Zeit ein beliebter Vorname, damit konnte man es zum Deutschen Schäferhund in einer beliebten Serie in den 40ern, zum Astronauten (Schweickart, 1963 NASA Group), Gitarrist der Band Poco (Young) oder zu einem NASCAR-Fahrer (Wallace) bringen. Rusty ist als Spitzname für Rothaarige und als Kurzform von Russell gebräuchlich. Rust never sleeps.
Alaska. Strömender Regen in Juneau und am Mendenhall Glacier, einem respektablen Monster aus bläulichem Eis, der Hausgletscher von Fred Felkl. In seinem schwarzen Käfer Baujahr ’55 haben wir zehn Minuten von seinem Haus in die Wildnis gebraucht, das heißt: Wildnis ist ringsum: Zehn Bären wurden im vergangenen Jahr in der Hauptstadt Juneau gesichtet. Fred Felkl hat Wien 1964 verlassen, um sich Alaska anzuschauen. Er ist gleich dort geblieben. „I schau no immer an!“ Sein Käferenthusiasmus ist verständlich, er betreibt eine Reparaturwerkstatt. Hier kann er gut die Überlebenschancen von Käfern unter extremen Bedingungen studieren: „Sehr fürchterlich der Rost, die Karosserie rostet weg, muss man alles trocken halten!“ Weswegen er sein Prachtexemplar nur zu besonderen Anlässen herausholt. Die Freiheiten hier oben gefallen ihm und dass die Leute entspannter sind als in den „lower fourty eights“, d.h. den restlichen 48 Staaten, Hawai’i also ausgenommen. Und natürlich die Natur! Anflüge von Heimweh bekämpft er mit Musik, mit Religion und mit Reisen. Seine beiden Söhne hat er Hans und Franz getauft. Und dann ist da noch das Auto, ebenfalls ein Relikt aus der Alten Welt.
„Der Käfer is... is... is... halt der Käfer!“, schwärmt er. „Wie sagt man hier? Nostalgic! Einfacher Wagen, unique Bauart. Für den Stadtverkehr war er die Nummer eins. Zehn Meilen kam man früher mit die Autos, wo‘s g‘habt haben, per Gallone, und 25 bis 30 mit dem Käfer. Die Einfachheit und das Aussehen: Es gab nix, was ausg‘schaut hat wie der Käfer.“
Bei uns in Europa sieht man sie überall, die amerikanischen Nummernschilder, in Kneipen, in Wohnungen, auf Autoablagen, in Trucks – Fernweh in der Blechversion, wie früher die Plaketten auf den Spazierstöcken aus Holz. Die Schilder heißen „license plates“ oder schlicht „tags“. Sie sehen vielversprechend aus und erwecken den Anschein, Geheimnisse in sich zu tragen. Dabei verschweigen sie nichts. Amerikaner sind mit dem alles durchdringenden Stolz auf ihre Heimat bis ins Detail mitteilungsbedürftig. Auf ihre T-Shirts drucken sie den Namen ihres Heimatstaates oder das letzte Urlaubsziel, gelegentlich auch den eigenen Namen, den ihrer Lieblingsband oder Informationen über religiöse Zugehörigkeit oder sexuelle Orientierung. Es ist relativ leicht, mit Amerikanern ins Gespräch zu kommen. Da trägt einer das Namensschild: „Russ“. Auf dem T-Shirt entrollt sich in Cinemascope „Gatlinburg“. Die Einstiegsfrage wäre also: „Hi Russ, wie war’s Gatlinburg?“
Auf den Nummernschildern präsentieren sie Bilder von Sonnenuntergängen, Schilfgras, Pfirsichen, Bergen, Zedern, Vögeln oder Flugzeugen, ergänzt durch Sprüche wie „Land der Verzückung“, „Amerikas Milchland“ oder „Berühmte Kartoffeln“, also dem Motto des jeweiligen Staates. Mitunter lügen sie dreist – bei New Jersey würde mir nicht als erstes „Gartenstaat“ in den Sinn kommen. Hinter New Mexico haben sie „U.S.A.“ hinzugefügt, nachdem eine Umfrage ergeben hatte, dass viele Amerikaner diesen Staat im alten Mexiko vermuteten. Gleichzeitig erteilen die Schilder ungefragt Auskunft über die Autobesitzer und legen Zeugnis ab von der amerikanischen Geschichte: „Veteran.“ „War Veteran.“ „Korean Veteran.“ „Former Prisoner of War.“ „Combat Wounded.“ Gelegentlich ist ein kleiner Rollstuhl abgebildet. Universitäten haben häufig eigene Schilder. Wie bei „Stadt, Land, Fluss“ gibt es auch „Tier, Name, Beruf“ – für ein paar Dollar mehr kannst du dir alles maßschneidern lassen. Käferfreaks suchen sich „Ladybug“, „FAHRVGN“ (von „Fahrvergnügen“ – dem Schlüsselwort der amerikanischen VW-Werbung), „73BEETL“ oder „KAFER“ aus. In Connecticut muss man beispielsweise 100$ für so ein Wunschkennzeichen (vanity plate) anlegen.