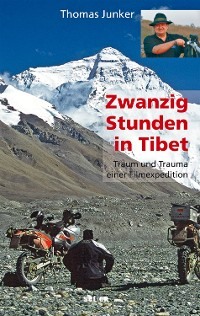Kitabı oku: «Zwanzig Stunden in Tibet», sayfa 2
18. August 2001, Islamabad
Um 6 Uhr in der Früh ist die Nacht vorbei. Nun gut, früh am Morgen sind die Temperaturen wenigstens noch halbwegs erträglich. Also hat das zeitige Aufstehen auch seine gute Seite. Und die gilt es auszunutzen. Wir fahren nach Islamabad hinein, wollen die ersten Dreharbeiten erledigen. Zwei Stunden dauert das, es ist ein angenehmes „Warmwerden“ mit der Kamera und der neuen Umgebung.
Schnell wird es wieder unbarmherzig heiß, was die Vorfreude auf den morgigen Start ein bisschen trübt. Wir beschließen, den Tag beschaulich an uns vorüberfließen zu lassen. Genießen gegen 10 Uhr ein gutes Frühstück im Hotel, kleben danach unser Roadbook zu einer langen Rolle zusammen und legen es in die entsprechende Halterung am Lenkrad. Auf diesem Roadbook haben wir die kommende Strecke und jene Informationen aufgezeichnet, die wir benötigen, um immer den richtigen Weg zu finden. So wie das bei all den Reisen zuvor auch war, räumen wir anschließend fast alle Kisten noch einmal aus, suchen nach der optimalen Packordnung. Wohl wissend, dass es diese nicht gibt, besser gesagt, dass sie sich erst nach etlichen Tagen von alleine ergibt.
Am Abend nach Sonnenuntergang tauchen wir dann im 15 km entfernten Rawalpindi in das pakistanische Leben ein. Rawalpindi ist eine alte Stadt. Ihre Geschichte reicht fast 3 000 Jahre zurück.Heute ist sie eine wichtige Industriestadt und vor allem der Sitz des allmächtigen Militärs. Doch Soldaten sehen wir nur wenige, dafür viele Menschen aus dem nahen Afghanistan. Paschtunen zumeist, die auf beiden Seiten der Grenze wohnen und hier in Rawalpindi ihren Geschäften nachgehen. Welche das auch immer sein mögen. Was auch immer sie handeln. Lebensmittel ganz bestimmt, Nachrichten und Informationen ebenfalls. Aber ich bin überzeugt, dass auch Waffen und Drogen den Besitzer wechseln oder zumindest geplante Deals hier besprochen und organisiert werden. Zu nah sind die so genannten Stammesgebiete, die sich südlich von Peschawa entlang der Grenze südwärts ziehen. Bereits 1991 habe ich diese bereist, wurde Zeuge, wie dort hemmungslos Schlafmohn für die Opiumgewinnung angebaut wurde. Ich konnte filmen, wie Handfeuerwaffen im großen Stil produziert wurden. Diese Stammesgebiete, sie gehören zwar zum pakistanischen Staatsgebiet, de facto aber hat die Staatsgewalt dort keine Macht. Es sind einzelne Stämme, einzelne Clans der Paschtunen, die das Sagen haben. Reist man in die Stammesgebiete ein, wird man wenige Kilometer südlich von Peschawa vom Militär darüber belehrt und muss unterschreiben, dass man auf eigene Faust weiterfährt. Ich habe das 1991 getan und gelangte in den Ort Derra, einem Straßendorf mit vielen Läden. Nahezu jedes Haus war ein Laden, jeder so breit wie eine Garage. Im Angebot waren ausschließlich Waffen und Munition. Derra galt und gilt als eine der größten illegalen Waffenschmieden der Welt. Hier kann man sich von nahezu jeder Handfeuerwaffe Kopien anfertigen lassen. Egal wie viele, ob man ein Einzelexemplar einer Pistole möchte oder 1000 Maschinengewehre. Die dazugehörige Munition ist ebenfalls im Angebotskatalog. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass in den 80er Jahren die Waffenproduktion von den USA unterstützt wurde, ob nun direkt oder indirekt sei dahingestellt. Damals kämpften viele afghanische Stämme gegen die sowjetischen Besatzungstruppen. Einer der wichtigsten Versorgungspunkte war Derra. Auch heute, im Jahr 2008, werden noch eifrig Waffen gebaut, die weiterhin in Afghanistan eingesetzt werden. Nun gegen Soldaten der NATO.
Fährt man schließlich südwärts weiter, kommt man durch die schönsten Schlafmohnfelder, die man sich vorstellen kann. Welch eine Verbindung: Waffen und Opium!
In Rawalpindi pulsiert das Leben heftig. Bis weit in die Nacht hinein sind die Geschäfte geöffnet. Hier sind die Straßen voll.
Manche Menschen kommen von der Arbeit in den Büros der Ministerien aus dem nahen Islamabad, manche sind auf den Weg in Restaurants und Kinos. Omnipräsent sind die Straßenhändler. Sie verkaufen alles, was denkbar ist: Haushaltswaren, Bekleidung, Nahrungsmittel, Getreide. Wir sehen Essenstände, viele ziehen von Straße zu Straße. In Öl ausgebackene Teigtaschen mit Gemüsefüllungen bieten etliche an. Einer hat eine Petroleumlampe, die so hell leuchtet, dass man ihn und sein Handwerk schon von Weitem sehen muss. Auf seinem Handwagen hat er eine Pyramide aus frischen Limetten gestapelt. Eine reichlich verzierte Saftpresse ist des Händlers ganzer Stolz. Mit ihr zelebriert er die Saftgewinnung, macht ein wortreiches Spektakel daraus. Den Passanten auf der Straße gefällt es. Seine Kasse füllt sich gut, der Stand wird belagert, wo auch immer er stehenbleibt.
Die Geschäfte in den Häusern sind voller Waren. Kunstvoll verzierte Töpfe und religiöse Reliquien neben Teppichen und Handtüchern. Die Läden von der Größe einer Garage, sie sind nicht nur Straße für Straße aneinander gereiht, sie sind es auch wert, in Ruhe betrachtet zu werden. Chaotisch geht es auf den Straßen zu. Verkehrsregeln scheint es nicht zu geben. Doch der erste Blick täuscht, bei näherem Betrachten bemerkt man das feine Gespür all jener, die mit der Straße zu tun haben. Nie wird viel Platz gelassen, kreuz und quer wird gedrängelt, Vorfahrten beliebig missachtet, aber nie bis zur bitteren Konsequenz. Unfälle, Zusammenstöße gibt es wenige, wie eng es auch immer werden mag in den Gassen der Altstadt von Rawalpindi.
19.–22. August, Islamabad – Gilgit – Hunza
36 °C im Schatten! Es ist der pure Wahnsinn. Nein, wir haben nicht verschlafen. Es ist halb Acht, wir sind schon seit einer Stunde unterwegs. So lange man in Bewegung ist, ist die Hitze erträglich, kühlt der Fahrtwind. Was mich tröstet, ist die Aussicht auf kühle Tage. Die werden wir weiter oben im Karakorum und schließlich in Tibet noch reichlich erleben. Kälte macht mir wenig aus. Seitdem wir im Jahre 1998 am magnetischen Nordpol und vor allem am geografischen Südpol waren und dort Temperaturen von minus 40 °C erlebt haben, hat das Wort Kälte für mich eine neue Bedeutung bekommen. Und ich habe gelernt, mit ihr umzugehen und mich effektiv zu schützen und zu kleiden. Aber was will man gegen Hitze ausrichten? Man kann auf dem Motorrad nicht einfach alles ausziehen. Ein Sturz ist immer möglich, gerade hier im chaotischen Pakistan. Auf meine Schutzkleidung will ich nicht verzichten, Protektoren an den wichtigen Stellen wie Rücken, Ellenbogen, Knie und Hüfte sind ein Muss.
Also schwitzen! 220 Kilometer von Islamabad entfernt im Norden beginnt der Karakorum-Highway. Für viele ist er eines der modernen Weltwunder. Und mit jedem Kilometer mehr auf ihm verstehe ich auch warum. Der Karakorum-Highway ist an vielen Stellen förmlich in die zum Teil senkrecht abfallenden Berghänge und Felswände hineingeschnitzt worden. 1 284 Kilometer misst die einzige Verbindungsstraße zwischen Pakistan und China. Das Bollwerk aus Himalaja, Karakorum, Hindukusch und Pamir kann nur hier ganzjährig überwunden werden. In Richtung Osten gibt es erst bei Kathmandu wieder eine Nord-Süd-Verbindung. Dazwischen liegen 1 400 km unbefahrbares, zerklüftetes Land. Will man westwärts eine alternative Route finden, müsste man durch Afghanistan, Usbekistan und Kirgisien fahren. Ein Umweg von mehreren tausend Kilometern und voller Kriegsgefahren.
Von 1958 bis 1978 dauerte die Errichtung des Highways, 45 000 pakistanische und chinesische Bauarbeiter waren beteiligt, offiziell starben 892 von ihnen. Meist ist er an die fünf Meter breit und fast durchgehend geteert. Welch ein Luxus in dieser so unwirtlichen Region! Wo auch immer der Karakorum-Highway sich entlang windet, wird er von hohen Bergen flankiert. Manchmal ragen die Gebirgsketten mehr als 6 000 m von der Straße bis in den Himmel.
Dieser Karakorum-Highway bildet für uns den perfekten Auftakt für Tibet. Wir müssen unsere Körper langsam an die dünne, sauerstoffarme Luft in großer Höhe gewöhnen. In Tibet werden wir wochenlang zwischen 4 000 und 5 500 Metern wandeln. Eine der größten Gefahren liegt in der so genannten Höhenkrankheit. Sie kommt mit Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemnot, Schlafschwierigkeiten und Ödemen einher. Treten diese Symptome auf, hilft nur noch ein sofortiger, schneller Abstieg in Regionen unterhalb von 2 500 m. Ansonsten kann sie zum Tode führen. Ein solcher Notabstieg wird auf unserer Route nicht möglich sein. Zu groß, zu gewaltig, zu hoch und exponiert ist das Hochland von Tibet.
Wir müssen uns also sehr gewissenhaft vorbereiten.
Prophylaktisch kann man der Höhenkrankheit entgegenwirken, wenn man sich in Ruhe großen Höhen nähert, dem Körper Zeit gibt. Der Karakorum-Highway ist dafür die richtige Strecke. Über mehrere hundert Kilometer steigt er auf pakistanischer Seite langsam aber stetig von knapp 1 000 auf fast 5 000 m an. In China angekommen, verbleibt man für fast 300 km in Höhen um 4 000 m.
Eine gute Basis für die Höhenanpassung.
Reich und fantasievoll verziert sind die pakistanischen Trucks, denen wir auf dem Karakorum-Highway begegnen. Zweiachser sind es für gewöhnlich und mit einer Unzahl an Spiegeln, kleinen Gemälden, Wimpeln, Fahnen und religiösen Glücksbringern geschmückt. Die Fahrer müssen an vielen Stellen harte Arbeit leisten. Steil sind die Anstiege und Abfahrten, oft schlecht die Bremsen. Noch steiler sind die Abbrüche neben der Straße, bis zu 800 m geht es senkrecht nach unten. Extrem hoch ist auch die Anzahl der Kurven und Schlaglöcher. Da fällt es schwer, die eigentlich immer überbeladenen Lastwagen auf der schmalen Straße zu halten. Zumal die Helden des Karakorum-Highway eine Acht-Stunden-Fahrregel nicht kennen. Wir treffen nicht selten Fahrer, die schon seit mehr als 48 Stunden am Steuer sitzen und bis unter die Haarspitzen voller Aufputschmittel und Opiaten sind.
Die ersten 300 km folgt der Karakorum-Highway dem Indus, dem zentralen Strom Pakistans. Zwei Drittel des Staates versorgt er mit Wasser. Dass in der wüstenartigen Mitte und im Süden des Landes überhaupt Ackerbau betrieben werden kann, ist allein diesem Strom zu verdanken.
Der Karakorum-Highway führt durch geologisch sensibles Gebiet. Halbstündlich bebt die Erde. Der Grund sind zwei tektonische Platten, die ausgerechnet hier aufeinanderstoßen. In einigen Regionen gibt es sogar im Minutentakt Erdstöße. Normale Brücken können dem nicht standhalten. So treffen wir nur auf Hängebrücken. Bautechnisch ein enorme Herausforderung! Der Karakorum-Highway und mit ihm auch die wenigen Pisten in die angrenzenden Täler werden oftmals verschüttet. Mit Steinschlägen muss man immer rechnen. Lawinenverbauungen wie beispielsweise in den Alpen sucht man vergebens. Dafür sind an den neuralgischen Stellen schwere Räumfahrzeuge stationiert. Zirka 1 500 Arbeiter kümmern sich darum, dass diese wichtige Lebensader zwischen Pakistan und China nie länger als drei Tage blockiert ist. Für den heutigen motorisierten Reisenden wird hervorragend gesorgt. Wie aber ist es den vielen Menschen ergangen, die in den vergangenen 6 000 Jahren die Strecke durch die wilden Berge als Handelsstrecke genutzt haben?
Die Berge sind das Highlight, an dem sich der Reisende kaum satt sehen kann. Viele sind 6 000, manche gar 7 000 m hoch. Doch der Nanga Parbat stellt sie alle in den Schatten. Für Steffen ist es der erste Achttausender, den er in seinem Leben sieht. Es ist ein gewaltiger Anblick. Kurz vor der Handelsoase Gilgit verlässt der Karakorum-Highway den Indus, wir erleben 51 °C und stehen vor dem Berg im Himalaja, der auch als „Schicksalsberg der Deutschen“ bekannt ist. Wohl weil in den ersten 50 Jahren des vergangenen Jahrhunderts vor allem deutsche Expeditionen versucht haben, den 8 125 m hohen Gipfel zu erstürmen. Anfangs sehen wir nur eine gigantische Wolkenmauer, aber just in dem Moment, in dem wir aufbrechen wollen, öffnet sich ein kleines Fenster und wir können die Gipfelpyramide sehen. Im ersten Augenblick denke ich an eine Einbildung: So weit oben im Himmel, da kann doch kein Berg mehr sein. Aber die Filmkamera mit ihrem Telezoom bringt die Bestätigung.
1939 nahmen der Deutsche Heinrich Harrer und Peter Aufschnaiter aus Österreich den Nanga Parbat in Angriff. Gipfelglück hatten sie keines. Noch während der Bergtour werden sie vom Ausbruch des Zweiten Weltkrieges überrascht, von britischen Soldaten festgenommen und in Kriegsgefangenschaft nach Nordindien überführt. Es gelingt ihnen zu fliehen und in einem langen Gewaltmarsch das tibetische Hochland und schließlich die damals für Ausländer verbotene Hauptstadt Lhasa zu erreichen. Auf unserem weiteren Weg werden wir ihre Spuren kreuzen. Immer wieder entdecken wir in den steilen Hängen Spuren von früheren Wegen durch diese scheinbar so unwirtliche Gebirgslandschaft. Heute nutzt man die Vorteile des Karakorum-Highways, aber noch zu Harrers und Aufschnaiters Zeiten brauchte man für die Anreise zum Fuße des Nanga Parbats mehrere Wochen. Wir sind bereits nach zwei Tagen da.
Faszinierend sind die vielen kleinen Oasen in dieser von Felsen, Geröll, Sand, Steinen und Staub geprägten Landschaft. Ich ziehe den Hut vor den Menschen, die hier Ackerbau betreiben. Terrasse für Terrasse, alle von kleinen Mauern aus aufgeschichteten Steinen begrenzt, gewinnen sie den steilen Hängen Quadratmeter um Quadratmeter Anbaufläche ab. Wasser führen sie teils über viele Kilometer mittels kleiner Kanäle herbei. Was musste es für eine ungeheure Anstrengung gewesen sein, sie einst zu errichten. Und wie mühevoll ist es wohl heute, allen Wettereinflüssen, Steinschlägen und Lawinen zum Trotz die Kanäle am Leben zu erhalten.
Am Abend des zweiten Fahrtages kommen wir in Gilgit an. Es ist das Drehkreuz im Karakorum. Nicht nur der Karakorum-Highway führt durch die etwa 10 400 Einwohner zählende Stadt, sondern auch Pfade und Tracks nach Afghanistan, Tadschikistan, China sowie nach Jammu und Kaschmir in Indien. Die Waren auf dem Basar zeugen davon, noch mehr allerdings die Händler, die wir treffen. Allein an ihrer Bekleidung kann man die Vielfalt der Herkunft und auch die Bedeutung von Gilgit als Handelsort ablesen. Vom Kashmir-Konflikt zwischen Pakistan und Indien ist hier nichts zu spüren. Die pakistanische Staatsmacht will Ruhe in diesem Gebiet. Die Straße ist ihnen wichtig, weil sie eine Lebensader nach China und Zentralasien ist und weil Touristen kommen, die gutes Geld ins Land bringen.
Doch immer wieder ist Gilgit für einige Tage Sperrzone. Meist dann, wenn sich die Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten in einem Schlagabtausch entladen, bei dem nicht selten Tote zu beklagen sind. Ursprünglich stellten Schiiten und Ismaili zu 85 Prozent die Bewohner in der Region um Gilgit. Doch das hat sich grundlegend geändert. Heute ist die Hälfte der Bevölkerung sunnitisch. Die meisten von ihnen sind Paschtunen und Punjabis, die mit Förderung der Zentralregierung in Islamabad zugewandert sind. Geschürt werden die Spannungen vor allem dadurch, dass sie meist bedeutende Posten bei der Polizei, dem Militär und in der Verwaltung bekleiden.
Gilgit ist der zentrale Ausgangsort für Bergsteiger im Karakorum. Egal, ob diese zu Trekkingtouren oder zu den großen Achttausendern K2, Broad Peak, Nanga Parbat aufbrechen wollen. Der erste Weg führt die meisten per Propellermaschine von Islamabad nach Gilgit. Sie scheuen die Fahrt auf dem Karakorum-Highway in einem der vielen Minibusse. Zu viele Kurven, zu zeitaufwändig, zu unbequem, das sind die Argumente, die man vernimmt, wenn man nach den Gründen fragt. Teilweise kann ich das verstehen. Dieser Teil des Karakorum-Highways ist der vielleicht wildeste. Nicht immer romantisch, dafür hochgradig interessant. Aus der Ebene erhebt er sich anfangs sanft, gesäumt von vielen kleinen Dörfern und noch mehr Feldern, um wenig später die ersten steilen Hügel noch spielerisch zu überwinden. Doch kaum hat man den gewaltigen Indus erreicht, ist es aus mit der beschaulichen Gemütlichkeit. Innerhalb weniger Kilometer ändert sich alles.
Wo eben noch die Farbe Grün die Augen beruhigte, herrschen nun Grau und Braun. Aus runden Bergkuppen werden nahezu senkrecht abfallende Felswände. Hier und da, immer dann, wenn Wasser auf kleinste flache Terrassen trifft, stehen meist ein paar einfache Bauernhäuser. Nicht nur am Indus selbst, sondern auch weit oben in den Bergflanken. Keines ist groß oder gar pompös. Klein, winzig klein sind sie, beherbergen ein, zwei einfachste Räume mit einer zentralen Kochstelle in der Mitte. Daneben gibt es einen Stall, mehr nicht. Es ist kein einfaches Leben hier. Im Winter wird es mitunter bitterkalt, die Winde eisig. Dann der jährliche Monsun in den Sommermonaten: Mit seinen Niederschlägen ist er zwar ein Segen für die Landwirtschaft, aber fast immer fällt der Regen so üppig, dass die Berghänge oberflächlich in Bewegung kommen und mit gewaltigen Muren, Lawinen und Steinschlägen die Landschaft verändern. Dann ist oft nicht nur der Karakorum-Highway verschüttet, sondern auch die Arbeit der Bauern auf den kleinen Feldern vernichtet.
Orte wie Besham und Chilas folgen auf dem Weg nach Gilgit. Auch sie sind steil umrandet. Immer, auch noch nachts, pulsiert in ihnen das Leben. Die zahlreichen Minibusse kommen rund um die Uhr, spucken Einheimische und mit ihnen viel Gepäck aus, nehmen sogleich andere Reisewillige auf. Auch sie sind mit viel Hab und Gut unterwegs. Wohl kaum einer hier ist des Urlaubes, des reinen Vergnügens wegen unterwegs. Sie verkaufen Waren, kaufen ein auf den Märkten in den wenigen größeren Orten am Kara-
korum-Highway oder gar in Rawalpindi. Oder sie reisen zu irgendwelchen entfernten Ämtern und Verwaltungsbehörden. Dafür sind sie von ihren abgelegenen Dörfern in den meist wegelosen Tälern oftmals Tage, wenn nicht sogar Wochen unterwegs. Haben sie erst einmal den Karakorum-Highway erreicht, liegt der schwierigste Teil der Reise hinter ihnen, von der Rückreise einmal abgesehen.
Gilgit ist der größte Ort im Norden. Auch er liegt mitten in den Bergen, aber sie sind nicht gar so bedrohlich nah. Man kann den Blick schweifen lassen, ohne die Augen in die Höhe richten zu müssen. Hotels gibt es reichlich. Inzwischen ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. Meist bleiben die Bergsteiger zwei, drei Tage, bevor sie zu ihren hohen und höchsten Zielen aufbrechen. Vor und nach dem Monsun sind dann die Herbergen der Stadt gut gefüllt. An manchen Tagen überfüllt; immer dann, wenn die Transportlogistik zusammenbricht. Alles ist so organisiert, dass die Betten geräumt werden, die Touristen mit dem Flieger abreisen und die neu Angekommenen sie wieder füllen. Darauf ist Gilgit ausgerichtet. Doch die Propellermaschinen können nur auf Sicht fliegen. Und die ist häufig mehr als schlecht. Bei einer früheren privaten Reise habe ich das selbst einmal erlebt. Für drei Tage fielen alle Luftverbindungen aus. Gilgit drohte zu platzen. Der einzige Ausweg war, mit einem der einheimischen Minibusse nach Islamabad zu fahren: 26 Stunden nonstop, fünf Reifenpannen und eine abenteuerliche Fahrweise, die in mir den Wunsch weckte, nur noch mit dem eigenen Gefährt diese Strecke zu absolvieren. Vielleicht habe ich 1990 nur die berühmte Ausnahme erlebt. Jedenfalls war in mir das Verlangen geboren, künftig eigenverantwortlich zu reisen. Ein Jahr später war es soweit: Mit Motorrad und mit Filmkamera.
Gilgit liegt uns mit seiner Höhe von 1 450 m für die Akklimatisierung zu tief, wir beschließen deshalb, bereits am nächsten Morgen nach Hunza aufzubrechen. Der Ort ist mit 2 800 m deutlich höher gelegen, hat ein milderes Klima und ist landschaftlich und kulturell reizvoller.
Allein der Weg dorthin ist ein Genuss. Der vielleicht spektakulärste Anblick liegt 70 km hinter Gilgit. Auf den ersten Blick sieht man nicht viel, nur eine Brücke über einen der zahlreichen Bäche. Drei Hütten stehen auf jeder Seite und Schilder, die einladen, hier eine Rast einzulegen. Davon gibt es viele am Karakorum-Highway. Doch diese sollte man auf jeden Fall nutzen, Zeit mitbringen und sich in einem der Gärten einen Tschai bestellen. Der Grund ist die Flanke, die sich unmittelbar von diesem Punkt aus 6 000 m in die Höhe zum Gipfel des Rakaposchi (7 788 m) erhebt. Zwischen dem Betrachter und dem Gipfel gibt es keine weiteren Gebirgsketten, keine vorgelagerten Kämme oder Gipfel. Es geht direkt nach oben. Der Gebirgsbach, an dessen unterem Teil man sitzt, führt das Auge durch die Geröllfelder in die Höhe. Es folgt ein fulminanter, hängender Gletscher und schließlich erblickt man den scheinbar messerscharfen Gipfelgrat.
Ein solcher Anblick löst unwillkürlich Gefühle der Demut und Dankbarkeit aus. Es wirkt wie ein dramatisches Vorspiel, wie eine gekonnte Inszenierung. Erst ist alles tief verhüllt, was Zweifel in einem aufkommen lässt, ob man den Gipfel überhaupt sehen wird. Erste Wolkenlöcher geben den Blick auf den unteren Teil des Massivs frei. Nach zwei Stunden folgt der erste Blick auf den Gletscher, aber nur für Sekunden. Schließlich ein rasantes Finale: Wo eben noch dicke Wolken die Sicht nahmen, streicheln dünne Nebelfetzen nun fast zärtlich die Flanke. Der Gipfel des Rakaposchi zeigt sich mit einer weißen Schneefahne vor tiefblauem Himmel.
Gewiss, wir werden auf unserem Weg noch viele grandiose Landschaften sehen. Aber sie werden anders sein, nie wieder von dieser Dimension, nie wieder so nah und gewaltig.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.