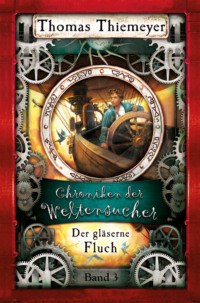Kitabı oku: «Der gläserne Fluch», sayfa 6
Teil 2
Inseln über der Zeit
13
London, eine Woche später …
Der Royal Musketeers Fencing Club war einer der ältesten Fechtclubs Londons. Ein Traditionsverein, der zu Zeiten von Lord Nelson und seinem legendären Sieg bei Trafalgar gegründet worden war und der den Ruf genoss, in seinen Kampfregeln genauso streng zu sein wie in der Auswahl seiner Mitglieder. Hier aufgenommen zu werden, setzte voraus, dass man über Verbindungen zu den höchsten Ebenen verfügte und im näheren Umfeld zur Queen stand. Ein Club für Mitglieder der Upperclass und solche, die es werden wollten.
Das runde Ziegelgebäude mit seiner goldenen Kuppel und seinem Umgang aus weißen Säulen grenzte direkt an die Themse unweit der Westminster-Kathedrale. Efeu umrankte die Säulen und die angrenzenden Platanen warfen lange Schatten. Das Rasseln von Klingen drang aus dem Inneren.
Max Pepper hatte Degen und Säbeln noch nie etwas abgewinnen können. Nicht, dass er den Umgang damit nicht beherrschte, er konnte Waffen nur generell nicht leiden. Er hielt sie für Standesmerkmale spätpubertierender Muttersöhnchen. Wer es für nötig hielt, anderen mit der Länge oder Größe seiner Waffe zu imponieren, dem hatte der liebe Gott entweder zu wenig Selbstvertrauen oder zu wenig Grips geschenkt. In den meisten Fällen eine Kombination aus beidem.
Er selbst sah sich als Mann des Geistes, der in der Lage sein sollte, jede Situation Kraft seines Verstandes zu meistern. Was nicht hieß, dass er ein wehrloses Opfer war. In der Stadt der Regenfresser hatte er seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Aber er empfand keine Liebe zum Töten.
»Lord Wilson macht um diese Uhrzeit immer seine Waffenrunden.«
Patrick O’Neill war ein sympathischer Rotschopf von der Grünen Insel, der viel redete und eine Menge Lachfältchen um die Augen hatte. So schlimm konnte Sir Wilson eigentlich nicht sein, wenn er einen solchen Mann an seiner Seite duldete. Andererseits … man sollte nie den Tag vor dem Abend loben.
Wie recht er mit seiner Skepsis hatte, zeigte sich, als O’Neill die beiden in die Umkleidekabinen führte und sie bat, ihre Sachen auszuziehen.
»Wir sollen was?« Pepper schaute auf O’Neill, der bereits in Unterhosen vor ihm stand.
»Sie müssen sich ausziehen und Trainingskleidung anlegen. Die Statuten des Clubs sind sehr streng«, erläuterte Sir Wilsons Assistent. »Keine Waffenkleidung, kein Eintritt.«
»Dann warte ich draußen.«
»Aber Sir Wilson hat ausdrücklich befohlen, Sie sollen ihn drinnen treffen. Ich glaube nicht, dass es ratsam wäre …«
»Ich habe nicht vor zu kämpfen«, sagte Pepper. »Ich werde ganz ruhig in der Ecke sitzen und zusehen.«
»Das macht keinen Unterschied. Es kann durchaus passieren, dass Sie gefordert werden. Glauben Sie mir, wenn das passiert, sind Sie glücklich, wenn Sie einen Anzug haben.« O’Neill schlüpfte in die Hose, zog die weiche wattierte Weste über seinen Kopf und tauchte grinsend daraus wieder hervor.
»Außerdem sieht es doch sehr kleidsam aus, oder?« Er breitete die Arme aus.
»Na, komm schon, Max.« Boswell klopfte ihm auf den Rücken. »Wir wollen doch nicht wie Weicheier dastehen. Wenn uns einer zu einem Waffengang fordert, wird er sein blaues Wunder erleben.«
»Das ist die richtige Einstellung«, sagte O’Neill. »Sir Wilson empfängt seine Mitarbeiter gern in ungewohnter Umgebung. Er ist der Auffassung, dass man Menschen besser einschätzen kann, wenn man sie neuen Situationen aussetzt. Nur wer sein gewohntes Terrain verlässt, zeigt sein wahres Gesicht.«
»Gilt das auch für ihn selbst?«
O’Neill blieb die Antwort schuldig. Das Lächeln, das um seinen Mund spielte, sprach allerdings Bände.
Pepper schlüpfte in seinen Kampfanzug. »Was ist eigentlich an den Gerüchten, dass Sir Wilson einer einfachen Arbeiterfamilie entstammt? Soll sein Vater nicht im Kohlebergbau tätig gewesen sein?«
O’Neill blickte ihn erschrocken an. »Woher wissen Sie das?«
Max zuckte mit den Schultern. »Ich hatte während der Überfahrt eine Menge Zeit und habe diverse Erkundigungen eingezogen. Recherche gehört zu meinen besonderen Talenten.«
»Wenn Ihnen Ihre Gesundheit am Herzen liegt, sollten Sie kein Wort darüber verlieren. Sir Wilson kann ausgesprochen unangenehm reagieren, wenn ihn jemand auf seine Vergangenheit anspricht. Besser, Sie vergessen alles, was Sie darüber gehört haben.« Er betrachtete sie prüfend. »Sitzen die Anzüge? Gut, dann können wir gehen.«
Die Trainingshalle des Royal Musketeers Fencing Club war ein vollendetes Rund von beeindruckenden Ausmaßen. Etwa dreißig Meter von Wand zu Wand und mit einer Höhe von über zwanzig Metern wirkte sie wie eine verkleinerte Ausgabe der Royal Albert Hall. Tatsächlich war sie von demselben Architekten erbaut worden, der so stolz auf seinen Entwurf war, dass er ihn gleich noch ein zweites Mal zur Ausführung brachte.
Warmes Nachmittagslicht strömte durch die schießschartenähnlichen Fenster und zauberte weiche Strahlen in den Raum. Die Luft war erfüllt von Atemgeräuschen und dem Klirren der Waffen.
Etwa fünfzehn Kämpfer waren anwesend. Kräftige, konzentriert aussehende Männer, die ihren Sport anscheinend sehr ernst nahmen. In ihrer Mitte, unschwer zu erkennen an seinen ungewöhnlichen Proportionen, Jabez Wilson. Seine Haare waren zu einem Pferdeschwanz nach hinten gebunden und auf seiner geröteten Haut glänzte der Schweiß. Seine Bewegungen zeugten von ungeheurer Kraft und Ausdauer. Vorstoß, Parade, Finte, Ausfallschritt. Präzises Timing, blitzschnelle Angriffe.
Sein Gegner war ein Mann, der beinahe einen Kopf größer und deutlich schlanker war. Das Haar war kurz geschoren und unter seinen buschigen Brauen leuchteten stählerne Augen. Eine lange bleiche Narbe zog sich quer über seine Schläfe bis runter zum Kinn. Beide Männer trugen keinen Gesichtsschutz.
Kaum hatten Pepper und Boswell den Saal betreten, als Wilson sie auch schon bemerkte. Er hob seinen Degen, grüßte seinen Fechtpartner und kam dann auf sie zu.
»Ah, die Herren aus New York«, keuchte er. »Kommen Sie, treten Sie näher. Ich freue mich, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen.« Max, dem es schwerfiel, seinen Blick von dem silbernen Auge abzuwenden, ergriff die Hand des Meteoritenjägers. »Ist mir eine Ehre, Sir Wilson.«
»Mir ebenfalls«, sagte Boswell. »Wir freuen uns sehr, mit Ihnen zusammen auf Expedition gehen zu dürfen.«
»Freuen Sie sich nicht zu früh«, sagte Wilson. »Das wird kein Spaziergang. Haben Sie Auslandserfahrung?« Er nahm von O’Neill ein Handtuch entgegen und wischte den Schweiß von seiner Stirn.
»Boswell ist der Erfahrenere von uns beiden«, sagte Max. »Er ist längere Zeit in Europa und Asien gewesen. Ich selbst war bislang nur in Peru.«
»Schon mal in Afrika gewesen?«
Max schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Und Sie, Boswell?«
Harry zuckte mit den Schultern. »Nur auf einen Zwischenstopp. Südafrika und Namibia. Nichts Weltbewegendes.«
Wilson lächelte. »Nun, das macht nichts, wir werden Sie schon zurechttrimmen. Ehe die Jagd zu Ende ist, haben wir aus Ihnen zwei richtige Beduinen gemacht. Sind Sie Rechts- oder Linkshänder?«
»Beide Rechtshänder, wieso?«
Wilson drehte sich um. »Jonathan, bringen Sie uns zwei Degen, Größe 3, rechtshändig.«
Der Mann mit der Narbe ging rüber an einen Waffenschrank und kam mit zwei schön gearbeiteten Waffen zurück. Aus der Nähe betrachtet wirkte der Mann älter, als es vorhin den Anschein gehabt hatte. Mindestens fünfundvierzig, eher fünfzig. Trotzdem sah er ungemein zäh und drahtig aus. Ein Mann, den man besser nicht zum Feind hatte.
»Darf ich Ihnen meinen Adjutanten, Mr Jonathan Archer, vorstellen? Hochdekorierter Infanterieoffizier der British Indian Army und für seinen Einsatz in der Schlacht von Kandahar mit den höchsten Ehren ausgezeichnet. Ihm obliegt die Führung meiner Einsatzgruppe.«
Der Mann deutete eine knappe Verbeugung an und händigte ihnen die Klingen aus. Max blickte darauf, als hätten sie eine ansteckende Krankheit. »Und was sollen wir damit?«
»Sich verteidigen natürlich«, sagte Sir Wilson. »Schauen wir mal, wie es mit ihren Kampfkünsten bestellt ist. Wie ich Sie einschätze, können Sie noch ein paar Trainingsstunden brauchen, ehe wir uns in den Senegal einschiffen.«
Pepper ließ die Klinge prüfend durch die Luft sausen. Die Waffe war erstklassig gefertigt und gut ausbalanciert.
»Nun gut«, sagte er. »Mit wem wollen Sie anfangen?«
Wilsons Zähne blitzten auf. »Wie wär’s mit Ihnen beiden?«
14
Es war weit nach dreiundzwanzig Uhr, als die Schlitten in Spandau eintrafen. Alles war in dichten Nebel gehüllt. Oskar war froh, dass sie endlich ankamen. Von den vielen Untiefen und Schneeverwehungen, durch die sie seit ihrer Abfahrt vom Plötzensee gekommen waren, tat ihm der Hintern weh. In den letzten Tagen hatte es noch einmal kräftig geschneit. Ganz Berlin lag unter einer dicken weißen Decke.
Dem Rumpeln und Knarren nach zu urteilen, waren die beiden Lastschlitten immer noch hinter ihnen. Gut so. Nicht auszudenken, wenn sie in der Kälte und Dunkelheit eine gebrochene Kufe hätten reparieren müssen.
Eliza und Charlotte saßen dick eingemummelt in ihre Decken und Jacken und schliefen gegeneinandergelehnt auf der Rückbank. Oskar konnte sich bei ihrem Anblick ein Lächeln nicht verkneifen. Glücklich, wer so einen gesegneten Schlaf hatte. Er selbst war immer noch ziemlich aufgewühlt von den Ereignissen am Silvesterabend. Bellheims seltsame Verwandlung und die anschließende Befragung durch die Polizei ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Kriminalkommissar Obendorfer war ein kleiner drahtiger Mann mit hellen, aufmerksamen Augen und einem perfekt gestutzten Bärtchen. Ein Mann, dem man anmerkte, dass er etwas von seinem Fach verstand. Ruhig und aufmerksam hatte er sie befragt und jedes Detail gewissenhaft notiert. Mit stoischer Ruhe sammelte er die Fakten, verglich und bewertete sie und kam zu dem abschließenden Urteil, dass Bellheims Fall ungeklärt blieb. In der Zeitung stand zu lesen, er sei geschmolzen, doch das war nur ein Notbehelf. Tatsache war, selbst die Kriminologen waren nicht in der Lage festzustellen, was wirklich passiert war. Eine Tötung oder gar ein Mord wurden jedoch ausgeschlossen. Humboldt und seine Begleiter wurden von jeglichem Verdacht freigesprochen und durften sich wieder frei bewegen.
Humboldt verbrachte zwei Abende mit Gertrud Bellheim und überzeugte sie davon, wie wichtig es war, schnell zu handeln und dem mysteriösen Schicksal ihres Mannes auf den Grund zu gehen. Die arme Frau stand immer noch unter Schock. Nur unter Schluchzen und Weinen ließ sie sich überreden, das Tagebuch ihres Mannes herauszurücken, doch sie sah ein, dass es für die Aufklärung des Falles von großer Bedeutung war. Sie erklärte sich sogar bereit, eine Expedition zu Ehren ihres Mannes ins Leben zu rufen und für den Großteil der entstehenden Kosten aufzukommen. Danach ging alles sehr schnell. Humboldt übernahm die Führung, koordinierte die Zusammenstellung der Instrumente und wissenschaftlichen Gerätschaften und ließ die Pachacútec flottmachen. Eliza erklärte Willi, Bert, Lena und Maus ihre Aufgaben im Haus und machte sich dann an die Zusammenstellung des Proviants. Und so kam es, dass sie heute, am neunten Januar, auf dem Weg nach Spandau waren. Auf dem Sprung in ein neues großes Abenteuer.
Oskar kniff die Augen zusammen. Vor ihnen waren Lichter in der Dunkelheit aufgetaucht. Fackeln warfen ihr gelbes Licht über den Schnee und wiesen ihnen den Weg. Ein Stück abseits, am Rand des Waldes gelegen, stand ein gewaltiger Heuschober. Kastenförmig und mit einer Höhe von gut fünfzehn Metern ragte er in die Nacht. Einige Männer hatten sich versammelt. Wie es schien, warteten sie auf sie. Oskar beugte sich nach hinten und stupste Charlotte und Eliza an.
»Aufwachen. Wir sind da.«
Wilma, die ebenfalls ein wenig gedöst hatte, steckte ihren Schnabel aus ihrem Federkleid. »Großer Vogel?«
Die Stimme kam aus dem Übersetzungsgerät, das wie ein Tornister auf ihrem Rücken befestigt war. Oskar streichelte Wilma über den Kopf. »Ja, meine Kleine, der große Vogel wartet bereits auf dich. Hüpf in dein Körbchen, dann trage ich dich rüber.« Das ließ sich der Kiwi natürlich nicht zweimal sagen. Blitzschnell krabbelte er von Charlottes Schoß und rein in sein Tragegestell. Charlotte blinzelte mit müden Augen hinaus in die Nacht. »Oh, es sind ja schon alle versammelt«, gähnte sie mit Blick auf die Fackeln. »Wie spät ist es denn?«
Oskar hielt seine Taschenuhr vors Auge. »Gleich halb zwölf.«
»Eine halbe Stunde über der Zeit«, gähnte sie. »Aber bei dem Wetter ist es ein Wunder, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Ich freue mich schon, wenn wir endlich in unsere warme, kuschelige Kajüte dürfen.«
Willi, der oben auf dem Kutschbock saß, fuhr seitlich neben die Scheune, hielt an und half den Insassen beim Aussteigen. Oskar hielt den Damen die Tür auf und nahm dann Wilmas Körbchen heraus. Jetzt kamen auch Bert und Maus mit den Lastschlitten. Lena saß bei Maus auf dem Kutschbock und sah aus, als würde sie nur aus Mütze und Handschuhen bestehen. Humboldt war bereits drüben bei der Scheune und wies die Lastschlitten ein. Dann redete er mit den Männern.
Das große Tor wurde geöffnet und das Luftschiff ins Freie gezogen. Das Licht der Fackeln schimmerte auf den bunt bemalten Flanken. Immer wenn Oskar die Pachacútec sah, staunte er über die mächtige Auftriebshülle. Die geschwungene Personengondel mit den großen Steuersegeln, die metallenen Motoren und die schnittigen Propeller waren jedes Mal faszinierend. Das Schiff, ein Geschenk der Regenfresser, war über und über mit indianischen Symbolen wie Schlangen oder Drachen bemalt. Wer sie zum ersten Mal sah, konnte es schon mit der Angst zu tun bekommen, doch die Männer, die Humboldt mit der Wartung und dem Schutz des Schiffes beauftragt hatte, waren den Anblick gewohnt. Wie es hieß, war Ferdinand Graf von Zeppelin gerade dabei, eine eigene Staffel von Luftfahrzeugen zu bauen, doch bis es so weit war, vergingen sicher noch Jahre.
Im Nu war alles verladen und in die Gepäckräume gepackt. Humboldt kletterte an Bord und aktivierte die Brennstoffzellen. Ein Teil des Wasserstoffes, der in Tanks auf dem Schiff lagerte, war bereits in die Auftriebshülle geströmt, während ein anderer Teil die Außenbordmotoren antrieb. Das Schiff rumpelte und bockte wie ein junges Pferd und die Männer hatten alle Mühe, es im Griff zu halten.
Als alles bereit war, kam das Signal. Humboldt schwenkte die Arme und rief: »Alles in Ordnung! Ihr könnt jetzt an Bord kommen!«
Oskar blies warme Luft in seine Hände. Das Rumstehen hatte ihn völlig ausgekühlt. Er freute sich, endlich in das geheizte Innere des Luftschiffes zu gelangen.
Er sagte seinen Freunden Lebewohl, dann kletterte er über eine Strickleiter an Bord und half die Leiter hochzuziehen. Jetzt gab Humboldt das Signal zum Aufbruch. Die Männer ließen die Seile los und mit schnurrenden Motoren stieg die Pachacútec in den Himmel. Oskar, Charlotte und Eliza beeilten sich, die Seile einzuholen und aufzuwickeln, dann war es endlich Zeit, ins wärmende Innere des Schiffes zu gehen. Humboldt startete den automatischen Kreiselkompass, dann folgte er ihnen.
Oskar winkte seinen Freunden ein letztes Mal zu, dann beeilte auch er sich, ins Innere zu gelangen. Ein eisiger Wind blies dem Schiff entgegen, als es eine Drehung um neunzig Grad vollführte und dann Kurs Südsüdwest einschlug. Mit sanft schnurrenden Motoren schwebte es in die sternklare Nacht hinaus.
15
Am nächsten Morgen in den Tafelbergen von Bandiagara …
Die Sonne war bereits über den Horizont gestiegen, als Yatimè den Rand der Klippe erreichte und zu dem gegenüberliegenden Tafelberg hinüberblickte. Zwischen ihrem und dem anderen Plateau lagen nur etwa fünfzig Meter, doch man musste ein Vogel sein, um hinüberzugelangen. Es sei denn, man betrat den schmalen Felsenbogen, der zur verbotenen Stadt führte. Eine natürliche Brücke in schwindelerregender Höhe, die die beiden Berge miteinander verband.
Das Dogonmädchen wusste, dass sie gegen den Willen ihres Vaters handelte, wenn sie den Bogen überquerte, aber sie hatte ihre Gründe. Ihr Vater – der Schmied des Dorfes – wollte heute die Esse anfachen und er konnte ausgesprochen unangenehm reagieren, wenn kein Feuerholz da war. Die Suche danach war nach der letzten Dürre schwieriger geworden. Bei den Bäumen rund um den Tafelberg war kaum noch etwas zu finden. Zweige durfte man nicht abbrechen, denn die Bäume gehörten einzelnen Dorfbewohnern, die sofort zum Ältesten rannten, wenn sie jemanden beim Holzstehlen beobachteten. Man hatte also die Wahl, entweder viele Kilometer ins Saû – das unbebaute Buschland – zu laufen oder den gegenüberliegenden Tafelberg zu betreten und das Risiko einzugehen, erwischt zu werden. Das Betreten des Plateaus war unter Strafe verboten. Seit in einer Nacht vor vielen Hundert Jahren das rätselhafte Volk der Tellem diesen Stein in die Stadt gebracht hatte, lag ein Fluch darüber. Die Bewohner hatten sich verändert und waren zu Ungeheuern geworden, hieß es. Die Dogon hatten damals blutige Kämpfe ausgefochten und dem Unheil, das auf dem Tafelberg schlummerte, ein Ende bereitet. Seitdem waren sie zu den erklärten Hütern des Geheimnisses geworden. Sie hatten darauf geachtet, dass niemand den Berg betrat, selbst dann nicht, wenn er friedfertig war und Geschenke brachte. Wer den Gesetzen zuwiderhandelte und dennoch die Stadt betrat, konnte aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen werden. Doch das war noch nie geschehen. Niemand war so verrückt, freiwillig den Berg der Tellem zu betreten. Es hieß, dort lebten die Geister der Ahnen, die jeden, der sich zu weit vorwagte, zu Stein verwandelten.
Yatimè hielt das für Unsinn.
Die Leute hatten einfach Angst und suchten nur nach einem Vorwand, der ihre Furcht rechtfertigte. Die Geschichte von dem mysteriösen Stein kam ihnen da gerade recht.
Yatimè war zwölf Jahre alt und die zweite Tochter des Schmieds. Sie stand, was Ansehen und Respekt betraf, auf einer niedrigen Stufe, niedriger sogar noch als ihre ältere Schwester, und das wollte etwas heißen. Ihre Schwester war eine hohle Nuss, die sich nur für ihr Aussehen interessierte. Sie prahlte alle naselang, dass sie eines Tages den Sohn des Metzgers heiraten und ihm eine Menge Kinder schenken würde.
Yatimè fand dieses System ungerecht.
Seit sie denken konnte, fühlte sie, dass sie anders war. Im Dorf genoss sie den Ruf eines Sonderlings. Nicht nur, weil sie nachts zu den Sternen sang oder mit Tieren sprach, nein, sie konnte in ihren Träumen Dinge sehen, die noch nicht geschehen waren. Erst kürzlich hatte sie wieder einen solchen Traum gehabt. Sie hatte Menschen mit heller Haut gesehen, die auf einem riesigen Tier über den Himmel geritten kamen, genau, wie es in der Prophezeiung hieß. Doch ihre Mutter hatte wie immer den Kopf geschüttelt und gesagt, in ihr wohne der Geist der Tellem. Die anderen Kinder hänselten sie deswegen, doch Yatimè war das egal. Sie mied ihre Gesellschaft und trieb sich lieber allein draußen im Buschland herum. Die Stille und die Einsamkeit machten ihr nichts aus. Außerdem – ganz allein war sie ja nicht. Ihr Freund Jabo war stets in ihrer Nähe. Jabo war ein Mischlingsrüde, den Yatimè als Welpen gefunden und aufgezogen hatte. Eine Hyäne oder ein Schakal hatte das Jungtier gepackt und übel zugerichtet. Es hatte Wochen gedauert, ihn wieder aufzupäppeln. Jabo hatte nur ein Auge. Eines seiner Ohren war ausgefleddert und außerdem hinkte er ein wenig. Aber das machte nichts. Er war der beste Beschützer, den man sich nur wünschen konnte. Aufmerksam, hellhörig und mit dem Mut eines Löwen gewappnet. Die anderen Kinder mochten ihn nicht. Er war hässlich, angriffslustig und schnell beleidigt, aber Yatimè war nett zu ihm und deshalb vertraute er ihr. Vielleicht spürte er aber auch, dass sie genau so ein Außenseiter war wie er.
Yatimè folgte der Abbruchkante des Berges in Richtung des schmalen Felsbogens. Sie hätte gern größere Schritte gemacht, doch der Wickelrock behinderte sie. Sie blieb stehen und band den Saum ihres Rocks bis zu den Oberschenkeln hoch. Dann steckte sie zwei Finger in den Mund und stieß einen Pfiff aus.
Jabo kam aus dem Unterholz. Die Zunge heraushängend und mit seinem einen Auge mürrisch in die Gegend spähend, kam er herbeigehumpelt.
»Wo warst du nur so lange?« Yatimè streichelte ihrem Freund über den Kopf. »Hast du wieder Kaninchen gejagt? Du weißt doch, dass die kleinen Biester zu schnell für dich sind. Nimm’s nicht so schwer. Für alle Fälle habe ich ja immer einen Streifen Trockenfleisch mit dabei.« Sie klopfte auf ihren Schulterbeutel. »Du musst ihn dir natürlich verdienen. Ich habe vor, in die verbotene Stadt zu gehen. Kommst du mit?«
Jabo hielt den Kopf schief.
»Ist nicht weit. Dort drüben, bei den grünen Büschen fängt sie an. Dort gibt es Schatten, Holz und etwas zu essen, also komm.«
Jabo kläffte kurz, dann rannte er auf den Felsbogen zu. Yatimè klemmte den Beutel unter den Arm und eilte hinter ihm her.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.