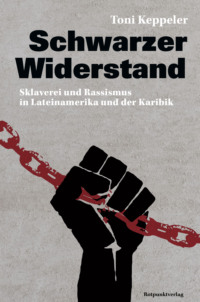Kitabı oku: «Schwarzer Widerstand», sayfa 2
Aus dem Schlachthaus zur Verschwörung im Wald
Der erste Europäer, der seinen Fuß auf die zweitgrößte Insel der Karibik gesetzt hatte, war Cristóbal Colón, Christoph Kolumbus. Am 25. Dezember 1492 lief die Santa María, das größte seiner drei Schiffe, auf eine Sandbank. Die dahinter liegende Insel nannte er »La Española«, Hispaniola, die Spanische. Der Strand, an dem die Santa María havarierte, liegt im Nordosten des heutigen Haiti und trägt noch immer den Namen des Schiffs.
Die Gegend ist ein Paradies für Meeresbiologen. Hinter einem Riegel aus Korallenriffen liegt die größte Mangrovenreserve Haitis. Dort finden selten gewordene Meerestiere wie die Lederschildkröte noch Unterschlupf. Das Dorf nahe der Küste heißt Caracol, das spanische Wort für Schneckenmuschel. Im haitianischen Kreyòl heißt diese Muschel lambí. Ihr Fleisch ist eine beliebte Speise, und das Gehäuse hat als Signalhorn mythische Bedeutung. Die Bewohner von Caracol leben von der Fischerei und von der Salzgewinnung und betreiben ein bisschen Landwirtschaft. Ein paar Meter hinter dem Mangrovenwald haben sie mehrere Meter tiefe große viereckige Gruben in den Strand gegraben. Das einsickernde Grundwasser vom Meer verdunstet, große Salzkristalle werden abgeschöpft und zwischen den Becken zu an kleine Vulkane erinnernde Haufen aufgeschichtet und getrocknet. Die Arbeit wird vor allem von Frauen gemacht, und sie verdienen kaum etwas damit.
Die Santa María war – so Kolumbus – nach ihrer Strandung unrettbar verloren. Er hielt sein Flaggschiff ohnehin für zu schwerfällig für eine Expedition. Er ließ es auseinandernehmen, um aus den Holzplanken Häuser zu bauen. Bei der Weiterreise ließ er ein paar seiner Männer auf der Insel zurück. Die war damals von gut einer Million Taíno bewohnt, ein zu den Arawak gehörendes karibisches Volk. Sie nannten ihr Land Ayiti, das bergige Land. Sie bauten Yuca, Mais und Süßkartoffeln an und kannten den Tabak. Und sie hatten Gold. Kolumbus beschrieb sie in seinem Logbuch als freundlich und friedfertig. Sie seien »unschuldig und von einer solchen Freigiebigkeit mit dem, was sie haben, dass niemand es glauben würde, der es nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Was immer man von ihnen erbittet, sie sagen nie Nein, sondern fordern einen ausdrücklich auf, es anzunehmen und zeigen dabei so viel Liebenswürdigkeit, als würden sie einem ihr Herz schenken.« Natürlich nahm er ihr Gold. Als er aber ein gutes Jahr später wieder vorbeikam, war es vorbei mit der Liebenswürdigkeit. Seine Siedlung war zerstört, seine Männer waren getötet worden. Kolumbus war wütend und köpfte zur Strafe einen Taíno – der erste dokumentierte Mord eines Spaniers an einem Ureinwohner des amerikanischen Kontinents. Es war der Auftakt zu einem Völkermord.
Fünfzig Jahre später waren die Taíno so gut wie ausgerottet. Zwangsarbeit in Goldminen, grausame Strafen und eingeschleppte, ihnen unbekannte Krankheiten hatten sie dahingerafft. Schon 1517 importierten die Spanier die ersten afrikanischen Sklaven für ihre Zuckerrohrplantagen. Sie nannten die Insel später Santo Domingo nach der gleichnamigen von einem Dominikanermönch gegründeten Stadt im Südosten. Mit den ersten schwarzen Sklaven auf der Insel begann auch deren Widerstand, nicht in der Form von Rebellionen oder Aufständen, sondern als Flucht aus den Plantagen in den Küstenebenen. Bereits im 16. Jahrhundert wurden erste Siedlungen von sogenannten cimarrones im unzugänglichen Bergland gegründet. Das spanische Wort cimarrón bezeichnet eigentlich ein entlaufenes Haustier, was viel über die Einstellung der spanischen Sklavenhalter gegenüber ihren Sklaven aussagt.
Frankreich hatte sich 1635 südöstlich von Santo Domingo die Inseln Martinique und Guadeloupe als Kolonien angeeignet. Von der Pirateninsel Tortuga, in Sichtweite vor der nordwestlichen Küste von Santo Domingo, sickerten seit Mitte des 17. Jahrhunderts mehr und mehr französische Siedler ein und gründeten dort Zuckerrohrplantagen. 1697 besetzte Frankreich den Westteil der Insel; Ende des Jahres trat Spanien ihn ab, und er wurde offiziell französische Kolonie. Der Name blieb, wurde französisiert in Saint-Domingue, obwohl die namensgebende Stadt auf dem spanischen Ostteil der Insel lag.
Saint-Domingue wurde die rentabelste Kolonie der Welt. Ende des 18. Jahrhunderts war sie der größte Zuckerproduzent, lieferte mehr als Jamaika, Kuba und Brasilien zusammen. Die Hälfte des weltweit geernteten Kaffees kam von dort. Saint-Domingue war für Frankreich wertvoller, als es die dreizehn nordamerikanischen Kolonien zusammengenommen für Britannien waren. Man nannte die Inselhälfte die »Perle der Karibik«.
Cap Français – heute Cap Haïtien –, der wichtigste Ausfuhrhafen im Norden, hatte gut zwölftausend Einwohner und war größer und eleganter als Boston. Der kubanische Schriftsteller Alejo Carpentier beschreibt die koloniale Stadt in seinem Haiti-Roman Das Reich von dieser Welt: »Fast alle Häuser hatten zwei Stockwerke, Balkone, die, mit breiten Vordächern versehen, um die Ecken herumgeführt waren, und hohe Eingangstüren mit Lünettenoberlicht, feingearbeiteten Schlössern und Kleeblattbeschlägen. Es gab mehr Schneider, Hutmacher, Federhändler, Friseure; in einem Laden wurden Geigen und Flöten angeboten, auch Partituren von Kontertänzen und Sonaten. Der Buchhändler stellte die letzte Nummer der Gazette de Saint-Domingue aus, auf leichtes Papier gedruckt, die Seiten aufgeteilt mit Linien und Vignetten. Und als höchster Luxus war ein Theater für Drama und Oper in der Rue Vandreuil eröffnet worden.« Und an anderer Stelle: »An einer Straßenecke ließ ein Schausteller Marionetten tanzen. Weiter vorn bot ein Matrose den Damen ein brasilianisches Äffchen an, das nach spanischer Mode gekleidet war. In den Tavernen wurden Weinflaschen entkorkt, die in Fässern voll Salz und nassem Sand kühl gehalten wurden.«
All dieser Reichtum war mit dem Blut hunderttausender Sklaven geschaffen worden. Bis 1791, dem Beginn ihrer Revolte, waren über eine Million Menschen aus Afrika nach Saint-Domingue verschleppt worden, die meisten aus dem Kongo und der Gegend zwischen dem heutigen Liberia und Nigeria. Sie wurden mit den Brandzeichen ihrer Besitzer markiert und überlebten meist nicht lange. Nachwuchs unter den Schwarzen gab es eher selten. Die Frauen kannten die nötigen Kräuter und Methoden, um Schwangerschaften abzubrechen. Oft wurden Neugeborene auch ertränkt. Man wollte ihnen das grausame Schicksal ihrer Eltern ersparen. Auch Selbstmorde waren häufig.
Jedes Jahr starben zwischen fünf und zehn Prozent der Sklaven an Hunger, Überarbeitung, Krankheiten und Folter. Körperstrafen waren so willkürlich wie üblich, Peitschen die ständigen Begleiter der Aufseher auf den Plantagen. Wer beim Kauen von Zuckerrohr erwischt wurde, bekam einen mit einem Schloss versehenen eisernen Käfig über den Kopf gestülpt und musste so unter der sengenden Sonne weiterarbeiten, ohne die Möglichkeit, Wasser zu trinken. Diebstahl wurde mit Kastration oder Amputationen bestraft – eine Hand, ein Arm, ein Bein. Bisweilen belustigten sich die Weißen auch an ihren Strafen. Es sind Fälle verbürgt, bei denen Sklaven Schwarzpulver in den Anus gefüllt und entzündet wurde. Die Weißen nannten dies »einen Neger hüpfen lassen«. Aufmüpfige Sklaven wurden lebendig in einen Backofen geworfen oder bis zum Kopf eingegraben und den Moskitos und Ameisen überlassen. Entlaufene und wieder eingefangene wurden öffentlich zu Tode gefoltert, gevierteilt, die Knochen langsam unter einem Wagenrad zerbrochen, auf einem Scheiterhaufen lebendig verbrannt.
Madison Smartt Bell hat diese Grausamkeiten in einer penibel recherchierten über zweitausend Seiten starken Romantrilogie beschrieben. Haitianische Historiker sagen, dies sei das Werk, das der Realität vor und während der Revolution am nächsten komme. Im ersten Band, Aufstand aller Seelen, lässt Bell einen seiner Protagonisten – den weißen Arzt Doktor Hébert – zufällig zu einer solchen Folterszene kommen: »Es war kein richtiges Kreuz, nur ein Pfahl oder vielmehr ein Baumstamm, an dem die Rinde noch dran war. Oben sah man die Spuren der Kette, an der er ohne Zweifel hierhergeschleift worden war. Ungefähr einen Fuß oder achtzehn Zoll unterhalb der Stelle, wo die Kette ihren Abdruck hinterlassen hatte, waren die Hände der Frau mit einem großen vierkantigen Nagel auf das Holz genagelt worden, die linke über die rechte, die Handflächen zeigten nach vorn. Von dort, wo der Nagel ins Fleisch gedrungen war, war Blut bis zur Innenseite der Unterarme geflossen und in der trockenen Hitze zu einer harten Kruste geworden. Der Doktor schloss daraus, dass sie schon mehrere Stunden so hing. Es überraschte ihn, dass sie noch lebte. Vom Fixpunkt des Nagels herabhängend, wurden ihre Muskeln nach oben gezogen und hoben die straffen Brüste mit den geschwollenen Brustwarzen und großen Höfen. Obwohl ihr Gewicht vermutlich das Zwerchfell bis zum äußersten spannte, war die Haut auf dem Bauch ziemlich schlaff. Von ihrer Scham hing ein schwammiger Gewebefetzen herunter, von dem der Doktor die Augen abwandte. Die Füße waren mit einem ähnlich groben, selbstgeschmiedeten Nagel übereinandergenagelt wie die Hände.« Öffentlich grausame Exempel zu statuieren, war den Siedlern wichtiger als die Arbeitskraft der Schwarzen; die konnte billig nachgekauft werden.
Als in Frankreich 1789 die Revolution im Namen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit begann, gab es in der Kolonie Saint-Domingue nach den Angaben der damaligen Kolonialverwaltung 40’000 Weiße und 28’000 freie Farbige, sogenannte gens de couleur, die aus – für die Frauen meist unfreiwilligen – Beziehungen von Weißen und schwarzen Sklavinnen hervorgegangen waren. Dazu kamen 452’000 schwarze Sklaven. Da der Sklavenbesitz besteuert wurde, kamen viele Schwarze als Schmuggelware illegal ins Land; die tatsächliche Zahl der Sklaven dürfte deshalb deutlich höher gewesen sein. Rund drei Viertel von ihnen waren noch in Afrika geboren worden und erinnerten sich daran, was Freiheit bedeutete. Über 40’000 waren vor weniger als einem Jahr in die Kolonie verschleppt worden. Viele dieser Sklaven kamen aus Zentralafrika, damals eine von Kriegen geplagte Region. Sie waren Soldaten gewesen, die nach einer verlorenen Schlacht von den Siegern an europäische Sklavenjäger verkauft worden waren. Sie konnten mit Feuerwaffen umgehen und kannten die militärische Taktik kleiner mobiler Einheiten. Das einzige, was ihnen für einen Aufstand in Saint-Domingue fehlte, waren Gewehre.
Kleinere Rebellionen hatte es in der Kolonie immer wieder gegeben, die erste schon 1522. Mehrere Gruppen entlaufener Sklaven, die sich im bergigen Hinterland der Plantagen in der nördlichen Küstenebene versteckten, nahmen immer wieder kleinere Überfälle vor oder legten den Weißen Hinterhalte nach Guerillamanier. Mitte des 18. Jahrhunderts wurden diese Gruppen von François Mackandal (im haitianischen Kreyòl Franswa Makandal geschrieben) zu einer schlagkräftigen Truppe vereint. Mackandal war ein in Afrika geborener Sklave, der zunächst nach Jamaika verschleppt und von dort nach Haiti weiterverkauft worden war. Er war auf einer Plantage zum Krüppel geschlagen worden und entlaufen. Seine hauptsächliche Waffe war das Gift. Er verteilte seine Pülverchen und Essenzen an Haussklaven, die diese ins Essen ihrer weißen Herren mischten. Es ist schwer zu schätzen, wie viele solcher Attentate es gab. Mackandal war beim Giftmischen so geschickt, dass es kaum zu unterscheiden war, ob jemand an Cholera, Gelbfieber oder an Gift gestorben war. Die panische Angst der Weißen vor dem Gifttod aber ist in vielen Quellen belegt.
Mackandals Truppe überfiel nächtens Plantagen, brannte Zuckerrohrfelder und Gebäude nieder und tötete die Besitzer. Rund sechstausend Menschen starben bei diesem Aufstand. Die Weißen fürchteten schon, Mackandal werde sie alle aus der Kolonie verjagen. 1758 aber wurde er von einem Verbündeten verraten, bei einer Vodou-Zeremonie erkannt und gefangen genommen, gefoltert und auf einem öffentlichen Platz in Cap Français auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Vodou-gläubige Zuschauer waren davon überzeugt, dass er die Hinrichtung überlebt habe, indem er sich in eine Fliege verwandelte und entfloh. Er sei dann später als Mückenschwarm zurückgekommen, um die Franzosen mit dem Gelbfieber zu bestrafen.
Mackandals Aufstand, sein Tod und die vom Volksglauben darum herum gesponnenen Mythen waren das Vorspiel zum großen Aufstand von 1791. Die Gelegenheit war günstig, denn die Sklavenhalter hatten sich untereinander zerstritten. Die Kunde von der Französischen Revolution und deren Diskurs von den grundlegenden Menschenrechten war auch in Saint-Domingue angekommen. Die freien Farbigen nahmen dies auf und forderten ein Ende ihrer Diskriminierung. Sie waren zwar frei und hatten oft selbst schwarze Sklaven, waren jedoch von Ämtern in der lokalen Verwaltung ausgeschlossen. Berufe wie Anwalt oder Arzt waren ihnen verboten, und sie durften auch keine luxuriösen Kleider und Möbel kaufen. Aber sie stellten den größten Teil der Polizei und der Kolonialmiliz und hatten so Zugang zu Waffen.
Die französische Regierung verweigerte trotz ihrer revolutionären Verlautbarungen jegliches Zugeständnis gegenüber den freien Farbigen. Frankreich war wirtschaftlich am Boden und in Kriege mit allen Nachbarn verwickelt. Saint-Domingue war die einzige verlässliche Einnahmequelle. Die Revolutionäre in Paris sahen deshalb in der Diskriminierung von Farbigen und Schwarzen eine zwar böse, aber notwendige Ausnahme von ihrer egalitären Ideologie. Von den weißen Plantagenbesitzern in Saint-Domingue konnten die freien Farbigen erst recht kein Entgegenkommen erwarten. So kam es 1790 zu einem Aufstand. Der wurde zwar schnell niedergeschlagen und der Anführer Vincent Ogé unter dem Rad zu Tode gefoltert, vereinzelte Scharmützel aber gab es weiterhin. Sowohl weiße wie farbige Plantagenbesitzer zogen mit ihren Sklaven als Fußvolk in diese Kämpfe – mit dem Nebeneffekt, dass nun auch Schwarze bewaffnet wurden.
Der große Aufstand der Sklaven wurde bei einer geheimen Zeremonie der Vorarbeiter verschiedener Plantagen in der Nacht des 14. August 1791 im Wald von Bois Caïman (haitianisch Bwa Kayiman) in der Nähe von Cap Français verabredet. Es gibt in Haiti Legenden, nach denen Toussaint Louverture, der spätere Führer des Aufstands, dieses Treffen einberufen habe. Das ist durchaus möglich. Louverture war Vorarbeiter und Kutscher seines Herrn und kam als solcher viel auf anderen Plantagen herum. Es gibt aber keinen sicheren Beleg für seine Anwesenheit in Bois Caïman. Wenn er dort war, hielt er sich im Hintergrund. Zeremonienmeister und dann auch der erste Anführer des Aufstands war Boukman Dutty, ein in Afrika geborener und zunächst nach Jamaika verschleppter Sklave. Wie Mackandal war er wegen seiner Aufmüpfigkeit von dort nach Saint-Domingue verkauft worden. Boukman war ein hungan, ein Vodou-Priester, das nächtliche Treffen der Verschwörer eine von Trommeln, Tänzen und Ekstase begleitete Vodou-Zeremonie.
Jean Price-Mars, der haitianische Historiker, Volkskundler und Vorvater der négritude-Bewegung, hat dieses Treffen beschrieben. Seine Schilderung, aus seiner 1928 erschienenen Sammlung von Studien über vorher nur mündlich tradierte Legenden und Bräuche Ainsi parla l’Oncle (»So sprach der Onkel«), lautet: »In der schwarzen Nacht, zwischen den verschlungenen belaubten Ästen des Mapou-Baums, trafen sich die Verschwörer – ein lautloses Ensemble, mit nur einem Herz und einem Denken. Zahllose Blitze durchzogen die Wolken. Die Stimme des Donners fügte der Kulisse des Schreckens das Entsetzen hinzu. Da, in der Stille im Schatten, gab die Priesterin unverständliche Zeichen von sich und versenkte das Opfermesser in der Kehle des Wildschweins. Dann stellte sie die Eingeweide auf dem blutüberströmten Boden zur Schau, und Boukman verkündete die heiligen Worte: ›Der gute Gott, der die Sonne macht, die uns von oben erhellt, der das Meer emporhebt, der das Gewitter zum Donnern bringt, versteht es, dieser gute Gott ist versteckt hinter den Wolken. Von dort aus betrachtet er uns und sieht alles, was die Weißen tun. Der Gott der Weißen befiehlt das Verbrechen, unser Gott dagegen will Wohltaten. Aber dieser gute Gott befiehlt uns nun Vergeltung. Er wird uns führen und uns beistehen. Zerschmettert das Bild des Gottes der Weißen, der Durst hat nach unseren Tränen. Hört den Ruf der Freiheit.‹«
Die Darstellung ist sicher nicht historisch, sondern aus in Haiti umlaufenden Legenden rekonstruiert und dramatisiert. Solche geheimen Treffen aber sind seit Beginn der Kolonialzeit belegt. Sie fanden nachts statt, »für die freie Ausübung des Kults«, wie Price-Mars schreibt. »Ohne Zweifel nahmen diese Treffen in der Folge einen eindeutig politischen Charakter an, aber es wird bestätigt, dass sie ursprünglich kultisch waren.« Die Religiosität, die dabei gepflegt wurde, sei »in vielerlei Hinsicht neu, eine Tochter der Umstände und der Notwendigkeit des Moments. Und das ist, wie uns scheint, der Ursprung unseres Vodou. Er ist schlechthin eine Mischung verschiedener Glaubensrichtungen, ein Kompromiss aus dahomey’schen, kongolesischen, sudanesischen und anderen Animismen.«
Diese ursprüngliche Naturreligion wurde im Wald von Bois Caïman eminent politisch. Man kann die Befreiung und die heutige Kultur Haitis nicht verstehen, ohne etwas über Vodou zu wissen.
Vodou als Religion des Aufstands
Das europäische kenntnislose Bild von Vodou besteht gemeinhin aus mit Nadeln traktierten Stoffpuppen und Zombies, die wie Graf Dracula um Mitternacht aus ihren Gräbern steigen und Unheil über die Lebenden bringen. Diese Vorstellungen wurden von Hollywood erfunden. Schon 1934 wurde White Zombie gedreht, der erste Horrorfilm über Haiti. Er basierte auf Landser-Romanen von US-Soldaten, die darin ihre Erlebnisse während der US-Besatzung Haitis zwischen 1915 und 1935 verarbeitet haben. Die Soldaten – in ihrer Mehrheit arme und ungebildete Weiße aus den Südstaaten – hatten einen Höllenrespekt vor schwarzen Guerillakommandos. Diese schlichen sich nachts in die Lager der Besatzer, man sah nichts als ihre weißen Augen und ihre weißen Zähne. Sie hatten keine Feuerwaffen, sondern Messer, und damit schlitzten sie die Kehlen der Weißen auf. Das ist tatsächlich geschehen. Alles andere ist Erfindung. Auf White Zombie folgten Dutzende weitere Horrorfilme. Aus Vodou, wie es in Haiti meist geschrieben wird, wurde das US-amerikanische Zerrbild des Voodoo. Und eine Religion, die im Widerstand gegen die Sklaverei und die Plantagenwirtschaft eine zentrale Rolle spielte, die für Autonomie und Würde steht, wurde zu einem Sinnbild der Barbarei gemacht.
Der hunfò, in dem Max Beauvoir lange Jahre als hangun gewirkt hat, sieht gar nicht nach dem Szenario eines Horrorfilms aus. Ein hunfò ist eine Zeremonienstätte des Vodou, ein hangun ein Priester dieser Religion, und Beauvoir war, als er im September 2015 starb, zehn Jahre lang der Vorsitzende und Sprecher der Priestervereinigung Haitis gewesen. Das ist nicht so etwas wie ein Papst des Vodou – die Religion kennt keine Hierarchie. Er war eher der erste unter gleichen und als solcher der prominenteste und einflussreichste Vodou-Priester des Landes.
Sein Anwesen lag ein paar Kilometer außerhalb der Hauptstadt in Mariani, hinter einer Mauer entlang der Nationalstraße 2, die von Port-au-Prince nach Léogâne führt. Am Eingang ein Wächterhäuschen, die Türen blau und rot gestrichen, die Farben der Flagge Haitis. Auch die Plastikstühle davor waren blau und rot. Ein paar ältere Frauen und Männer hingen mehr in diesen Stühlen, als dass sie saßen. Ein junger Mann kündigte dem Priester den Besuch an. Im hinteren Teil des Anwesens vor einer weiteren Mauer stand ein Wohnhaus, in dem ein Dieselgenerator ratterte. Zwischen Mauer und Haus eine von der Sonne verbrannte Wiese, bestanden mit Mangos, Palmen und Cashewbäumen. Schwarze Hühner staksten durch das spärliche Gras, eine weiße Taube turtelte. Unwillkürlich stellte ich mir vor, wie diese Tiere bei der nächsten Zeremonie geopfert und die Gläubigen mit ihrem frischen Blut bespritzt würden.
Das eigentliche Sanktuarium lag hinter der zweiten Mauer. Beauvoir, ein großer schlanker Mann mit weißem Haarkranz und dunklen Ringen unter den tief liegenden Augen, öffnete die Tür in der Mauer und führte uns dahinter an einen Tisch im Schatten. Er musste über die Vorstellung von den Hühnern und dem Opfer lachen und meinte amüsiert: »Das kann wohl so sein.« Er war damals 78 Jahre alt und trug, was ältere Haitianer der Mittelschicht tragen, ein weites weißes kurzärmliges Hemd, die sogenannte Guayabera, über einer braunen Hose. Die nackten Füße steckten in Plastikschlappen. Er rauchte eine Zigarette nach der anderen, Marlboro light.
Beauvoir gehörte zu den Privilegierten Haitis. Er hatte im Ausland studiert. Er hatte einen Abschluss in Chemie aus New York und einen in Biochemie von der Sorbonne in Paris. Er hatte in Forschungsinstituten und in der Privatwirtschaft in den USA gearbeitet und sich vor allem mit aus Pflanzen gewonnenen Hydrocortisonen beschäftigt. 1973 war er nach Haiti zurückgekehrt. Er hatte ein Patent angemeldet und wollte ein eigenes Biochemielabor aufbauen. Dann starb 1974 sein Großvater, ein angesehener Vodou-Priester. Die Familie saß am Sterbebett, und der Großvater, in seinen letzten Stunden, zeigte auf ihn und sagte: »Du wirst die Tradition fortsetzen.«
Beauvoir hatte sich vorher nicht intensiv mit Vodou beschäftigt. Er war Naturwissenschaftler, kein Animist. Er glaubte, der Großvater habe sich getäuscht, er sei nicht der Richtige. »Aber da war etwas, gegen das ich mich nicht wehren konnte.« Er begann, die Religion zu studieren, zunächst eher intellektuell. Er sagte, es habe lange gedauert, bis er zum ersten Mal von einem lwa geritten wurde.
Lwa sind die Geister des Vodou, Zwischenwesen zwischen den Menschen und bondye, dem guten Gott, der weit weg ist. Bondye mischt sich nicht in das Leben der Menschen ein, er pflegt mehr den Müßiggang. Es gibt keine konkreten Vorstellungen von ihm. Er ist kein alter Mann mit weißem Bart, eher so etwas wie das Prinzip des Guten, das über allem schwebt und stärker ist als die lwa, die ihn auf Erden vertreten. Sie sind es, die bei Vodou-Zeremonien gerufen werden, die herunter- und in die Menschen hineinfahren und sie springen, kriechen, tanzen oder auf Bäume klettern lassen. Diese Art von Trance oder Besessenheit kann bis heute nicht wissenschaftlich erklärt werden. Vodou-Gläubige sagen, ein Mensch, der in diesen Zustand verfalle, werde von einem lwa geritten. Der Mensch stelle nur den Körper für eine Manifestierung des Geists zur Verfügung und sei nicht verantwortlich für das, was er während seiner Besessenheit tue. Komme er wieder zu sich, könne er sich an nichts erinnern.
Vodou hat seine Wurzeln in Afrika. Die wichtigsten lwa geistern auch – zum Teil mit anderen Namen, aber mit vergleichbarer Erscheinung und Funktion – durch Westafrika und den Kongo. Man kennt auf Grund dieses Ursprungs zwei große lwa-Familien, die aus dem damaligen westafrikanischen Königreich Dahomey stammenden eher friedlichen und freundlichen rada und die aus dem damals sehr unruhigen Kongo-Becken mitgebrachten petro, die kriegerisch und manchmal jähzornig sind. Dazu kamen die erst in der Kolonie aufgetauchten sogenannten kreolischen lwa; einige sind wahrscheinlich auch vom Glauben der Arawak beeinflusst. 1522, beim ersten Sklavenaufstand auf der Insel, sind mehrere tausend Schwarze ins Bergland entlaufen und haben sich dort mit den letzten Ureinwohnern zusammengetan. Das Wissen um Heilkräuter, Drogen und natürliche Gifte, das von den hangun bis heute bewahrt wird, dürfte auf diese Ureinwohner zurückgehen. Manche lwa tragen auch Charakterzüge katholischer Heiliger, die genauso wie die Geister des Vodou eine Zwischenstellung zwischen den Menschen und ihrem fernen Gott einnehmen.
Die Gesetze der Kolonialzeit schrieben vor, dass Sklaven getauft werden mussten. So kamen die Schwarzen, ob sie es wollten oder nicht, mit dem Katholizismus in Berührung. Zum Teil benutzten sie dann die katholischen Heiligen als Tarnung für ihre lwa, zum Teil glaubten sie an beide Religionen gleichzeitig, ohne das als einen Widerspruch zu empfinden. Louverture etwa ging regelmäßig zur Messe und wurde doch in vielen Schlachten von einem lwa geritten. Heute bekennen sich knapp achtzig Prozent der Haitianer zum Katholizismus, und neunzig Prozent geben an, sie glaubten an die Welt des Vodou.
Eine ähnliche Geistermischung wie in Haiti findet sich auch in anderen ehemaligen Sklavenhalterkolonien. Die lwa heißen in der kubanischen Santería orisha, im brasilianischen Candomblé orixá. Alle drei Religionen sind eng miteinander verwandt, und doch ist die schwarze Religion Haitis eine ganz andere als die Kubas oder Brasiliens. Nirgendwo sonst ist bei afroamerikanischen Religionen die militärische Symbolik so auffällig wie im Vodou. In den Zeremonien treten lwa mit dem Dreispitz französischer Generäle auf, schwingen den Säbel und saufen und fluchen. Vodou, so wie die Religion im Glauben und in ihren Manifestationen bis heute ist, hat sich im Befreiungskrieg gegen die Franzosen konsolidiert – daher die militärische Seite. Die Santería dagegen hat in den Unabhängigkeitskriegen Kubas nie eine Rolle gespielt, obwohl viele Schwarze gegen die Spanier gekämpft haben. Santería und Candomblé sind bis heute rein spirituell. Vodou aber wurde im Kampf gegen die Kolonialherren zu einer aufrührerischen und politischen Religion.
Ihr Ursprung liegt im afrikanischen Dorf, und so sind Vodou-Gemeinschaften bis heute strukturiert. Ihr Mittelpunkt ist der hunfò, ein im Grunde normales Wohnhaus, in dem der hangun oder sein weibliches Pendent mambo oder beide wohnen. Sie sind die Gemeindevorsteher, müssen aber nicht als Paar zusammenleben. Oft werden sie Vater und Mutter genannt und sind nicht nur Priester und Geisterbeschwörer, sondern genauso Heiler und Seher, Veranstalter öffentlicher Vergnügungen, einflussreiche politische Berater und Wahlhelfer. Für ihre Gemeinschaft sind sie Beichteltern und Ratgeber in allen Lebenslagen. Eine Vodou-Gemeinde ist von der Struktur her ein kleinbäuerlicher Verband, der seine Ahnen verehrt und seine initiierten Mitglieder zu gegenseitiger Hilfe verpflichtet. Der hangun und die mambo müssen in Not geratene Mitglieder aufnehmen und über die Runden bringen. Ihr Amt ist vererbbar. Meist gehen die Kandidaten mehrere Monate oder gar Jahre bei einem anderen hangun oder einer mambo in die Lehre. Am Ende steht ein Initiationsritus, der streng geheim gehalten wird.
Rein äußerlich unterscheidet sich ein hunfò nur durch das peristyl von anderen Häusern. Das ist ein Vorplatz mit einem Dach aus Stroh oder Wellblech als Schutz gegen das Wetter bei Zeremonien und Tänzen. Es wird von bemalten Pfosten gestützt, in der Mitte steht der poteau-mitau, ein meist spiralförmiger Pfosten mit hellen Punkten auf einfarbigem Grund, der oft mit bunten Bändern geschmückt ist und bis hinauf zum Dach reicht. Er ist die zentrale Achse für rituelle Tänze und der Weg, den die lwa nehmen, wenn sie heruntersteigen, um einen Menschen zu reiten. Die Hausfassade zum peristyl hin ist mit Ornamenten, den Emblemen der wichtigsten lwa und oft auch mit dem Wappen der Republik Haiti geschmückt. Unter der Decke hängen tagsüber die Trommeln für die nächtlichen Feiern. Dahinter im Gebäude ist das caye-mystères, das Geisterhaus mit einem oder mehreren Altären, bisweilen auch mit einem kleinen Becken für die Wassergeister. Im Raum findet sich ein Sammelsurium ritueller Gegenstände, Krüge und Karaffen, die den lwa oder Toten gehören; Steine, Spielkarten, Klappern; Flaschen mit Wein und Rum für die Geister; Öllämpchen, ein in der Erde steckender Säbel. Dazu Kleider und Utensilien für die Besessenen, mit deren Hilfe sie den in ihnen wohnenden lwa darstellen können; Krücken etwa oder Zylinder. Rund um den hunfò sind Bäume als Altäre hergerichtet – nach dem Vodou-Glauben leben etliche lwa in solchen Bäumen. Ihre Äste sind mit Bändern und Tierschädeln geschmückt, es ist strengstens verboten, sie zu fällen. Rund um den hunfò warten Hühner und Hähne, Tauben und Ziegen auf ihre Opferung. Die Grenze zwischen einem Tempel und einem Kleinbauernhof ist dabei oft fließend.
Eine Vodou-Zeremonie folgt keiner festen Liturgie. Meist beginnt sie mit Chorälen, die katholischen Kirchenliedern nachempfunden sind, wird dann aber immer ursprünglicher und wilder. Trommeln sind die zentralen Instrumente, »die Trommel schlagen« ist ein Synonym für »eine Vodou-Zeremonie feiern«. Als erster lwa wird immer Legba angerufen, der Hüter des Tors zur Welt der Geister. Ohne ihn kann kein anderer lwa heruntersteigen und in einen Menschen fahren. Er hat zwar eine ähnliche Funktion wie Petrus im römisch-katholischen Glauben, wird aber eher dargestellt wie Lazarus: Ein tattriger Greis, der mühsam an Krücken geht und Lumpen und meist auch Verbände trägt. Oft hat er eine Pfeife im Mund und trägt wie ein Kleinbauer einen Hafersack über der Schulter. Außer dem Wächter der Schranke, die Menschen und Geister trennt, ist Legba auch Hüter der Tore, Straßen und Wege. Die danach angerufenen lwa können von hunfò zu hunfò wechseln. Es gibt Geister, die nur regional bekannt sind; manchmal steigen im Leben hoch verehrte hangun nach ihrem Tod auf in das Reich der lwa. Manche Geister werden auch wieder vergessen und verschwinden. Das Vodou-Pantheon ist weit und in steter Bewegung.
Die wichtigsten lwa aber werden überall angerufen. Es sind die alten Geister aus Afrika, die nach der Vorstellung der Gläubigen in Guinea leben. Das ist nicht geografisch gemeint, sondern eher als unbestimmter Ursprungsort mystischer Natur. Andere lwa wohnen in Bergen, Höhlen oder Quellen, auf dem Grund von Flüssen oder in der Tiefe des Meers. Oder eben in heiligen Bäumen. Jedem lwa sind einer oder zwei Tage der Woche geweiht, jeder hat seine Farbe und seine Lieblingsspeise. Die lwa lieben die Menschen, schützen und bewachen sie, sprechen ihnen Mut zu, nennen ihnen Heilmittel, bringen Glück und manchmal auch Reichtum. Jeder lwa hat seine Zuständigkeit. Agwé etwa schützt das Meer, nebst Algen, Fischen und Schiffen. Loco ist der lwa der Vegetation; ihm verdanken Blätter ihre heilende Kraft. Ogu ist der Krieger-lwa, ein großer Trinker, der sich für schöne Frauen ruiniert und immer mit dem Säbel auftritt. Ezili-frèda ist die lwa der Liebe. Die lwa-Familie der Guédé ist die der Toten. Ihr wichtigster Vertreter, Baron Samedi, wird oft wie ein Beerdigungsunternehmer dargestellt, mit schwarzem Anzug und Zylinder.