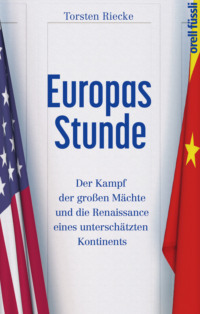Kitabı oku: «Europas Stunde», sayfa 3
Die GoT-Formel der Weltpolitik
Es ist ungewöhnlich mild an diesem Februartag 2020 in München. Die Sonne zeigt sich früh und treibt die Temperaturen in der bayerischen Landeshauptstadt schnell auf 16 Grad. Nur im großen Festsaal des Bayerischen Hofs herrscht an diesem Vormittag eisige Kälte, wird doch hier der Kampf der Großmächte um die Deutungshoheit in der internationalen Politik offen ausgetragen.
In München treffen sich jedes Jahr Außen- und Sicherheitsexperten aus aller Welt, um in mehr offenen als diplomatischen Worten über die Gefahren für den Weltfrieden zu diskutieren. Den Anfang hatte am Tag zuvor der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemacht. Der 64-jährige Sozialdemokrat ist ein regelmäßiger Besucher der »Munich Security Conference«. 2014 hatte er dort noch als deutscher Außenminister zusammen mit dem damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck nachdrücklich gefordert, Deutschland müsse mehr Verantwortung in der Welt übernehmen. Schon damals spürten die beiden, dass sich das Glück Deutschlands nach der friedlichen Wiedervereinigung 1989 dem Ende neigte. Wie recht er damit haben sollte, zeigte sich wenige Wochen später, als russische Soldaten ohne Hoheitsabzeichen auf ihren Uniformen die Krim besetzten. Es war das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass in Europa ein Land die territoriale Integrität einer anderen Nation und damit das Völkerrecht verletzte. Brutaler hätte sich die bislang als überwunden geglaubte Geschichte des letzten Jahrhunderts kaum zurückmelden können.
Sechs Jahre später scheint die Welt vollends aus den Fugen geraten, wie Steinmeier es einmal beschrieben hat. In München spricht der Bundespräsident von einer »destruktiven Dynamik der Weltpolitik« und macht dafür die »Konkurrenz der großen Mächte« – Russland, China und auch die alte Schutzmacht USA unter Trump – verantwortlich. Steinmeier erinnerte seine Landsleute daran, dass ihre klammheimliche Hoffnung, andere Länder würden das Ungemach der Welt für immer von Deutschland fernhalten, vermutlich schon immer eine Illusion gewesen sei. »Glück kann auch blind machen«, sagte der Bundespräsident.
Einen Tag später, an jenem frühlingshaften Samstag im Februar, wurde in München deutlich, was Steinmeier meinte. Der amerikanische Außenminister Mike Pompeo und US-Verteidigungsminister Mark Esper nutzen ihre Auftritte bei der Sicherheitskonferenz für einen verbalen Frontalangriff gegen China. »Wir befinden uns in einem Wettbewerb der Großmächte«, sagte Esper und machte China als Hauptgegner und das Ringen um die technologische Vorherrschaft als die wichtigste Front aus. Huawei und 5G seien dabei die »Vorzeigekinder« der »schändlichen Aktivitäten« Chinas, seine autoritäre Macht in Europa auszuweiten. Die USA und ihre Verbündeten müssten sich deshalb erneut auf eine »hoch intensive Kriegsführung vorbereiten«. Pompeo hatte Huawei und die anderen chinesischen Technologieunternehmen zuvor als »Trojanische Pferde des chinesischen Geheimdienstes« gebrandmarkt.
Die Antwort Pekings ließ nicht lange auf sich warten: Der chinesische Außenminister Wang Yi zahlte wenig später mit gleicher Münze zurück. Die USA führten eine »Schmierenkampagne« gegen China. Die Vorwürfe von Pompeo und Esper seien »Lügen«, die nur dazu dienten, Chinas Aufstieg verhindern zu wollen. Im Publikum in München saß derweil der russische Außenminister Sergei Lawrow und war vermutlich dankbar dafür, dass nicht mehr wie so oft Russland, sondern China in München am Pranger stand.
Das Ende der Geschichte, von dem Fukuyama in der Euphorie des Mauerfalls 1989 gesprochen hatte, stellt sich offenbar nur als eine Atempause heraus. Konflikt statt Kooperation, Macht statt Recht und Nationalismus statt Universalismus bestimmen heute das Weltgeschehen. Das schürt nicht nur politische Rivalität, sondern verändert vor allem auch die Spielregeln unserer Weltwirtschaft, die seit über 30 Jahren immer enger zusammengewachsen ist. Und zwar in dem Glauben, dass freier Handel und neue Technologien die alten Ungleichheiten zwischen Wirtschaftsräumen einebnen.
2005 veröffentlichte der amerikanische Journalist Thomas Friedman ein Buch, das den damaligen Zeitgeist in einem Satz zusammenfasste: »Die Welt ist flach.« Die gleichnamige Schrift wurde zu einem Weltbestseller und in fast vierzig Sprachen übersetzt. Friedmans Globalisierungsbibel war die logische Fortsetzung von Francis Fukuyamas epochalem Werk »The End of History«. So wie Fukuyma nach dem Mauerfall 1989 der politischen Welt im 21. Jahrhundert einen Siegeszug der liberalen Demokratie voraussagte, prophezeite Friedman daran anknüpfend der Weltwirtschaft den Durchmarsch der Globalisierung. Freihandel und technischer Fortschritt, so die damalige These des »wahrscheinlich einflussreichsten Journalisten der Welt« (SPIEGEL), sorgen für einen globalen Marktplatz, auf dem jeder die gleiche Chance hat. Wurden Einfluss und Wohlstand von Ländern und Menschen bis zur Jahrtausendwende noch weitgehend durch ihre Geschichte und Geografie bestimmt, würden diese Machtfaktoren im 21. Jahrhundert durch neue Technologien wie dem Internet und einem davon entfesselten Welthandel entmachtet. Geopolitische und geoökonomische Hierarchien würden eingeebnet.
Heute wissen wir: Fukuyama und Friedman haben sich beide geirrt. Nicht nur haben sich Geschichte und Geopolitik mit Macht zurückgemeldet. Die neuen Technologien, die Friedman noch als die entscheidenden »Flachmacher« der Weltwirtschaft ausgemacht hatte, sind zur wichtigsten Waffe von neuen und alten Mächten und Mächtigen geworden. Das gilt für China genauso wie für Facebook. Friedman lag mit seinen »Gleichmachern« zwar nicht völlig daneben. Die jüngste Ära von Freihandel und Globalisierung, die mit dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation WTO 2001 erst richtig begonnen hat und mit der Wahl Donald Trumps 2016 vorerst zum Stillstand gekommen ist, hat immerhin mehr als eine Milliarde Menschen aus der Armut geholt – die meisten davon im Reich der Mitte. Südkorea, in den 1960er-Jahren noch eines der ärmsten Länder überhaupt, ist heute eine der führenden Industrienationen mit Weltkonzernen wie Samsung, Hyundai und LG. Das vom Krieg gebeutelte und heute kommunistisch regierte Vietnam ist ein begehrter Standort für rund 300 deutsche Unternehmen geworden – darunter auch Industrieikonen wie Bosch. Möglich ist diese globale Arbeitsteilung auch deshalb, weil modernste Technologien wie 3D-Drucker, das Internet der Dinge und digitale Kommunikationsmittel Zeit und Raum mit einem Mausklick überwinden.
Was Fukuyma und Friedman jedoch nicht vorausgesehen haben, sind die Nebenwirkungen einer entfesselten Welt: Die Hyper-Globalisierung produziert nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer – und viele davon in den alten Industrieländern des Westens. David Autor, Wirtschaftsprofessor am renommierten »Massachusetts Institute of Technology« (MIT) im US-Bundesstaat Massachusetts, hat herausgefunden, dass durch den »China-Schock«, also den Eintritt Chinas in den Weltmarkt, zwischen 1999 und 2011 rund 2,4 Millionen Jobs allein in den USA verloren gegangen sind. Und nicht nur dort. Ob im Rostgürtel der USA oder in den alten Industrieregionen Nordenglands. Ob in den strukturschwachen neuen Bundesländern oder im Banlieue im Norden von Paris. Für die Menschen dort ist ihre Welt durch Globalisierung und technologischen Wandel nicht flacher, sondern vor allem hoffnungsloser geworden. Sie fühlen sich vom technischen und wirtschaftlichen Fortschritt abgehängt und von den Eliten vergessen. Sie haben das Gefühl, die Kontrolle über ihr Leben und ihre kulturelle Identität zu verlieren. Sie protestieren, gehen auf die Barrikaden und wählen Donald Trump, Boris Johnson, Marine Le Pen oder die Alternative für Deutschland. Diese Populisten versprechen ihnen Schutz durch Abschottung, Nationalismus und manchmal auch durch Rassismus. »Die wirtschaftliche Unzufriedenheit führt dazu, dass in vielen Wahlbezirken der Krisenregionen insbesondere rechtsextreme Kandidaten Zulauf erhalten«, sagt MIT-Ökonom Autor. Hier ist der fruchtbare Boden, auf dem die Saat des Demagogen Donald Trump wachsen und gedeihen konnte. Und hier findet Trump vier Jahre später immer noch seine meisten Anhänger – auch wenn sie von seiner Wirtschaftspolitik weit weniger profitiert haben als die Reichen, die sich über seine massiven Steuersenkungen freuen konnten.
Ohne die weltweite Vernetzung hätten jedoch kaum Schwellenländer wie Indien zu globalen Zentren für elektronische Güter und Dienstleitungen werden können. Durch die Digitalisierung würden nicht nur die Kosten des internationalen Handels spürbar gesenkt, bestätigt die Welthandelsorganisation WTO, der breite Einsatz digitaler Technologien führe auch zu einem Rückgang im Handel mit digitalisierbaren Gütern. Bits und Bytes statt Container heißt die neue Kurzformel für den globalen Austausch von Gütern und Dienstleistungen. Statt Vor- und Fertigprodukte rund um den Globus mühsam und kostspielig zu verschieben, werden Daten zum wichtigsten Handelsgut. »Die Globalisierung im 21. Jahrhundert wird zunehmend durch Daten- und Informationsflüsse bestimmt«, schrieb das »McKinsey Global Institute« (MGI), eine weltweit agierende Denkfabrik der gleichnamigen Unternehmensberatung, schon 2017. Jetzt hat das MGI mit einer neuen Studie (Globalization in Transition: The Future of Trade and Value Chains) nachgelegt und untersucht, wie die Digitalisierung des Welthandels auch die globalen Lieferketten multinationaler Konzerne verändert. Das Ergebnis deckt sich mit den Beobachtungen der WTO: »Globale Lieferketten werden durch grenzüberschreitende Datenströme und neue Technologien wie digitale Plattformen, das Internet der Dinge und Künstliche Intelligenz neu geknüpft«, heißt es in der MGI-Studie. Eine Folge sei, dass die Intensität im Güterhandel zurückgehe, während der Handel mit Services um 60 Prozent schneller wachse als der Warenverkehr.
Deshalb geht es im aktuellen Handelsstreit zwischen China und den USA auch nur scheinbar um Importzölle auf Textilien, Waschmaschinen und Sojabohnen. Tatsächlich steht der Technologiewettbewerb im Zentrum des Handelskrieges. Nicht zufällig hat US-Präsident Donald Trump gerade die Technologieführerschaft von den US-Firmen gefordert. Die Politik vollzieht damit nach, was in der Wirtschaft längst Realität ist. Allein zwischen 2013 und 2015 hat sich, nach Angaben des MGI, der grenzüberschreitende Datenverkehr rund um den Globus auf 290 Terabits pro Sekunde fast verdoppelt. Ein Trend, der sich in den vergangenen drei Jahren noch verstärkt hat und das Gesicht der Globalisierung dramatisch verändert. »Wurden früher mehr oder weniger fertig erstellte Investitionsgüter – also Industrieanlagen, Maschinen, Werkzeuge oder Fahrzeuge – von Deutschland in alle Weltregionen verschifft, genügt es heute, über das Internet Konstruktionsskizzen oder Baupläne zu versenden. Das Endprodukt wird dann vor Ort beim Kunden passgenau hergestellt. Der Datentransfer macht den Güterhandel überflüssig«, prophezeit der Hamburger Wirtschaftsprofessor Thomas Straubhaar. Das Ergebnis: alte Industriestandorte verlieren, neue Billigstandorte gewinnen.
Das ist jedoch nur die halbe Wahrheit, nur das eine Gesicht des technologischen Wandels. Die andere, dunkle Seite sorgt dafür, dass neue Mächte und Machtungleichgewichte entstehen. Internetgiganten wie Amazon, Google und Facebook sind im digitalen Zeitalter das, was zu den Zeiten der ersten industriellen Revolution in Amerika die Stahlbarone und Eisenbahnkönige waren. Google macht heute einen Jahresumsatz von mehr als 160 Milliarden Dollar. Das ist etwa so viel wie Deutschlands Industrieperle Daimler. Nur ist Googles Mutterkonzern Alphabet an der Börse drei Mal so viel wert wie der deutsche Luxusautobauer. Je größer die Riesen aus dem Silicon Valley werden, desto mächtiger werden sie auch. Dafür sorgt vor allem der sogenannte Netzwerkeffekt: Je mehr Nutzer Facebook hat, desto attraktiver wird die Plattform für alle, die noch nicht dabei sind. Zum anderen basiert die Macht der Internetgiganten aber auf den Daten, die ihre Nutzer ihnen meist ebenso kosten- wie bedenkenlos überlassen. Für die »Likes« in unseren sozialen Medien zahlen wir mit unserer Privatsphäre. Die amerikanische Ökonomin Shoshana Zuboff von der »Harvard Business School« nennt das treffend »Überwachungskapitalismus«.
Das politische Pendant dazu ist die digitale Diktatur, wie sie vor allem China praktiziert. »Technologie hilft nicht unbedingt jenen, die ihre Meinung sagen und gegen repressive Regime aufbegehren«, schreiben die amerikanischen Wissenschaftler Andrea Kendall-Taylor, Erica Frantz und Joseph Wright in der Zeitschrift »Foreign Affairs«. Die Technologieoptimisten würden allzu oft vergessen, dass das Internet und andere neue Technologien Autokraten neue Instrumente für die Unterdrückung in die Hand gebe. Tatsächlich bieten vor allem die technologischen Fortschritte in der intelligenten Gesichts- und Bewegungserkennung enorme Möglichkeiten für Überwachung und soziale Kontrolle. Bis 2020 will China seine rund 1,4 Milliarden Menschen mit mehr als 600 Millionen Überwachungskameras kontrollieren. Überwachung der eigenen Bevölkerung ist das eine, Manipulation der öffentlichen Meinung das andere. »Von künstlicher Intelligenz angetriebene Algorithmen erlauben es autokratischen Regimen im Wege eines sogenannten ›Microtargeting‹ gezielt einzelne Personen mit Informationen zu versorgen«, die das herrschende Regime gegenüber Kritik von Oppositionellen stützen, schreiben Kendall-Taylor und ihre Kollegen. Zum Einsatz kommen dabei auch immer häufiger sogenannte »deep fakes«, also täuschend echte Fälschungen von Foto-, Video- oder Audioaufnahmen. Eingesetzt wird das »Microtargeting« aber auch im amerikanischen Wahlkampf. Die US-Wissenschaftler haben zudem herausgefunden, dass digitale Repression nicht etwa die gewaltsame Unterdrückung ersetzt, sondern sogar fördert. Außerdem zeigt die Studie, dass Diktaturen ihre Lebensdauer durch den Einsatz neuer Technologien verlängern können.
Der technische Fortschritt war schon immer janusköpfig. »Sie sind nützliche Werkzeuge und zugleich Waffen«, räumte Brad Smith, Präsident von Microsoft, auf der »Munich Security Conference« mit Blick auf die neuen Technologien ein. Smith hat gerade ein Buch (»Tools and Weapons«) über die zwei Gesichter des digitalen Fortschritts geschrieben. Die neuen Technologien böten autokratischen Regierungen einen asymmetrischen Vorteil gegenüber Demokratien, konzediert auch der Amerikaner und verweist auf die zahlreichen Möglichkeiten des Cyberkriegs gegen ausländische Staaten und auf die Überwachung von Oppositionellen zu Hause. Smith steht mit seiner Warnung zwar nicht mehr allein, aber der Microsoft-Vordenker gehört doch immer noch zu einer Minderheit unter den Fortschrittsgläubigen aus dem Silicon Valley. »Die aktuellen Netzwerk-Technologien (...) begünstigen wahrlich die Bürger«, schrieben die Google-Manager Eric Schmidt und Jared Cohen noch voller Optimismus in ihrem Buch »New Digital Age« im Jahr 2013. Vier Jahre später kam der Historiker Niall Ferguson zu dem gegenteiligen Schluss und bezeichnete soziale Netzwerke als »inhärent unfair und ausschließend«. »Netzwerke lassen keine Weltgemeinschaft entstehen, wie Optimisten glauben. Netzwerke polarisieren, sie bringen Gruppen hervor, die sich voneinander abschotten«, erklärt er, als ich ihn zusammen mit meinem »Handelsblatt«-Kollegen Moritz Koch im Juni 2018 in Berlin treffe. »Vor Jahren wurde uns erzählt, das Internet sei gut für die Demokratie und schlecht für Diktatoren. Im Moment sieht es genau umgekehrt aus.«
Diese dunkle Seite der Macht neuer Technologien sorgt zugleich dafür, dass die digitale Welt eben nicht flacher, sondern oft hierarchischer wird. Anders als es die Technologie-Propheten bei der Jahrtausendwende versprochen hatten, spielt das Internet mit all seinen digitalen Werkzeugen oft eher Despoten in die Hände statt sie zu stürzen. Auch deshalb konnte aus dem Arabischen Frühling 2010, der nicht zuletzt auch eine »Facebook-Revolution« war, so schnell ein Arabischer Winter werden. Zunächst spielten soziale Medien wie Facebook und Twitter eine wichtige Rolle für die Demokratiebewegungen im Mittleren Osten, weil sie der Opposition eine Plattform zum Austausch von Informationen und Meinungen gab. Später haben die Autokraten dann den technologischen Spieß einfach umgedreht und zu einer Waffe der Unterdrückung gemacht. Anfangs reagierten sie noch defensiv und legten einfach das Internet in ihren Ländern lahm. Als sich 2011 die Proteste gegen den damaligen ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak im Land ausbreiteten, befahl die Regierung allen Internetanbietern, den Stecker zu ziehen. Ähnliche »shutdowns« der Digitalwelt gab es seitdem in rebellischen Regionen von Myanmar, Indien, Pakistan und dem Iran. China hat mit der »Great Firewall« die bislang größte Schutzmauer um seine Parteidiktatur errichtet. Soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter sind dort verboten, der Informations- und Meinungsaustausch auf den chinesischen Plattformen wird streng zensiert. Zudem hat die Regierung in Peking mithilfe von Big Data, Künstlicher Intelligenz und Gesichtserkennung eine nahezu lückenlose soziale Verhaltenskontrolle aufgebaut. Wer sich an die Parteilinie anpasst, wird belohnt, wer dagegen opponiert, wird bestraft.
Diese Dystopie machte sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg bei einer Anhörung im US-Kongress 2019 zunutze, als er den Abgeordneten anbot, sie könnten entweder ihm oder China vertrauen. Das ist eine Wahl zwischen Pest und Cholera – nämlich zwischen dem Überwachungskapitalismus der großen Technologiekonzerne aus dem Silicon Valley oder dem Überwachungsstaat »Made in China«. In beiden Fällen ist es die dunkle Seite der neuen Technologien, die den Traum von einer flachen Welt mit abnehmenden Machtunterschieden zunichte macht. Weder die wirtschaftliche Vernetzung der Welt durch den Abbau von Handelsbarrieren und den Aufbau globaler Lieferketten noch ihre technologische Vernetzung durch Datenautobahnen hat die früheren Gesetzmäßigkeiten der Machtpolitik dauerhaft außer Kraft gesetzt. »Es ist eine neue Welt entstanden, in der Wirtschaft und Geopolitik viel schwerer zu trennen sind«, schreibt der ehemalige Macron-Berater Jean Pisani-Ferry, »es ist nicht mehr die flache Welt von Friedman, sondern eine Welt nach den Gesetzen der Game of Thrones.«
Das Ende des amerikanischen Zeitalters und die überkochende Wut der Verlierer
Als ich im Herbst 2016 durch einige der damals im Präsidentschaftswahlkampf besonders heiß umkämpften »swing states« der USA reiste, konnte man das kommende politische Erdbeben namens Trump bereits spüren. »Ich brauche Ihre Hilfe. Meine Stadt steht kurz vor dem finanziellen Ruin«, hatte Lou Mavrakis im Frühjahr des gleichen Jahres an Barack Obama geschrieben. Der war noch für ein paar Wochen im Amt, bevor die Amerikaner dann am 9. November Donald Trump zu ihrem 45. Präsidenten wählten. Der fast 80-jährige Mavrakis war Bürgermeister von Monessen, einer Kleinstadt knapp eine Autostunde von Pittsburgh entfernt. Als Obama nicht antwortete, wandte sich der Sohn griechischer Einwanderer an Donald Trump und lud den späteren Präsidenten nach Monessen ein. Der kam und verdammte die billigen Stahlimporte aus China. »America first« lautete Trumps Botschaft. Er gewann den Wahlkreis Westmoreland, in dem auch Monessen liegt, mit einem Vorsprung von 57000 Stimmen. Damit konnte Trump am Ende auch den hart umkämpften US-Bundestaat Pennsylvania für sich entscheiden. Ein Staat, der seit 1992 immer eine demokratische Mehrheit hatte und der im November 2020 erneut über die Wiederwahl Trumps mitentscheiden wird. Im Weißen Haus angekommen, verhängte der neugewählte US-Präsident Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus China und Europa. Seitdem macht er Amerikas Wirtschaft zur Waffe.
Vier Jahre später steht Monessen immer noch für viele vergessenen Orte im »Rostgürtel« Amerikas. Die Arbeitslosigkeit war vor Ausbruch der Pandemie mit einer Quote von 4,4 Prozent zwar niedrig, aber eben höher als im US-Durchschnitt von 3,9 Prozent. In den vergangenen vier Jahren wurden kaum neue Jobs geschaffen. Und das mittlere Haushaltseinkommen beträgt mit 32970 Dollar im Jahr nur etwa 60 Prozent des Mittelwertes für die ganzen USA. Bis in die 1970er-Jahre hinein war die Stadt, die ihren Namen der deutschen Ruhrpott-Metropole Essen verdankt, eine boomende Gemeinde mit bis zu 25000 Einwohnern. 8000 davon fanden in den nahe gelegenen Stahlwerken Lohn und Brot. Dort wurden nicht nur Bleche für Chrysler-Autos in Detroit produziert, sondern auch die langen Stahlkabel, an denen die Golden-Gate-Brücke in San Francisco hängt. Mit dem Niedergang der Stahlindustrie begann jedoch auch der Verfall von Monessen. »Nur noch rund 7500 Einwohner sind übriggeblieben«, erzählte mir Mavrakis bei meinem Besuch in Monessen. »Die Jugend hat hier keine Chance.« Mehr als 400 Häuser sind verlassen und verfallen. Dreißig davon allein in der Innenstadt. Ratten und Schlangen nisten sich in den Ruinen ein. Die Straßen sind seit sechzig Jahren nicht erneuert worden. Das Abwassersystem müsste dringend modernisiert werden. Aber dafür fehlt das Geld.
Nicht nur in Monessen sind die Menschen wütend. Im »Rostgürtel« Amerikas gärt es seit Jahren – in den Industrieruinen im Norden New Yorks und rund um die stillgelegten Stahlöfen in Pennsylvania. Unter den Arbeitern in den Kohlegruben West Virginias bis hinauf zu den arbeitslosen Autobauern in Michigan. Das industrielle Herz Amerikas steht kurz vor dem Infarkt: »Es gibt dort Familien, die sind so arm, dass sie nicht wissen, wie sie den nächsten Tag überstehen sollen«, sagt der ehemalige US-Präsident Bill Clinton über die Menschen im »Rust Belt«. Und doch wollen viele von ihnen Trump wiederwählen. Seine Zustimmungsrate in den Industrieregionen des Mittleren Westens ist unverändert hoch.
»Make America Great Again.« Mit seinem Wahlkampfslogan aus 2016 spricht Trump auch heute noch vielen Amerikanern aus der Seele. Glaubt man dem Populisten im Weißen Haus, standen die USA bis zum Ausbruch der Pandemie »großartig« da: Die Wirtschaft wuchs solide zwischen zwei und drei Prozent pro Jahr. Die Arbeitslosenquote war im Spätsommer 2019 auf 3,5 Prozent gesunken – dem niedrigsten Stand seit fünfzig Jahren. Der Börsenindex Dow Jones kratzte noch Anfang 2020 an der historischen Rekordmarke von 30000 Punkten. Amerika ist mit Abstand die stärkste Militärmacht der Welt und gibt nach Berechnungen des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI mehr Geld für seine Sicherheit aus als die sieben ihm nachfolgenden Länder zusammen. China bringt es gerade mal auf 35 Prozent der US-Rüstungsausgaben. »Der Arbeitsmarkt boomt, die Einkommen steigen, die Armut fällt, die Kriminalität sinkt, Zuversicht wächst, unser Land gedeiht und wird wieder respektiert.« So feierte sich Trump bei seiner Rede zur Lage der Nation Anfang Februar 2020. Und mit dem Slogan »Keep America Great« will er seine Wiederwahl sichern. Das wirtschaftspolitische Rezept seiner ersten Amtsperiode war denkbar einfach: niedrige Zinsen, niedrige Steuern, weniger Regulierung sollten für Wachstum und Wohlstand für alle sorgen. Mit dieser Idee der »Trickle-Down-Economics« hatte schon Ronald Reagan in den 1980ern versucht, seinen Landsleuten neue Zuversicht einzuimpfen.
Aber ist Amerika wirklich so »great«, wie Trump es seinen Anhängern und dem Rest der Welt weismachen will? Die wirtschaftlichen Daten sprachen bis zur Coronakrise auf den ersten Blick für den US-Präsidenten – wenn der wirtschaftliche Aufschwung auch bereits unter seinem Vorgänger Obama begonnen hatte. Das Groteske daran ist, dass jene Zustände, die Trump 2016 zu seinem überraschenden Wahlsieg verholfen haben, immer noch den Alltag vieler Amerikaner kennzeichnen, die nach wie vor jeden Tag darum kämpfen, über die Runden zu kommen. Für rund zwanzig Millionen Amerikaner ist ihr Leben eine Abfolge von gefühlt schlechten Tagen, hat der US-Ökonom David Blanchflower vom renommierten »Dartmouth College« herausgefunden. Steigende Selbstmordraten und hoher Drogenkonsum sind die schrecklichen Folgen dieser kollektiven Depression. »Wir haben gemerkt, dass nicht alle zu Gewinnern der Globalisierung werden«, erzählte mir Angus Deaton bereits kurz nach Trumps Wahlsieg bei einem Treffen in Davos. Drei Jahre später veröffentlichte der Wirtschaftsnobelpreisträger zusammen mit seiner Frau Anne Case ein Buch mit dem Titel »Death of Despair«, in dem das Forscherehepaar der Frage auf den Grund geht, warum die Lebenserwartung insbesondere weißer Männer aus der amerikanischen Arbeiterklasse zurückgeht. Ihr Urteil: Die wirtschaftliche Macht in den USA hat sich weiter zugunsten der großen Konzerne verschoben. Die steigenden Kosten für die Ausbildung ihrer Kinder und die Gesundheitsvorsorge wachsen vielen amerikanischen Arbeiterfamilien über den Kopf. Der Kapitalismus ist für sie zu einem amerikanischen Albtraum geworden. »Amerika schwankt. Viele US-Bürger haben die Hoffnung aufgegeben und führen ein unglückliches Leben. Der berühmte amerikanische Traum, der allen die Suche nach dem eigenen Glück ermöglicht, ist zu Ende«, schreibt Blanchflower. Seine Lagebeschreibung Amerikas fällt somit ganz anders aus als die »State of the Union«-Rede des Präsidenten, in der Trump das wirtschaftliche »Comeback« Amerikas unter seiner Führung feierte. Eine 2019 veröffentlichte Studie des »McKinsey Global Institute« (MGI) zeichnet ebenfalls ein komplett anderes Bild von Trumps Amerika. Demnach sind die Einkommenszuwächse von amerikanischen Durchschnittsfamilien seit 2002 zu 54 bis 107 Prozent durch steigende Wohnungs-, Bildungs- und Gesundheitskosten aufgezehrt worden. Zwar trifft das auch für Frankreich, Großbritannien und Australien zu, dort sind die sozialen Netze jedoch meist dichter geknüpft als in den USA. Da die Einkommen der Besserverdienenden zur gleichen Zeit stärker gestiegen sind als die der mittleren und unteren Schichten, hat die Ungleichheit der Einkommensverteilung in den USA nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes während der Trump-Präsidentschaft den höchsten Stand seit fünfzig Jahren erreicht.
Amerika ist aber nicht nur wirtschaftlich gespalten. Auch politisch und kulturell ist das Land zerrissen. Ein Riss, der sich quer durch Gemeinden, Freundeskreise und Familien zieht. Lange war es in Amerika verpönt, bei privaten Anlässen offen über Politik zu streiten. Inzwischen gibt es sogar für Thanksgiving, dem wichtigsten Familienfest in den USA, Handlungsanleitungen, wie sich der Streit zwischen loyalen Anhängern und erbitterten Gegnern Trumps vermeiden lässt. Begonnen hatte die Polarisierung bereits mit der Wahl Barack Obamas zum ersten afroamerikanischen US-Präsidenten 2008. Trumps überraschender Wahlsieg 2016 hat diesen Trend dann nochmals verstärkt. Anfang 2020 waren nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup nur sieben Prozent der Demokraten in den USA mit dem Präsidenten zufrieden, aber 89 Prozent der Republikaner. Die Differenz von 82 Punkten zwischen den beiden Parteien ist die größte, die Gallup je für einen Präsidenten gemessen hat. »Wut ist zur wichtigsten Triebkraft geworden, um Wähler zu motivieren«, beschreibt der »New York Times«-Journalist Thomas Edsall die explosive Stimmung in Amerika. Das »Pew Research Center« stellte im Herbst 2019 fest, dass sich die Spaltung und die Animositäten zwischen den beiden Lagern seit 2016 noch verstärkt hätten. Ein Viertel der Anhänger beider Parteien gaben an, dass sie sich mit dem politischen Gegner nicht einmal mehr auf die »grundlegenden Fakten« einigen könnten. Viel dazu beigetragen haben soziale Medien wie Facebook, aus denen immer mehr Amerikaner ihre täglichen Nachrichten beziehen und die wie Echokammern ihres eigenen Weltbildes wirken.
Im US-Kongress sind parteiübergreifende Initiativen selten geworden. Sowohl Obama als auch Trump mussten für mehrere Wochen die Bundesbehörden schließen, weil sich beide Parteien nicht über einen Haushalt einigen konnten. Die Republikaner verweigerten Obama die Anhörung seines Kandidaten für das Verfassungsgericht, setzten dann aber unter Trump gleich zwei konservative Richter nahezu ohne Unterstützung durch die Opposition durch. Mit ihrer Mehrheit im Senat sprachen sie Trump vom Vorwurf des Amtsmissbrauchs frei, nachdem das von den Demokraten beherrschte Repräsentantenhaus den Präsidenten deshalb zuvor seines Amtes entheben wollte.
Amerika ist heute eine verletzte, vielfach herausgeforderte Supermacht, die mit sich selbst und ihrer Rolle in der Welt nicht mehr im Reinen ist. »Das amerikanische Jahrhundert endete in Bagdad und Helmand (Afghanistan)«, schreibt der US-Autor George Packer in seinem Buch »The End of the American Century«, »es endete in Aleppo, Odessa und in Peking.« Und es endete mit der Finanzkrise 2008, möchte man ergänzen, die den weltweiten Glauben an die Überlegenheit des ungezügelten Kapitalismus Amerikas für immer erschüttert hat. Die Pax Americana endete, so schreibt Packer weiter, wegen »Überforderung, Erschöpfung, zunehmender Konkurrenz, einem rasanten Wandel und den gebrochenen Versprechen der Globalisierung. Und sie endete, weil unsere Demokratie der Mittelklasse an sich selbst gescheitert ist.« Habe jemals eine Nation so viel Macht mit so wenig Verantwortung ausgeübt, fragt der Amerikaner weiter und konstatiert, Amerika habe den Glauben an sich selbst verloren. Für ein Land, das Ronald Reagan 1989 in seiner Abschiedsrede aus dem Oval Office in Anlehnung an die Bibel noch als »leuchtende Stadt auf einem Hügel« und damit als Licht für die Welt beschworen hatte, das sich selbst über weite Strecken seiner Geschichte als die »unverzichtbare«, von Gott auserwählte Nation gesehen hat, ist das ein unerhörter Vorgang.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.