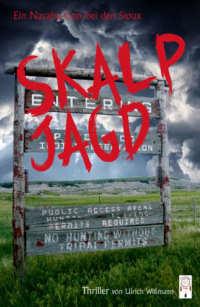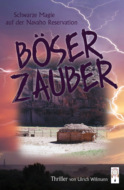Kitabı oku: «Skalpjagd»
Ulrich Wißmann
Skalpjagd
Ein Navaho-Cop bei den Sioux
Für Merlin
Ethno-Thriller
Skalpjagd
Ein Navaho-Cop bei den Sioux
Ethno-Thriller
von
Ulrich Wißmann

Impressum
Skalpjagd, Ulrich Wißmann
TraumFänger Verlag Hohenthann, 2015
eBook-ISBN 978-3-941485-37-2
Lektorat: Kerstin Schmäling
Satz und Layout: Janis Sonnberger, merkMal Verlag
Datenkonvertierung: readbox„ Dortmund
Titelbild: Astrid Gavini
Copyright by TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG,
Hohenthann
Produced in Germany
Inhalt
PROLOG
SÜDEN / ERSTES RITUAL
NORDEN / ZWEITES RITUAL
OSTEN / DRITTES RITUAL
WESTEN / VIERTES RITUAL
EPILOG
Vorwort
Der wahre Hintergrund dieser Geschichte ist, dass tatsächlich in den letzten Jahren Büffel, die aus dem Yellowstone Nationalpark abwandern, zum Abschuss durch Jäger freigegeben werden. Dies schürt den Protest von Naturschützern und indianischer Bevölkerung, die sich besonders mit den Tieren verbunden fühlt. In dem Buch führt die ausdauernde Ermittlung des Navaho Polizisten, bei der die indianische Kunst des Spurenlesens einhergeht mit moderner Kriminalistik, immer näher an den Täter, der sich zu wehren weiß! Die handelnden Personen des Romans sind frei erfunden, die beschriebenen geschichtlichen, politischen und ethnologischen Fakten sowie die historischen Personen entsprechen der Wahrheit.
PROLOG
Es war der Morgen.
Die ersten Sonnenstrahlen fielen durch die Kiefernzweige und erleuchteten den Nebel, der vom Waldboden aufstieg. Das Gras war so von Tautropfen bedeckt, das es im kalten Licht fast wie Schnee wirkte. Durch die tief hängenden Wolkenschleier sah man den klaren, bleiernen Himmel des erwachenden Tages. Kein Laut lastete auf der Stille der Welt. Der Mann schob sich vorsichtig durch einige junge Kiefern, um möglichst kein Geräusch zu verursachen. Der Wald lichtete sich immer mehr zu einer parkartigen Landschaft, in der nur wenige einzeln stehende Bäume die mit Gras und Beifuß bewachsenen Hügel beherrschten.
Will Jennings spürte die Vorfreude in sich aufsteigen. Er war mitten in der Nacht losgefahren, zunächst auf der Interstate 25 nach Norden, die dann zur 90 wurde und sich bei Billings nach Westen wandte. 40 Meilen weiter, bei Columbus, Montana war er auf die Landstraße 419 abgebogen, die in südlicher Richtung circa 50 Meilen auf die Berge der Absaroka Range zuführte, bevor sie in deren nördlichen Ausläufern einfach aufhörte. Von dort war er mit seinem Pickup Truck noch ein ordentliches Stück über unbefestigte Ranch roads weitergekommen, bevor er das Auto stehen lassen musste. Zu Fuß, nur mit dem Gewehr und seinem Proviantrucksack war er kurz vor Sonnenaufgang losgegangen. Bald war er auf die unübersehbaren Spuren gestoßen, die er gesucht hatte. Frische Spuren von Büffeln! Die einzigen frei lebenden Büffel in den USA. So frei, dass sie nicht einmal in dem Schutzgebiet im Yellowstone Nationalpark blieben, sondern immer wieder nach Norden abwanderten.
Es war Anfang Mai und auf den Hochebenen des Parks lag noch Schnee. Deshalb erschienen immer wieder kleine Gruppen von Bisons in den tiefer gelegenen Gebieten. Jennings hatte auf den Rat von ebenfalls jagdbegeisterten Freunden bei der Jagdaufsicht des US Forest Service die Abschussgenehmigung für einen Bison erhalten. Jetzt konnte er die Büffel fast schon riechen!
Er folgte der Spur und als sich hinter einem Hügel der Blick auf eine Senke öffnete, entdeckte er den einsamen Büffelbullen. Im Schutz einiger Felsen schlich Jennings unter einen abgestorbenen Baum, wo er das Gewehr auf einen Aststumpf auflegen konnte, um einen sicheren Schuss zu haben. Der Bulle hatte ihn nicht bemerkt. Er war gegen den Wind gegangen und befand sich jetzt im Schutz des Baumes. Jennings schloss einen Moment die Augen, um seine Aufregung in den Griff zu bekommen und zwang sich, ruhig zu atmen. Keine zweihundert Fuß Schussdistanz. Er stellte das Fernrohr scharf und zielte auf die Herzgegend des riesigen Tieres. Es würde schwer sein, mit dem Truck hierher zu kommen, um das Fleisch des Bullen zu holen, aber es ging ihm sowieso mehr um das Erlebnis und um eine einmalige Trophäe.
Jennings krümmte langsam den Finger. Jetzt bloß kein Fehler! Gleich würde er das gewaltige Tier töten.
Schon seine Vorfahren hatten Büffel gejagt, damals im Auftrag der Regierung, um den Plains-Indianern die Lebensgrundlage zu entziehen und sie so endlich besiegen zu können. Er wusste nicht viel über seine Vorfahren, aber er wusste, dass ein Urahn von ihm mit Tausenden anderen in die Black Hills gezogen war, nachdem General Custer von unermesslichen Goldvorkommen dort berichtet hatte. Er hatte gegen Indianer gekämpft und Bisons gejagt. Reich war er mit all dem nicht geworden, aber schließlich hatte er ein Stück Land kaufen können und eine Ranch aufgebaut.
Keine große Ranch mit angestellten Cowboys, aber genug, um sich und seine Familie zu ernähren. Jennings wohnte noch heute auf dem Land, das sein Urgroßvater vor mehr als einhundert Jahren besiedelt hatte. Sie hatten dieses Land aufgebaut, es der Wildnis abgetrotzt und einer vernünftigen Nutzung zugeführt. Deshalb hasste er diese dämlichen Tierschützer und Grünen, die Bären und Wölfe frei herumlaufen lassen wollten, damit sie ihm und anderen Ranchern das Vieh wegfraßen. Diese Typen kamen alle aus der Stadt und hatten überhaupt keine Ahnung von dem Leben hier draußen! Er jedenfalls hatte das Recht, die Früchte dieses Landes zu ernten und diesmal hatte er dafür sogar eine schriftliche Genehmigung!
Der Büffel hob den Kopf und sah in seine Richtung, als ob er doch irgendetwas bemerkt hatte. Jennings drückte ab.
Im selben Moment wurde er hart nach hinten gerissen. Der Schuss ging nach oben. Jennings fühlte sich von einem starken Arm umklammert. Er wollte schreien, aber eine Hand hielt seinen Mund geschlossen. Plötzlich fühlte er einen furchtbaren Schmerz. Etwas Heißes schoss über seine Brust. Er hörte ein röchelndes Geräusch und erkannte mit grenzenlosem Entsetzen, woher es kam. Der Angreifer hielt ihn gnadenlos gefangen und durchschnitt ihm die Kehle. Einen Moment lang bekam er noch Luft durch seine geöffnete Luftröhre, dann sog sein Atemreflex das aus den zerschnittenen Halsschlagadern strömende Blut ein und er begann zu ersticken. Gleichzeitig erstarb sein Gehirn, das nicht mehr mit frischem Blut versorgt wurde und er fühlte, wie er ohnmächtig wurde.
Eine tödliche Müdigkeit ergriff auf einmal von ihm Besitz. Ein letztes Mal versuchte er sich loszureißen, aber der Mann hielt ihn unerbittlich fest wie ein zappelndes Kaninchen. Das einzige, das Jennings von dem Mann sehen konnte, der ihm das antat, war sein muskulöser Unterarm, der ihn wie in einer Schraubzwinge umklammert hielt. Er glitt zu Boden und spürte, wie der Mann ein Knie auf seinen Rücken setzte. Durch den Nebel seiner schwindenden Wahrnehmung registrierte er, wie sein Kopf an den Haaren nach hinten gezogen wurde und als nächstes fühlte er einen scharfen Schmerz auf dem Kopf.
Will Jennings letzter Gedanke war die grauenvolle Einsicht, dass er skalpiert wurde.
SÜDEN / ERSTES RITUAL
I
Officer Frank Begay von der Navaho Nation Tribal Police nahm eine Hand voll Maispollen aus seinem Beutel und sprach sein Morgengebet. Langsam ließ er die Pollen aus seiner Hand in den sanften Wind gleiten, als Opfer an Dawn Boy, der den neuen Tag brachte. Er reckte sich in der warmen Morgensonne. Er hatte die Nacht in seinem Pick up Truck verbringen müssen und es war schon die zweite Nacht gewesen.
Zwei Tage zuvor hatte er im Schutz der Abenddämmerung seinen Beobachtungsposten an der Abbruchkante eines Tafelberges bezogen, von der er Einblick in einen der namenlosen kleineren Seitencanyons des Kaibito Plateaus hatte. Dort unten lag der Hogan der verdächtigen Person, die er observieren musste.
William Nez stand bei den Bewohnern dieser Gegend schon lange in Verdacht, ein Hexer zu sein.
Das war an sich kein Verbrechen, weder nach den Gesetzen der Navaho Nation, noch nach dem Recht der Weißen. Doch seit mehr als einem Jahr wurden in der nicht allzu weiten Umgebung immer wieder Grabstellen geplündert, und Grabschändung stellte sehr wohl eine kriminelle Handlung dar. Bei einer Befragung der hiesigen Landbevölkerung war Begay immer wieder von William Nez erzählt worden, so dass er es für klug hielt, ihn sich einmal näher anzusehen. Aber Nez war bisher nicht aufgetaucht.
Unten im Canyon liefen Schafe und Ziegen herum, bewacht von zwei großen Hunden. Es gab nur einen Ausgang aus dem Canyon, den Nez mit einem Zaun geschlossen hatte. Außerdem gab es eine Wasserstelle und genug zu fressen, so dass er die Tiere eine Weile allein lassen konnte.
Der traditionelle achteckige Hogan und ein Wellblechschuppen lagen verlassen da. Wer hier draußen allein wohnte und nicht völlig autark war, brauchte ein Auto zum Überleben.
Von der Zulassungsstelle wusste Begay, dass Nez einen alten Truck besaß. Wenn Nez zurück kam, würde er ihn auf dem Fahrweg durch die Schlucht kommen sehen. Und sollte Nez wirklich der gesuchte Übeltäter sein, würde er einen Truck brauchen.
Während die Navaho traditionell Angst vor Toten hatten und dem Kontakt mit ihnen möglichst aus dem Weg gingen, aus Angst, von dem Chindi, dem Totengeist der Person, verfolgt zu werden, versuchten Hexer, sich Leichenteile zu verschaffen. Mit dem daraus gewonnenen Leichenstaub, den sie in der Haut von Verstorbenen aufbewahrten, versuchten sie, Macht über ihre Mitmenschen auszuüben. Mischte eine Hexe oder ein Hexer Leichenstaub ins Essen oder blies ihn seinem Opfer ins Gesicht, kam das oft einem Todesurteil gleich.
Die Religion der Dineh, wie sich die Navaho selbst nannten, basierte auf der Harmonie in der Schöpfung, auf dem Gleichgewicht zwischen allen Lebewesen und Dingen. Dieses Gleichgewicht wurde durch das Berühren oder sogar In-sich-aufnehmen des Todes zerstört und man konnte nur durch die Reinigungszeremonie eines Heilers, wie zum Beispiel den Ghost way, wieder gesund werden. Aber ganz abgesehen von diesem spirituellen Aspekt konnte man sicher auch rein medizinisch gesehen dadurch erkranken. Und bei einem Volk, das panische Angst vor der Berührung mit Toten hatte, löste das unbeabsichtigte Einatmen oder Verschlucken von Überresten eines Toten einen lebensgefährlichen Schock aus.
Während bisher aus den geschändeten Gräbern nur Teile der Leichen entwendet worden waren, war im letzten Fall der ganze Leichnam verschwunden. Stanley Hakeah war ein weithin bekannter und angesehener Heiler und Mitglied der einflussreichen Medicine Men Association der Dineh gewesen. Er hatte weitab von anderen Menschen allein gelebt. So hatte man seinen Tod erst spät bemerkt. Es war zu spät gewesen, ihn auf die Reise ins Jenseits vorzubereiten, indem man ihm die Haare mit einem Sud aus Yucca-Wurzeln wusch und seine Mokassins zu vertauschen, um die bösen Geister, die ihm auf seinem Weg in die Geisterwelt eventuell folgen könnten, zu verwirren.
Niemand war da gewesen, um Stanley Hakeah aus dem Hogan zu bringen, damit sein Geist sich im Augenblick des Todes auf die ewige Reise begeben konnte. So hatten seine Verwandten zunächst ein Loch in die Decke seines Hogans geschlagen, so dass der Chindi heraus konnte. Anstatt ihn in der Umgebung unter Felsen zu begraben und die Türöffnung und den Rauchfang des Hogans zu verschließen, wie es üblich gewesen wäre, hatten sie später unter Ausführung der üblichen Rituale und nachdem sie ihm seinen Medizinbeutel und einen Behälter mit Maispollen mitgegeben hatten, den gesamten Hogan über ihm zum Einsturz gebracht.
Vor zwei Tagen hatten in der Gegend lebende Dineh, die ihre Schafe an dem Totenhogan vorbei trieben, dann entdeckt, dass er geöffnet worden war. Die Leiche von Stanley Hakeah war verschwunden. Der Dieb hatte mit den Überresten eines so machtvollen Medizinmannes sicher etwas Besonderes vorgehabt und sie deshalb ganz mitgenommen. Und sollte der Täter wirklich William Nez sein, konnte es gut sein, dass er die Leiche hierher transportiert hatte, um dann in aller Ruhe mit ihr zu machen, was immer er vorhatte.
Officer Begay schauderte bei dem Gedanken. Die Frage war nur, ob Nez sich sicher genug fühlte oder ob er von den Verdächtigungen gegen ihn wusste, falls er überhaupt schuldig war. Zufällig würde ihn hier draußen sicherlich niemand beobachten! Natürlich passte Nez ins Klischee eines Hexers. Er war ein alter Mann, der ohne Kontakt zu den Nachbarn (die auch viele Meilen entfernt lebten), ohne Freunde oder Verwandte ganz allein in der Wildnis lebte, wahrscheinlich dementsprechend eigenbrötlerisch war, kaum Englisch sprach und sich traditionell kleidete.
Während Begay darüber nachdachte, wie glaubhaft die Anschuldigungen gegen Nez sein mochten, meldete sich sein Funkgerät. Er ging von der Felskante zurück zu seinem Truck.
„Hier Officer Frank Begay.“
„Hallo Frank“, meldete sich eine freundliche weibliche Stimme, die seiner Erinnerung nach zu einer hübschen jungen Angestellten in der Zentrale der Stammespolizei gehörte, „hier spricht Window Rock. Wir müssen Sie leider bei der Hexenjagd stören! Sie sind bei uns von der Bundespolizei angefordert worden!“
Begay war überrascht: „Von der Bundespolizei? Warum das?“
„Keine Ahnung! Muss wohl ’ne wichtige Sache sein. Hier ist ein Typ vom FBI aufgeschlagen, der Sie einweisen soll. Wann können Sie hier sein?“
Begay sah auf die Uhr: „Wenn ich sofort losfahre, so gegen Mittag. Was wird dann aus der Observation hier?“
„Wir schicken einen Kollegen. Machen Sie sich auf den Weg!“
Begay beendete das Gespräch und ging nochmal an den Rand des Felsens. Von hier konnte er weithin über die farbenprächtige Landschaft der Painted Desert sehen. Die Sonne stand schon ein Stück höher am Himmel und die Luft über den bizarren Felsformationen begann bereits zu flimmern. Begay kniff die Augen zusammen. Weit entfernt über den Bergen und Canyons ließ sich ein einsamer Geier von den jetzt entstehenden Aufwinden langsam in die Höhe tragen. Von Nez war weiterhin keine Spur zu sehen. Sollte sich jemand anderes darum kümmern.
II
Begay erreichte Window Rock, das Verwaltungszentrum der Navaho Indian Reservation, gegen ein Uhr mittags. Da er auf eine längere Observation vorbereitet gewesen war, hatte er reichlich Lebensmittel dabeigehabt und unterwegs nur einmal gehalten, um ein Sandwich zu essen. In Window Rock, das seinen Namen einem Durchbruch in einer Felswand oberhalb des Ortes verdankte, fuhr er sofort zum Hauptquartier der Stammespolizei. Er wurde bereits erwartet.
Captain Blackhat, sein Vorgesetzter, mit dem ihn ein nicht immer ungetrübtes Dienstverhältnis verband, führte ihn in sein Büro, wo ihn ein junger Mann in offensichtlich teurem Anzug, italienischen Schuhen und mit tadellosem Haarschnitt begrüßte. Begay wurde bewusst, wie staubig und zerknittert seine Kleidung, bestehend aus Jeans, Hemd und Turnschuhen, aussehen musste. Er hatte seit zwei Tagen keine Dusche gesehen und sein schulterlanges Haar fühlte sich nach der Fahrt auf etlichen Sandpisten staubig an.
Blackhat machte die beiden bekannt, wobei er den jungen Mann als Agent Taylor vom FBI-Büro in Albuquerque vorstellte. Die Männer gaben sich die Hand und nach dem Austausch von Freundlichkeiten, wie er unter weißen Amerikanern üblich war, kam Taylor zur Sache.
„Officer Begay, wie Sie bereits gehört haben, haben wir im Zuge der Amtshilfe um Ihre Dienste gebeten. Wir haben einen Mordfall im Norden, bei dem wir und die örtlichen Behörden bisher völlig im Dunkeln tappen.“
„Und warum sollte ausgerechnet ich Ihnen da helfen können?“, fragte Begay skeptisch.
„Nun, Sie stehen im Ruf, ein begnadeter Spurenleser zu sein! Das könnte uns weiterhelfen. Bisher konnten wir in keinem Fall einen Tatort mit Sicherheit ausfindig machen. Unser Täter legt offensichtlich großen Wert darauf, seine Opfer von dort wegzuschaffen. Das legt die Vermutung nahe, dass der Tatort etwas über den Mörder oder sein Motiv aussagen würde.“
„Sie sagen, es geht um mehrere Morde?“, fragte Begay schnell. Vor Schreck hatte er die Anstandsregeln der Navaho offensichtlich vergessen, nach denen man immer abwartete, bis der andere wirklich ausgeredet hatte.
„Ja, wie es scheint, handelt es sich um einen Serientäter“, warf Captain Blackhat ein.
„Ganz richtig. Bis jetzt haben wir drei Tote gefunden. Alles dieselbe Handschrift. Im letzten Fall haben wir nun durch Zufall relativ bald den Wagen des Opfers sicherstellen können. Weit entfernt vom Fundort der Leiche und weitab jeder Zivilisation.“
„Und nun vermuten Sie, dass dort der Tatort liegen muss?“
„Genau! Wir haben in der Nähe auch eine Menge Spuren gefunden. Es könnte sich also um den Tatort handeln. Hat uns aber auch nicht weitergebracht. Bisher fehlt uns jeder Hinweis auf ein Motiv, geschweige denn auf einen Täter. Was wir brauchen, ist ein Spezialist!“
„Aha, deshalb der indigene Fährtenleser!“, lachte Begay.
„Bitte machen Sie sich nicht lustig! Niemand kann es mit indianischen Spurensuchern aufnehmen“, sagte Taylor.
„Und Sie sind der beste Spurenleser in der gesamten Navaho Tribal Police, Frank“, meinte Blackhat mit einem Anflug von Stolz in der Stimme.
„Wo genau wurden denn die Leichen gefunden?“, fragte Begay irritiert.
„Im südlichen Montana und im Norden Wyomings.“
„Aber dort oben gibt es doch jede Menge Indianerreservationen, die Crow, Blackfeet, Cheyenne, Sioux und viele andere und alle haben ihre Stammespolizei mit ausgebildeten Fährtensuchern!“
„Wir brauchen aber jemanden mit kriminalistischer Erfahrung.“
„Und beschränkter Handlungsbefugnis…“, ergänzte Begay.
Er spielte auf die eingeschränkten Vollmachten der Stammespolizisten an. Zwar galten die Indianerreservationen als halbautonome Gebiete, in denen das Recht der jeweiligen Stämme galt. Diese Gesetzgebung erstreckte sich aber nur auf minder schwere Delikte. Lag ein Kapitalverbrechen vor, fiel es automatisch in die Zuständigkeit der Bundesbehörden. In diesen Fällen tauchten sofort Beamte des Federal Bureau of Investigation, abfällig auch Feds genannt, auf und rissen alles an sich. Sie degradierten die Stammespolizisten zu Laufburschen, sahen auf sie herab und versauten meistens alles, da sie weder über den kulturellen Hintergrund der Reservatsbewohner noch über deren Mentalität irgend etwas wussten und grundsätzlich mehr Spuren zertrampelten als sicherstellten.
„Nun, für die Zeit Ihrer Ermittlungen in diesem Fall würden Sie die volle Handlungsbefugnis haben. Sie erhalten von uns einen Ausweis als FBI-Beamter.“
Begay und Blackhat wechselten einen erstaunten Blick.
„Befristet natürlich. Sehen Sie, das ist auch einer der Gründe, warum wir Ihre Hilfe erbitten. Wir wissen, dass Sie auch auf anderen Indianerreservationen schon eingesetzt wurden und hervorragende Arbeit geleistet haben. Wenn ich recht informiert bin, haben Sie im Rahmen Ihrer Ausbildung auch Anthropologie an der Universität von Albuquerque studiert und sind ein profunder Kenner der Native Nations.“
Taylor benutzte diesen Ausdruck für die eingeborenen Völker Amerikas, der von den meisten Ureinwohnern lieber gehört wurde als Indianer oder anderes.
Begay hatte sich tatsächlich mit der Kultur verschiedener Stämme beschäftigt und war wohl auch deshalb schon auf anderen Indianerreservationen eingesetzt worden, allerdings immer im Südwesten der USA. Eine Zusammenarbeit mit der Hopi-Stammespolizei war an der Tagesordnung, da das Hopi-Reservat von der größeren Navaho-Reservation umgeben war. Aber auch auf den beiden nördlich an das Navaho-Gebiet angrenzenden Ute-Reservationen und auf dem Reservat der Jicarilla- und San Carlos-Apachen hatte er schon gearbeitet.
„Dann vermuten Sie, dass der Täter ein Indianer sein könnte?“
„Möglicherweise ja.“ Taylor nestelte an seinem schicken Anzug herum. „Zumindest könnte es sein, dass Untersuchungen in diesem Umfeld erforderlich werden.“
Etwas leuchtete Begay nicht ein. Mit Sicherheit gab es in der Gegend, in der die Morde passiert waren, gute indianische Cops und Spurenleser, die sich aber darüber hinaus mit den Sitten und der Geschichte der dortigen Stämme viel besser auskannten als er. Wenn das FBI unbedingt einen Navaho-Polizisten wollte, hieß das, dass sie verhindern wollten, das gemeinsame Clan- oder Stammeszugehörigkeiten die Ermittlungen gefährdeten oder dass sich durch einen in der Gegend beheimateten Ermittler Informationen über den Fall herumsprechen könnten. Er kannte die Praxis des FBI, indianische Beamte bevorzugt im Gebiet anderer, ihnen völlig fremder Stämme einzusetzen. Von den großen kulturellen Unterschieden zwischen verschiedenen indianischen Völkern wussten die meisten Weißen ja nichts, für sie war eben ein Indianer wie der andere.
„Warum vermuten Sie, dass es sich bei dem Täter um einen Native American handeln könnte?“, fragte er.
„Okay, ich denke, es ist an der Zeit, Ihnen etwas zu zeigen“, sagte Taylor und öffnete einen Ordner, den er aus seiner Aktentasche hervorholte. Er legte mehrere Fotos auf den Tisch vor Begay und Blackhat. Sie zeigten drei männliche Leichen, eine davon schon im fortgeschrittenen Stadium der Verwesung. Alle drei waren übel zugerichtet und besonders am Kopf mit getrocknetem Blut verschmiert. Im selben Augenblick erschauderten Blackhat und Begay und sahen alle Fotos noch einmal durch: Die Toten waren allesamt skalpiert worden.
III
Der Mann saß im Dunkeln. Das Atmen wurde ihm schwer. Er lauschte auf den monotonen Gesang des alten Schamanen. Um das Luftholen zu erleichtern, presste er ein Büschel Salbei vor den Mund. Es erfrischte den Atem in der heißen Luft. Um ihn herum war fast nichts zu sehen. Nur in der Mitte des kleinen Raumes sah er ein schwaches Glühen, das den davor liegenden Bisonschädel gespenstisch schwach erhellte. Im Licht der glühenden Steine sah der Mann schemenhaft die anderen Teilnehmer der Zeremonie. Er kannte sie alle seit Jahren. Vier davon waren sehr alte Männer mit den markanten Gesichtszügen der Lakota, wettergegerbten, lederartigen Gesichtern. Es gab nur zwei jüngere Männer im Zelt: ihn selbst und einen weißen Mann, der seit langem bei dem Volk lebte. Er selbst nannte sich Tschetan, Falke, während er von den Lakota „Weißer Mann, langes Haar“ genannt wurde. Aber anders als die Indianerfreaks, die mit langen Haaren, Stirnband und Fransenhemden sporadisch für kurze Zeit auf der Reservation auftauchten und ähnlich wie die Völkerkundler Zielscheibe beißenden Spotts und Quell nicht enden wollender Belustigung waren, wurde Weißer Mann, langes Haar von den Leuten akzeptiert. Er hatte eine Lakota-Frau geheiratet und zwei Kinder mit ihr, war in der Familie integriert und half seinen Nachbarn bei Bedarf, wie es alle taten. Er nahm an vielen Zeremonien teil und sprach fließend Lakota. Wenn es um die Verbrechen der USA und die Unterdrückung der Ureinwohner ging, war er radikaler und weniger kompromissbereit als die meisten Indianer. Wahrscheinlich weil er die Weißen besser kannte als die Lakota, dachte der Mann.
Weißer Mann, langes Haar hatte in Englisch gebetet, vielleicht konnte er so seine Gefühle und Wünsche am besten artikulieren. Der Mann hatte wie die anderen Teilnehmer der Zeremonie in Lakota gebetet, zu Wakan tanka, dem Großen Geist, dem Großen Geheimnis. Er hatte für alle Menschen, die ihm wichtig waren, gebetet, für sein Volk und für alle Wesen, die zweibeinigen, vierbeinigen, geflügelten, für die Pflanzen und die Steine. Mitakuye Oyas‘in, all‘ meine Verwandten…
Alle hatten ihr Gebet mit der traditionellen Formel begonnen und beendet und waren dann in Kontemplation versunken. Nur der alte Schamane sang für sie alle. Während er spürte, wie der Schweiß seinen Rücken hinabfloss, versank der Mann immer mehr in sich. Um ihn herum war nur das Glühen, der Geruch nach Kräutern, der Gesang, die Geister der Ahnen und die heiße, reinigende Luft in dem kleinen abgeschlossenen Raum der Schwitzhütte. Dies war eins der ältesten und auch heute noch am meisten ausgeführten Rituale seines Volkes. Er fühlte sich verbunden mit seinen Vorfahren. Es war wie in einer Zeit vor über hundert Jahren, als es noch keine Waschitschu, keine Menschen, die einem das Fett in der Suppe wegnahmen, in diesem Land gegeben hatte. Selbst die Mistgabel, mit der sie die draußen im Feuer glühend erhitzten Steine hereingebracht hatten, um sie dann mit Wasser zu übergießen, war außerhalb der Hütte geblieben. Nichts erinnerte hier an die neue Zeit. Im Glühen in der Mitte des Raumes begann sich ein Traum zu bilden, eine Vision. Die Ahnen waren hier bei ihnen. Sie sprachen zu ihm. Er starrte weiter auf den rötlich schimmernden Büffelschädel. Das Bild begann sich zu verändern.
Er sah einen weißen Büffel und einen schwarzen. Der schwarze Büffel war sein Schutzgeist. Er hatte ihn schon oft in seinen Visionen gesehen. Schon vor mehr als zwanzig Jahren, auf seiner ersten Visionssuche, der Hanblecha, die ihn zum Mann machte, hatte er den schwarzen Büffel gesehen. Der Medizinmann, der ihn auf der Visionssuche angeleitet hatte und dem er danach von seinen Visionen erzählt hatte, sagte daraufhin, dass der schwarze Büffel sein Schutzgeist sein werde, dem er immer wieder begegnen würde und dass dies nun sein Name sein solle: Tatanka sapa, Schwarzer Büffel.
Der weiße Büffel war heilig. Er verwandelte sich in eine schöne Frau, die ganz in weißes Büffelleder gekleidet war. Ptesan Win, White Buffalo Woman, war die mythische Gesetzgeberin der Lakota-Kultur, die dem Volk vor Menschengedenken die heilige Pfeife und die sieben heiligen Zeremonien gebracht hatte. Der Mann sah jetzt viele Büffel, Bullen, Kühe und Kälber. Er hörte das typische Grunzen der Stiere und meinte, den von den Hufen aufgewirbelten Staub schmecken zu können, er roch den strengen Geruch der Tiere. Er lächelte vor Glück. Und dann hörte er die Stimmen. Es waren die Stimmen der Geister, die zu ihm sprachen. Der Mann verharrte regungslos, um die Worte der Geister zu empfangen: „Tatanka sapa, es ist Dir bestimmt, die Büffel zu schützen. Du tust Recht. Du musst die Büffel beschützen. Es gibt nur noch so wenige von uns. Aber ein Mann wird kommen. Ein großer Krieger aus dem Süden. Er sucht dich und er wird dich finden. Seite an Seite wirst du mit ihm kämpfen und doch wirst du durch ihn sterben. Für den Schutz der Büffel wirst du sterben.“
Seine Vision begann zu verschwimmen. Er wehrte sich dagegen, kniff die Augen zusammen, wollte sie festhalten, aber etwas aus der äußeren Welt drang auf ihn ein. Jemand schüttelte ihn an den Schultern. Unwillig tauchte er zurück in die andere Welt. Die Decke vor dem Ausgang der Schwitzhütte war zurückgeworfen worden und helles Tageslicht drang in Strahlen in den Dampf im Inneren der Hütte ein. Der Medizinmann schüttelte ihn an den Schultern. Die anderen waren draußen. Er hatte das Ende der Inipi-Zeremonie nicht bemerkt. Entrückt in seiner Vision war er sitzen geblieben, als alle hinausgegangen waren. Obwohl er auch jetzt am liebsten noch in der Hütte geblieben wäre, wusste er, dass er hinausgehen musste, um seinen Körper abzukühlen. Benommen stand er auf und bückte sich durch den Ausgang ins Freie. Draußen umfing ihn gleißender Sonnenschein und obgleich es ein warmer Tag war, schien ihm die klare Luft kalt. Ein wolkenloser blauer Himmel wölbte sich über der Wiese und den Bergkiefern und der Bach, in dem sich die Männer abkühlten und wuschen, rauschte leise zwischen den Felsen. Er hatte eine Vision erhalten. Er wusste, dass er das Richtige tat. Es war ihm immer schon bestimmt, die Büffel zu schützen. Aber er wusste jetzt auch, dass er dafür sterben würde.
IV
Einen Tag nach der Besprechung mit Blackhat und Agent Taylor war Frank Begay gegen Mittag in Billings gelandet. Das FBI hatte ihm einen der seltenen Direktflüge von Albuquerque gebucht. Den Rest des vorherigen Tages hatte er bei seiner Frau und seinem Sohn in ihrem Haus in der Nähe von Chinle verbracht und war dann morgens zum Flughafen gefahren. Seine Frau war nicht begeistert gewesen, dass er für längere Zeit weg sein würde. Aber ihre Beziehung äußerte sich nicht mehr in starken Gefühlsausbrüchen oder Gesten, seit ihr älterer Sohn Julian ums Leben gekommen war. Besonders Kathy Begay war seitdem sehr still geworden und hatte sich in ihre eigene Gedankenwelt und Erinnerungen zurückgezogen. Sie hatte ihm keine Szene gemacht, aber er wusste auch so, dass sie nicht billigte, dass er sie so lange allein ließ und sich vor den Karren der Bilagaana, der Weißen, spannen ließ. Sein Sohn hatte nur gefragt, warum er denn für das blöde FBI arbeite, besonders, wo er doch schon so oft Ärger mit dieser Behörde gehabt habe.
Frank wusste nicht genau, warum er den Auftrag angenommen hatte. Natürlich verdiente er während der Tätigkeit für das FBI ein Vielfaches seines spärlichen Gehaltes als Navaho-Cop. Aber er machte sich nicht viel aus Geld, und im Vergleich zu dem Großteil der Reservatsbewohner war seine Familie bereits eher wohlhabend. Dieser Fall interessierte ihn wirklich.
Seit Julians Tod hatte er sich immer mehr in seine Arbeit geflüchtet. Dabei hatte er Zeit, seinen Gedanken nachzuhängen. Besonders die langen Autofahrten durch die endlosen Halbwüsten und Berglandschaften der Reservation und die langen Wartezeiten bei Observationen oder wenn er auf die Ankunft von Zeugen wartete, bei denen man sich nicht anmelden konnte oder die in Folge der „Indian Time“ später kamen, gab ihm Gelegenheit zum Nachdenken.
Alles hatte sich verändert nach Julians Tod. Sie waren nicht mehr die glückliche Familie wie vorher. Früher hatte er seine Arbeit mehr als Broterwerb gesehen. Er hatte sie immer schon gewissenhaft erledigt und es war nie ein Nine-to-Five-Job gewesen, aber früher war es nicht seine Lebensaufgabe gewesen. Wie viel Zeit hatten er, Kathy und die beiden Jungen damals zusammen in der Natur verbracht, bei ihrem Sommer-Hogan in den Chuska-Mountains! Sie hatten sich um die Schafe gekümmert, Kathy hatte am Webstuhl gesessen und an ihren wunderschönen Navaho-Decken gearbeitet. Er war mit seinen Söhnen auf die Jagd gegangen oder sie hatten die Wildnis durchstreift. Abends hatten sie am Feuer gesessen, sich unterhalten, Geschichten erzählt und zusammen gelacht. Nicht, dass er Kathy und Daniel jetzt weniger geliebt hätte als früher, aber das Glück und die Sorglosigkeit zwischen ihnen war zerbrochen.