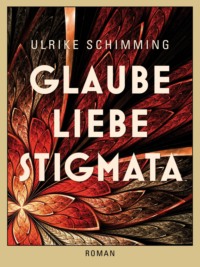Kitabı oku: «Glaube Liebe Stigmata», sayfa 3
Beim Abendessen redeten nur die Erwachsenen. Francesco stocherte in der Polenta auf seinem Teller. Sein Bauch war wie zugeknotet. Er war noch nie in einem Kloster gewesen. Wenn dort nur Männer lebten, wer kochte für sie? Irgendjemand musste aber kochen, denn Mönche verhungerten nicht, davon hätte er sonst bestimmt schon mal gehört. Und der Padre sah auch nicht so aus, als ob er Hunger leiden müsste. Francesco schielte zu ihm hinüber.
»Der Kaplan unterrichtet?«, fragte Padre Carmelo.
»Der ist zu teuer«, erwiderte Papà, griff nach seinem Weinglas und trank in einem Zug aus.
Mamma hatte Pasqualina auf dem Schoß und fütterte sie. Matteo, Chiara und Flora blickten schweigend von Padre Carmelo zu Papà, von Padre Carmelo zu Mamma, dann zu Francesco. Er konnte immer noch nichts essen. Eine trockene Haut überzog bereits die Polenta auf seinem Teller.
»Es muss sein.« Padre Carmelos Stimme klang lauter. »Ihr könnt eure Kinder nicht ohne Schulbildung lassen. Es soll ihnen doch einmal besser gehen. Das wird ein Segen für alle sein. Ich rede mit dem Kaplan, gleich morgen. Das mit dem Geld lässt sich sicher regeln.«
Der Kaplan. Das war Signor Caccavo, fiel Francesco ein und legte die Gabel neben den Teller. An den hatte er überhaupt nicht gedacht. Der Kaplan unterrichtete. Es gab zwar keine Schule im Dorf, aber doch einen Lehrer.
In der Nacht wälzte Francesco sich in seinem Bett hin und her. Sein Herz pochte, in seinen Ohren rauschte es. Padre Carmelo wollte für ihn eintreten. Du wirst lesen lernen, flüsterte eine Stimme in seinem Kopf. Und schreiben. Das ist der Weg. Padre Carmelo wird es richten. Du wirst Mönch. Mit Bart. Du folgst Franz von Assisi. Und Mamma freut sich.

KAPITEL 5
Adelia schob das Laken zur Seite. In ihrem Zimmer war es stickig, selbst das geöffnete Fenster hatte in dieser Nacht keine Abkühlung gebracht. Ihr Nachthemd war feucht vom Schweiß, und egal wie Adelia sich drehte, sie fand keine kühle Stelle im Bett. Sie legte sich auf die Seite, die Hände unter der rechten Wange. Auf ihrem Tischchen erhob sich ein Stapel neuer Romane aus Europa, den sie selbst im Dämmerlicht des frühen Morgens genau erkennen konnte. Die Bücher hatte sie gestern im Laden die Straße hinunter gekauft, weil sie in Vaters Bibliothek fehlten und ihre Hauslehrerinnen es nicht wagen würden, sie als Lektüre im Unterricht durchzunehmen. Auf den neuesten Roman von E. M. Foster über die Reise der verwitweten Lilia Herriton nach Italien freute sie sich besonders. Er würde ihr in den kommenden Wochen auf dem Land, in Hurstmont, die Langeweile vertreiben.
Adelia gähnte. Irgendwie hatte sie nicht geschlafen, und scheinbar wirkte sich Schlafmangel auf die Sinne aus, denn es roch nach beißendem Qualm. Sie setzte sich auf. Das fahle Morgenlicht flackerte orangerot. Von der Fifth Avenue drang Geschrei. Adelia sprang aus dem Bett und lief barfuß zum Fenster. Saint Thomas auf der anderen Straßenseite brannte. Aus dem hinteren Teil der Kirche, dort, wo der Altarraum war, schlugen hohe Flammen.
»O mein Gott«, entfuhr es Adelia, dann musste sie husten. Sie schlug die Hände vor den Mund, konnte aber den Blick nicht abwenden. Auf dem Bürgersteig rannte die Hausmeisterin der Episkopalkirche hin und her.
»Es brennt! Die Kirche brennt!« Sie hielt jeden Passanten auf, der die Straße entlangkam. »Schnell! Hilfe! Zu Hilfe!«
In den Nachbarhäusern gingen die ersten Fenster und Türen auf. Die Bewohner schauten auf das weiße Kirchengebäude und fingen aufgeregt an zu reden. Die Hausmeisterin schrie immer noch, während ein Polizist angelaufen kam.
»Officer, so helfen Sie doch.« Sie schüttelte ihn am Arm. »Der Altar brennt.«
Ihre Stimme war so laut und schrill, als stände Adelia genau neben der Frau. Der Gestank wurde immer beißender. Schwarze Rauchwolken quollen aus der Kirche. Adelia fröstelte, und wieder musste sie husten.
»Miss Adelia, um Gottes willen, machen Sie bloß das Fenster zu«, rief jemand hinter ihr. Adelia drehte sich langsam um. Ethel stand in der Tür, ebenfalls im Nachthemd, ihre offenen Haare quollen unter der verrutschten weißen Haube hervor. »Dieser Gestank. Den bekommen Sie aus den Vorhängen nie mehr raus. Rasch.«
Sie eilte zum Fenster und zog es mit einem entschlossenen Ruck nach unten, die Scheibe im Rahmen schepperte.
Adelia zuckte zusammen.
»Ethel, die Kirche … Hast du das gesehen? Sie brennt.« Tränen verschleierten ihren Blick, Ethel wirkte wie ein Unterwasserwesen. Adelia blinkerte ein paarmal, dann stand Ethel mit ihrem spitzen Dienstbotengesicht wieder deutlich vor ihr. »Sie brennt, und es wird immer schlimmer. Wo bleibt denn die Feuerwehr? Ethel, weißt du wo die Feuerwehr bleibt? Das muss man doch löschen, sonst … o Gott!« Adelia schluchzte. Das Haus Gottes brannte, und alles, was darin war, verglühte zu Asche, die Bibel, das Kruzifix, die Gemälde, die Gesangbücher, die Bänke. All die schönen Dinge. Diese heiligen Dinge. Das musste verhindert werden. Heiliges musste man schützen. Das Kruzifix brannte. Adelia zitterte. Das waren doch nur Gegenstände, da brannten Gegenstände, die man ersetzen konnte. Sie atmete tief ein. Aber vielleicht waren noch Menschen in der Kirche und in höchster Gefahr. Sie stützte sich auf die Fensterbank und starrte auf die Kirche, ob sich da etwas bewegte. Kämen Menschen darin zu Schaden, würde Jesus ein zweites Mal sterben, an dem brennenden Kruzifix. Adelia schluchzte lauter.
»Miss Adelia, nur die Ruhe. Keine Sorge. Die Feuerwehr kommt bestimmt gleich.« Ethel legte ihr einen Arm um die Schulter und zog sie zum Bett.
»Nein, ich muss das sehen.« Adelia machte sich los und stellte sich wieder an das geschlossene Fenster. Auf der Straße blieben die ersten Schaulustigen stehen, Geschäftsleute in Anzügen und Hüten. Arbeiter hielten ihre Karren an und gafften von ihren Böcken auf die Kirche. Kinder mit Schulranzen rannten über die Kreuzung, Hausmädchen mit weißen Schürzen und Körben unter dem Arm tuschelten miteinander. Schon konnten die Fuhrwerke, beladen mit Holz, Fässern oder Obststeigen, nicht mehr passieren. Die ersten Automobile hupten, schoben sich langsam über die Kreuzung.
»Ziehen Sie sich wenigsten den Morgenrock über und Ihre Pantoffeln, sonst erkälten Sie sich noch.« Ethel kam mit dem seidenen Morgenmantel und legte ihn Adelia über die Schultern.
»Ach, es ist doch viel zu heiß«, wandte sie ein, schlüpfte aber dennoch in den Morgenmantel. Ihre Hände zitterten, während sie sich den Gürtel zuband. »Sind die anderen schon wach?« Sie starrte immer noch nach draußen. Automobile, Karren, Kutschen, große und kleine Fuhrwerke verstopften die Straße. Die Pferde tänzelten nervös und warfen die Köpfe hin und her. Kaum ein Wagen kam voran. Dichter Qualm lag über der Kreuzung.
Ethel stand neben ihr. »Ja. Der Krach hat das ganze Haus aufgeweckt. Auch die Dienerschaft, wir sind alle schon auf den Beinen. Die anderen bereiten gerade das Frühstück vor.«
»Wie kann man jetzt an Frühstück denken?« Adelia schüttelte den Kopf. Der Qualm kratzte im Hals. Wieder musste sie husten. Keinen Bissen würde sie herunterbringen. Das brennende Kruzifix drückte ihr die Schultern nieder, denn sie konnte es nicht aus dem Inferno retten und in Sicherheit bringen.
»Doch, Sie müssen was essen. Heute haben Sie so viel vor. Italienische Konversation mit Signora Rinaldi, Tennisstunde vor dem Lunch, nachmittags kommt die Schneiderin wegen der Anprobe Ihres Ballkleids. Außerdem müssen Sie sich endlich für ein paar Schuhe entscheiden. Sie können schließlich nicht barfuß tanzen.«
»Ach, Ethel, kann das nicht warten? Da drüben brennt Saint Thomas, und du denkst an Ballschuhe.« Sie zog ein Taschentuch aus dem Morgenrock und putzte sich die Nase.
»Und wie soll ich das Ihrer Frau Mutter erklären?«, entgegnete Ethel mit hochgezogenen Brauen. »Sie wissen genau, dass Madame Pyle keine Trödelei duldet. Ich vermute, selbst eine Tragödie wie diese wird sie nicht dazu bringen, ihre Termine zu verschieben.«
»Ich rede mit Mutter«, sagte Adelia. »Sie mag ja von mir aus ihre Termine wahrnehmen, aber ich kann heute nicht einfach so weitermachen, als wäre nichts passiert. Ich muss erst wissen, ob dort drüben jemand zu Schaden gekommen ist und wie ich helfen kann.« Sie lehnte die Stirn an die kühle Fensterscheibe.
Auf der anderen Straßenseite schlugen die Flammen immer höher. Eine Rauchsäule stand über der Kirche mit den gotischen Spitzbögen über den drei Eingangstüren. Da erklang in der Ferne endlich das Gebimmel des Feuerwehrwagens. Im Schritttempo bahnte sich der Wagen, der aus der Richtung vom Central Park kam, den Weg durch Menschen, Automobile und Fuhrwerke. An der gegenüberliegenden Hausecke entdeckte Adelia wieder die Hausmeisterin auf den Treppenstufen zu der Villa, in der bis vor ein paar Wochen Kathy gewohnt hatte. Seit Adelia denken konnte, hatte sie mit Kathy gespielt, hatte mit ihr zusammen immer die Messe in der Covenant-Kirche, ihrer gemeinsamen Taufkirche in der 42. Straße, besucht. Und sonntags waren sie oft zusammen im Central Park spazieren gegangen. Doch nun war Kathys Familie in ein neues Haus in der Upper Eastside gezogen, und sie trafen sich kaum noch. Adelia seufzte. Das Haus, das sie in all den Jahren mit Kathy bis in den letzten Winkel erkundet hatte, sollte in den nächsten Tagen abgerissen werden. Wieder würde eines dieser übertrieben großen Gebäude in die Höhe wachsen und die Aussicht verbauen, so wie es weiter unten auf der Fifth Avenue gerade üblich war. Die Frau vor Kathys Haus hatte die Hände vor das Gesicht gepresst, ihr Oberkörper schüttelte sich. Sie weinte.
Endlich bezogen Feuerwehrleute Position, rollten die Schläuche aus, hantierten an den Hydranten, Wasser ergoss sich über die Kirche. Wasser, immer mehr Wasser spritzten sie in die Flammen, es rann über den Bürgersteig, umspülte die Füße der Schaulustigen, umspülte die Hufe der Pferde und die Reifen der Automobile, vermischte sich mit dem Staub und dem Sand der Straße, bildete Pfützen und Schlamm. Die ersten Menschen gingen weiter, ein Polizist scheuchte die Schulkinder fort. Die Fuhrwerke rumpelten los, die Arbeiter zogen ihre Karren von der Kreuzung. Da löste Adelia sich vom Fenster und lief an Ethel vorbei aus ihrem Schlafzimmer, hinunter in den Salon.
»Adelia, warum bist du noch nicht angezogen?«, sagte Mutter statt einer Begrüßung, während sie ihre Damastserviette entrollte und sich auf den Schoß legte. »Und wo um alles in der Welt sind deine Pantoffeln? Du holst dir noch den Tod mit den nackten Füßen.«
Der Frühstückstisch war tatsächlich schon gedeckt, obwohl es erst halb sieben war. Normalerweise frühstückte die Familie nicht vor neun, doch alle saßen bereits am Tisch. Die Eltern wie gewöhnlich an den Enden der Tafel. John und Victor, rechts und links von Vater, lasen Zeitung. Gordon und Chester saßen neben der Mutter, während Lizzy gerade in der Mitte Platz nahm.
»Wieso seid ihr alle schon angezogen?«, erwiderte Adelia. »Und wie könnt ihr nur ans Essen denken? Habt ihr nicht gesehen, was draußen los ist?«
»Klar«, sagte Victor und ließ die Zeitung sinken. »Die Kirche steht ja genau vor meinem Fenster. Also, schlafen konnte ich bei dem Radau nicht mehr – und da habe ich mich eben angezogen, wie das zivilisierte Menschen morgens nach dem Aufstehen eben tun.« Er vertiefte sich wieder in die Lektüre des Wall Street Journals.
»Wie kann man nur so arrogant sein«, entfuhr es Adelia. »Saint Thomas brennt, und der feine Herr hat nur die Börse im Kopf. Mitgefühl kennst du wohl nicht, was?« Sie stellte sich neben seinen Stuhl und legte die Hand auf seine Lehne. Seit Victor die meiste Zeit mit seinen Kommilitonen an der Columbia University zusammen war, hatte er sich zu einem ausgemachten Ekel entwickelt. Noch vor einiger Zeit hatten sie sich immer bestens verstanden.
»Mitgefühl? Mit was? Mit einem Steinhaufen? Pah!«
»Das ist kein Steinhaufen. Das ist eine Kirche. Ein Haus Gottes.« Adelia bekam fast keine Luft mehr. Das war nicht mehr der Victor, mit dem sie im Landhaus Verstecken gespielt und der sie immer so liebevoll geneckt hatte.
»Wir sind Presbyterianer«, sagte John. »Was geht uns da die Episkopalkirche an?«
»Das, mein Sohn«, erwiderte Vater, während er klirrend die Kaffeetasse abstellte, »zeugt wirklich von wenig Mitgefühl, dafür aber von jeder Menge Arroganz. Auch wenn wir einer anderen Kirche angehören, sind wir doch alle Christen. Da darf man schon mal ein wenig Bedauern für dieses Unglück an den Tag legen. Zumal so ein Brand immer erhebliche Kosten verursacht, von den menschlichen Opfern einmal ganz abgesehen. Weiß man schon, ob Menschen zu Schaden gekommen sind, Hensley?«
Die Hände auf dem Rücken, den Blick auf das Portrait von Großvater Pyle am Ende des Salons gerichtet, stand Hensley neben der Anrichte. Er machte einen Schritt vor. »Nein, Sir, noch gibt es keine Berichte. Das Feuer ist noch nicht gelöscht, aber die Feuerwehr ist vor zwanzig Minuten eingetroffen. Wir müssen abwarten. Sobald ich mehr erfahre, lasse ich es Sie wissen, Sir.«
»Gut, Hensley. Noch einen Kaffee, bitte.« Nun griff auch Vater nach der Zeitung.
Adelia lief an das hinterste der hohen Fenster im Salon. Die Feuerwehrmänner pumpten immer noch Wasser auf die Kirche. Weißer Qualm stieg auf. Wieder drang der Brandgeruch Adelia in die Nase. Selbst durch die geschlossenen Fenster kam er. Sie hustete.
»Mutter, ich wollte noch sagen, dass ich heute keinen Unterricht vertrage.« Sie drehte sich zur Frühstückstafel. »Und die Schneiderin soll an einem anderen Tag wiederkommen. Heute kann ich wirklich nicht. Der Gestank macht mir Kopfschmerzen.« Wenn es doch nur Kopfschmerzen wären. Der Druck auf den Schultern ließ nicht nach, das Kreuz schien sie zu Boden zu pressen, nur mit Mühe konnte sie sich aufrecht halten. Adelia lehnte sich an den Fensterrahmen.
»Kind, das kommt gar nicht infrage. Reiß dich zusammen. Nimm etwas Schmerzpulver, wenn du den Gestank nicht erträgst. Aber dein Lehrplan ist nun einmal straff gestrickt. Signora Rinaldi kommt extra aus Brooklyn herüber. Wir können sie jetzt nicht mehr abbestellen. Sie hat noch keinen Telefonapparat und ist so schnell nicht zu erreichen. Außerdem, wie sähe das denn aus? Nein! Eine Dame muss ihren Verpflichtungen nachkommen, was auch passiert.« Mutter griff nach einer zartgerösteten Toastscheibe und dem Buttermesser. Wenn sie von den Verpflichtungen einer Dame redete, war jeder weitere Einwand zwecklos.
»Ich hab keinen Hunger. Bitte entschuldigt mich«, sagte Adelia und kehrte in ihr Zimmer zurück. Ihre Füße waren eiskalt, trotz der Hitze des Morgens, die von draußen mit Macht hereindrang und die Räume weiter aufheizte.
Um zwanzig nach zehn stand Adelia, die schließlich ein blaues Leinenkleid und leichte Sandalen angezogen hatte, am Fenster der Bibliothek und beobachtete immer noch die Löscharbeiten. Zwei weitere Feuerwehrwagen waren dazugekommen. Die Männer mit den Helmen rannten und schrien durcheinander, immer neue Schläuche rollten sie auf. Alle Hydranten der Kreuzung waren angeschlossen. Die Männer löschten nicht mehr nur die Flammen, sondern schützten die Nebenhäuser mit dem Wasser, damit der Funkenflug nicht noch weitere Gebäude in Brand setzte. Mittlerweile brannte der gesamte Dachstuhl der Kirche. Das Knacken und Brechen der Balken drang bis in die Bibliothek.
Signora Rinaldi erschien in der Tür. »Contessina Adelia, mi scusi«, rief sie schnaufend. Sie nannte Adelia immer ›Contessina‹, obwohl die Familie keine Adelstitel trug, doch Adelia hörte diese Anrede gern. »Bitte entschuldigen Sie vielmals, aber es war kein Durchkommen. Mamma mia, che confusione. Was ist denn passiert?«
»Was passiert ist?« Adelia schnellte so abrupt herum, dass Signora Rinaldi zusammenzuckte. Sie zog den dunkelgrünen Vorhang am Fenster beiseite. »Das ist passiert. Das haben Sie doch bestimmt unten am Hauseingang gesehen. Saint Thomas brennt …« Wieder stiegen ihr Tränen auf. Die Fassade der Kirche war mittlerweile schwarz. Die bunten Fenster waren zersprungen, aus der Rosette quoll der Qualm. Hektisch pumpten die Feuerwehrmänner und zogen an den Schläuchen. Aber die Flammen schlugen weiter aus dem Kirchenschiff. Nur der Turm auf der linken Seite schien noch unversehrt zu sein.
»Sì, sì, ich habe es gesehen, aber … ich dachte nicht, dass … o Dio mio … von hier sieht es ja aus wie ein Inferno. Aber ist das nicht gefährlich? Müssen wir nicht das Haus verlassen, falls die Flammen auch hierherkommen?« Signora Rinaldi stellte sich neben Adelia. Sie reichte ihr gerade bis zum Kinn, auf ihrem vollen Busen über der geblümten Rüschenbluse blitzte ein kleines goldenes Kreuz an einer dünnen Kette.
»Anscheinend nicht. Hensley hat sich bei dem Officer erkundigt, und der hat gesagt, es bestehe keine Gefahr. Zudem beharrt Mutter darauf, dass wir heute Unterricht machen. Obwohl, ich sage es Ihnen gleich, liebe Signora Rinaldi, ich bin heute wirklich nicht in der Stimmung für italienische Konversation. Es ist alles so schrecklich …« Sie hustete. Das brennende Kruzifix drückte sie noch immer nieder.
»Mia povera Contessina, Sie haben ja so recht. Aber vielleicht sollten wir das Haus dennoch verlassen und einen Spaziergang im Central Park machen, damit Sie auf andere Gedanken kommen. Dabei könnten wir parlare in italiano. So haben Sie diese tragedia nicht ständig vor sich. Und nicht die ganze Zeit diesen fürchterlichen Gestank in der Nase. Der Contessa wird das sicherlich auch recht sein, vero?« Signora Rinaldi presste sich ein grell geblümtes Taschentuch vor Mund und Nase.
Adelia wandte sich vom Fenster ab. Hinausgehen, ja. Vielleicht würde es helfen, wenn sie in ihrer Kirche beten ging. Dort wurden alle Probleme immer so leicht, und sie spürte keine Last. »Das ist eine gute Idee, Signora. Aber ich möchte heute nicht in den Central Park. Wir sollten lieber in die Covenant-Kirche gehen und beten. Wenn wir sonst schon nicht helfen können, sollten wir immerhin um Beistand für die Kirche und die Leute dort unten bitten. Ich hole mir nur einen Überzieher und meinen Hut.« Sie ging zur Tür. Der Druck auf ihren Schultern ließ nach.
»Aber die Straße ist total verstopft. Wir werden mit dem Wagen nicht herauskommen.« Signora Rinaldis Wangen färbten sich rot.
»Na, dann laufen wir eben.« Die Bewegung würde ihr guttun. Ihr Geist würde ruhig und die Gedanken wieder eine klare Richtung bekommen, so wie nach den Sportstunden im Central Park.
»Aber … das sind … o Dio mio … fünfzehn Blocks mindestens, Contessina.« Signora Rinaldi traten kleine Schweißperlen auf die Stirn. »Das ist viel zu weit. Der Central Park ist nur sechs Blocks entfernt.« Sie tupfte sich mit dem Taschentuch über die Stirn.
»Dann ziehe ich mir eben meine Tennisschuhe an«, erwiderte Adelia. »Mit denen kann ich meilenweit laufen.« Falls Signora Rinaldi noch länger klagen sollte, würde sie eben allein gehen. Für eine Anstandsdame war sie eigentlich schon viel zu alt, und heute hatte sie noch nichts Richtiges zustande gebracht. Sie musste endlich etwas tun.
»Tennisschuhe?! In der Stadt?! No! So können Sie nicht aus dem Haus gehen! Das schickt sich nicht für eine Contessina.« Signora Rinaldi zwirbelte das Taschentuch, als wollte sie es erwürgen.
»Ach, unter dem langen Kleid sieht man die Schuhe doch eh nie. Warum müssen wir Frauen eigentlich so unbequeme hohe Schuhe tragen, wo sie doch niemand sieht? Und mit denen man kaum einen Schritt tun kann. Ist doch fürchterlich. Warten Sie bitte kurz, ich bin gleich zurück.« Sie verließ die Bibliothek und eilte die drei Stockwerke zu ihrem Zimmer hinauf.

KAPITEL 6
Signor Caccavo wartete an der Tür der Kaplanswohnung, gleich neben der Kirche Sant’Anna, auf Francesco. Klein, mit wenigen grauen, sorgsam gescheitelten Haaren stand der Lehrer da, mit einem schwarzen Schnauzbart, dessen Spitzen nach oben gezwirbelt waren, und einem graumelierten Kinnbart.
Padre Carmelo hatte mit Signor Caccavo gesprochen, ihn überredet, er möge den Forgiones das Schulgeld von fünf Lire im Monat stunden. Dann hatte er Mamma und Papà überzeugt, dass es das Beste für Francesco und die Familie sei, wenn er Lesen und Schreiben lernte. Francesco hatte beteuert, erwürde sein Bestes geben. Und so ging er seit einigen Wochen jeden Morgen um halb acht Uhr, nachdem er die Schafe im Stall versorgt, Wasser vom Brunnen geholt und Mamma Feuerholz gebracht hatte, zur Schule. Nach dem Unterricht rannte er heim, aß einen Teller Nudeln, Polenta oder Risotto und trieb danach die Tiere auf die Wiese mit dem knorrigen Olivenbaum.
Francesco stolperte die wenigen Stufen zur Wohnung hoch. »Guten Morgen, Maestro«, sagte er rasch und zwängte sich an Signor Caccavo vorbei. Dieser trug wie üblich einen dunklen Anzug mit weißem Stehkragen und eine schmale Krawatte, alles peinlich sauber und faltenfrei. Jeglicher Gedanke, sich einen Spaß mit seinem Namen zu erlauben, verbot sich sofort.
An einem großen Holztisch in der Küche saßen Sergio, Pietro und Serafina. Mehr Schüler hatte Signor Caccavo nicht. Francesco setzte sich auf einen der Stühle mit den hohen Lehnen. Geschirr und Töpfe waren in einer dunklen Anrichte verwahrt. In der hinteren Ecke stand ein gusseiserner Kochherd, dessen emaillierte Eisentüren so blank poliert waren, dass sich der gesamte Raum darin spiegelte. Ein Wasserkessel stand auf der Platte. Kein Staub lag auf dem Regal mit den Einmachgläsern und Vorratsdosen, selbst der Terrakottafußboden glänzte. Ein kleines Fenster ging zum Kirchplatz hinaus, doch eine weiße Spitzengardine versperrte die Sicht auf die vorbeigehenden Leute aus dem Ort.
Signor Caccavo teilte Schiefertafeln, Griffel und Lesefibeln aus. Anfangs malten die Kinder einzelne Buchstaben. Eine Zeit lang brachte Francesco die kleinen D’s und B’s und P’s durcheinander, nun machte er nur noch selten Fehler. Signor Caccavo diktierte.
Danach lasen sie. Zunächst stand Signor Caccavo immer wie ein Chorleiter am Kopf des Tisches und dirigierte mit der Hand. Gemeinsam lasen sie erst Worte von der großen Tafel laut ab, später Sätze. Als dies nach ein paar Wochen zur Zufriedenheit von Signor Caccavo tadellos klappte, ließ er die Schüler einzeln vorlesen. Francesco zitterte jedes Mal, wenn er an die Reihe kam. Aber er hatte geschworen, dass er sein Bestes geben wollte, also überwand er die Angst. Immer öfter las er fehlerfrei und flüssig. Signor Caccavo nickte anerkennend, und auch Serafina, Pietro und Sergio lauschten aufmerksam. In Francescos Bauch schnurrte eine Katze. Gut gemacht, flüsterte eine Stimme in ihm. Du bist auserwählt. Gott leitet dich. Das ist dein Weg. Bald wirst du Mönch.
Den Schafen wuchs ein dickes Winterfell, die Steineichen warfen das Laub ab. Francesco schlüpfte wieder in die Holzpantinen, die zwar am Spann scheuerten, aber die Füße wenigstens etwas warm hielten. Im Dezember bestimmte Signor Caccavo jeden Morgen einen Schüler, der das Feuer im Herd anfachen und hüten musste, damit niemand beim Lernen zu sehr fror. Kurz nach Neujahr rutschte Sergio auf einer zugefrorenen Pfütze auf der Piazza aus und brach sich den linken Arm. Ein paar Tage erschien er nicht zum Unterricht, doch nach einer Woche saß er mit dem Arm in der Schlinge wieder am Küchentisch von Signor Caccavo. Denn auch für die Zeit, in der ein Schüler krank war, musste Schulgeld gezahlt werden. So hatte Sergios Mutter ihn wieder losgeschickt, als es ihm etwas besser ging. Das jedenfalls erzählte er Pietro und Serafina, während Francesco schweigend am Herd stand und ein neues Holzscheit ins Feuer legte. Am ersten März ließ Signor Caccavo den Ofen kalt. Seiner Überzeugung nach brauchte man im Frühling nicht mehr heizen, selbst wenn es morgens noch genauso kalt war wie die Tage zuvor. Francesco kürzte die Finger seiner alten Handschuhe, die ihm längst zu klein geworden waren. So konnte er sie in der klammen Küche anbehalten und gleichzeitig mit dem Griffel schreiben. Nach den Ostertagen ging er wieder ohne Handschuhe zum Unterricht, und auch die Holzpantinen hatte er zurück unter das Bett geworfen und lief barfuß durch das Dorf. In diesem Jahr hatten die Schafe drei Lämmer geboren. Im Juni verwandelte die Hitze die Küche in einen Glutofen. Der Schweiß rann Signor Caccavo den kahlen Schädel hinunter und färbte seinen makellosen Kragen dunkel. Mitte Juli schloss Signor Caccavo die Schule für zwei Monate und entließ Francesco und die anderen Schüler in die Sommerferien.
Als sich am ersten September alle wieder bei Signor Caccavo einfanden, ließ dieser die Lesefibeln im Regal stehen und verteilte den Katechismus.
»Dies ist der große Katechismus, den unser verehrter Papst Pius X. neu herausgegeben hat,« sagte Signor Caccavo, wobei er die Spitzen seines Schnauzbartes nach oben zwirbelte. »In seinem Vorwort empfiehlt er ihn für den Schulunterricht. In Rom ist er bereits Pflichtlektüre, und ich werde selbstverständlich dem Wort des Heiligen Vaters folgen, wie es sich gehört. Francesco, liest du bitte den Anfang vor.«
Während Signor Caccavo sich am Kopf des Tisches auf seinen Stuhl setzte, begann Francesco: »Wer ist ein wahrer Christ? Ein wahrer Christ ist der, der getauft ist. Er glaubt und bekennt sich zur christlichen Lehre und leistet den legitimen Hirten der Kirche Gehorsam. Ist es notwendig, die Lehre Jesu Christi zur lernen? Natürlich ist es notwendig, die Lehre, die Jesus Christus uns gebracht hat, zu lernen. Diejenigen, welche dieser Pflicht nicht nachkommen, machen sich eines schweren Vergehens schuldig. Sind Eltern verpflichtet, ihre Kinder zum Katechismus-Unterricht zu schicken? Eltern sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder die christliche Lehre studieren. Sie machten sich schuldig vor Gott, wenn sie diese Pflicht vernachlässigen.«
Francesco verstummte. Da stand es. Mamma und Papà hätten sich versündigt, wenn sie ihn nicht zu Signor Caccavo geschickt hätten. Er hatte sie mit seinem Wunsch, Mönch zu werden, vor einer schrecklichen Sünde bewahrt. Also war es richtig gewesen. Und Padre Carmelo war bestimmt nicht zufällig zu ihnen gekommen. Das war ein Zeichen Gottes.
»Sehr schön, Francesco«, sagte Signor Caccavo. »Lernt diese Sätze bis morgen auswendig.«
Nun lasen sie täglich im Katechismus. Danach arbeiteten sie die Bibel durch, erst das Alte, dann das Neue Testament, im Anschluss lasen sie unzählige Heiligenviten, denn es gab weit mehr Heilige als Franz und Donatus. Die Märtyrergeschichten fesselten Francesco besonders. Bald kannte er sie auswendig. Er spürte die Pfeile, die den Heiligen Sebastian durchbohrt hatten, in der eigenen Brust, spürte, wie das rotglühende Rost des Heiligen Laurentius in sein Fleisch brannte, bewunderte den Apostel Andreas, der noch an diesem x-förmigen Kreuz hängend zwei Tage dem Volk gepredigt hatte, litt auf dem Rad mit Katharina von Alexandrien, gegen deren Überzeugungskraft selbst fünfzig Weise nicht ankamen. Fieberheiß wurde ihm, wenn er an das siedende Öl dachte, in das man den heiligen Vitus geworfen hatte, und an den brennenden Ofen, aus dem der heilige Gennaro unversehrt herausgetreten war. Bei jeder dieser Geschichten stand ihm der Schweiß auf der Stirn, litt er am eigenen Leib die Qualen der Männer und Frauen. Doch er bewunderte auch das Geschick des heiligen Antonius von Padua für verlorene Dinge, der wegen seiner vorbildlichen Lebensführung und seiner geschickten Reden ›der Hammer der Ketzer‹ genannt wurde. Francesco beneidete die heilige Klara, die, obwohl sie doch nur eine Frau war, mit der Monstranz in der Hand den Sarazenen entgegengetreten und keinen Schritt gewichen war. Wieder und wieder las er diese Geschichten.
Dann kam der Tag, an dem sie ein anderes Buch begannen.
»Ich habe euch etwas Neues mitgebracht«, sagte Signor Caccavo. »Dieses Buch trägt den Titel Briefe und Ekstasen der Dienerin Gottes Gemma Galgani, Jungfrau von Lucca.«
Francesco hob den Kopf. Ein Buch von einer Frau?
»Hierin«, erklärte Signor Caccavo, während er vor dem Tisch auf und ab ging und in dem Buch blätterte, »sind die Briefe abgedruckt, die Gemma Galgani ihrem Beichtvater Padre Germano geschrieben hat. Der hat die Schriftstücke gesammelt und nun kurz nach ihrem Tod veröffentlicht. In ihren Briefen berichtet sie von himmlischen Erscheinungen, die sie erlebt und wie der Herr sie von schweren Krankheiten geheilt hat.«
Francescos Hände wurden schwitzig. Er kannte diese Gemma Galgani nicht, und doch klang ihr Name so vertraut. Die Dienerin Gottes.
»Gemma wurde von Visionen geplagt, und sie beschloss, Braut Christi zu werden«, erzählte Signor Caccavo. »Ihr sehnlichster Wunsch war es, in ein Kloster einzutreten, aber sie wurde immer wieder krank und musste das Bett hüten. Da erschienen ihr, als sie in den langen Stunden im Gebet versunken war, eines Tages der heilige Gabriel von der Schmerzenden Jungfrau und die Jungfrau Maria höchstselbst.«
Francesco sah mit einem Mal eine Madonna mit einem blauen Umhang und einem Schleier vor sich. Deutlich spiegelte sie sich in den blanken Türen des Ofens, das Muster ihres Schleiers war wie das der Gardine. Sie stand vor dem Fenster, umrahmt von einem Lichterkranz, und breitete die Arme aus wie eine Mutter.
»Gemma war verwirrt von dieser Ehre und beschämt von der eigenen Untätigkeit, zu der ihre Krankheit sie zwang. Deshalb wandte sie sich an Padre Germano.« Signor Caccavo musterte Francesco.
Francescos Bauch verkrampfte sich.
»Ich lese euch nun ein Stück vor. Sie schrieb: Mein guter Vater, ich muss Euch etwas mitteilen. Seit etwa acht Tagen spüre ich auf der Seite des Herzens im Leib ein gar merkwürdiges Feuer brennen, das ich nicht begreifen kann.«
In Francesco zog es. Seine linke Seite tat weh. »Was ist mit ihr passiert?«, platzte er heraus, und der Schmerz verschwand.