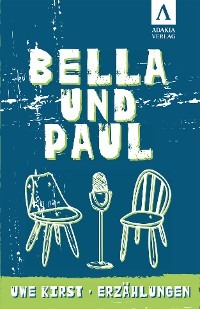Kitabı oku: «Bella und Paul», sayfa 2
»Sehr gern«, entgegnete er, und erzählte von der Szene mit ihrem Vater an diesem Kamin. »Allerdings weiß ich nicht mehr, wie die Marke hieß, die wir im Glas hatten. Der war für mich das Beste, was ich bis dahin kannte.«
»Das bekommen wir vielleicht heraus.« Sie winkte einem Kellner und erklärte ihm die Geschichte, worauf er in den Nebenraum verschwand. »Er fragt seine Chefin, die hier schon gelernt hat. Sicher kennt sie die üblichen Marken ihres Kellers.«
Die Erwähnte kam und trug eine Flasche mit sich, fast leer und erkennbar alt. »Ich habe noch etwas gefunden von dem, was wir in der damaligen Zeit im Keller hatten. Diese Destille gibt es leider nicht mehr. Das könnte aber noch die Sorte sein, an die Sie sich erinnern.«
Sie freute sich merklich über seine Nachfrage: »Wir haben heutzutage immer seltener Gäste, die sich für Derlei interessieren.«
Sie reichte ihm die Flasche und aufmerksam betrachtete er das Etikett. Es hatte Patina angesetzt und nicht jedes Wort war leicht zu entziffern, nicht zuletzt wegen der handschriftlichen Signaturen darauf. Und da kam seine Erinnerung: Wenn er wolle, dürfe er seine Initialen auf das Etikett setzen. Es sei so ein Usus bei Ehrengästen. Das hatte John Forbes damals gesagt, und er hatte es getan, mit seinem schwarzen Mont Blanc, geschmeichelt von diesem Angebot: »PLA«. Sogar mit dem zweiten Vornamen, den er verabscheute, der im Pass verewigt war, sich für Initialen aber recht gut eignete, damit ein »PA« nicht wie die Abkürzung für »Personalausweis« wirkte.
Er zeigte die Flasche Letitia Forbes und wandte sie dann zum Licht, ob auf diesem Etikett gar ein prominentes Kürzel zu finden war und hielt jäh inne: PLA, fast verblasst. Das waren seine Initialen! Kein Zweifel – es war sein Signum!
Das raubte ihm die Fassung, aber warum sollten in einem Land, in welchem es zur Normalität gehörte, dass PCs auf dreihundertjährigen Tischen standen, nicht halbgefüllte Whiskyflaschen zwanzig Jahre überdauern? Das Licht begann für ihn zu schimmern und etwas berührte sein Inneres. Er reichte die Flasche der Kellnerin, die ihnen behutsam den Rest eingoss, vorsichtig abmessend, die letzten Tropfen eines Getränks, das es nie mehr geben würde.
Er nahm das birnenförmige, dünnwandige Gebilde in die Hand und brachte die Flüssigkeit zum Schwingen, so dass der alte Stoff durch das Glas hindurch seine Handfläche liebkoste. Die breiten Schlieren verliefen sich und das Aroma erreichte seine Nase. Er hob den Kelch und im Geiste tauchte das warme Lächeln von John Forbes auf. Der Blick seiner Gastgeberin ruhte auf ihm.
»Letitia«, sagte er.
Ein wenig vom goldenen Glanz, der in ihren Gläsern gefangen war, schimmerte in ihren Augen.
Bella und Paul
Paul
Sie glauben vielleicht, so etwas passiert Ihnen nicht? Nun ja, ich habe das auch einmal gedacht.
Es begann vor Jahren mit der bitteren Erkenntnis, dass das Leben sich zu einer Abfolge von Routinen mit Rollenspielcharakter entwickelt hatte. Konkret: mein Leben. Als das eines Mannes, der seinen Pflichten folgt, selbst auferlegt, unmerklich mit Zusatzfeatures versehen, was zu einer Funktionalität führte, die an Vielfalt nicht zu überbieten war. Nur, dass im Inneren, dieses einstmals kraftvolle und lebendige Lodern zum Flämmchen wurde, stets bemüht, den erforderlichen Aktionen die dafür nötige Energie zu liefern. Es tänzelte förmlich in einem Hohlraum herum.
Ein Roboter in Menschengestalt, fähig, mit richtigen menschlichen Wesen umzugehen, ohne sie zu verletzen. Sozusagen ein Vorläufer der neuesten Robotergeneration, wie sie heute mit Human-Kollegen zusammen am Band steht.
Wohlgemerkt, was da aus mir geworden war, hatte ich zugelassen. Ich selbst. Im zumindest theoretischen Bewusstsein meiner Souveränität als Vertreter der menschlichen Rasse. Es ist ja leicht, es anderen in die Schuhe zu schieben, wenn es nicht gelungen ist, sich zu behaupten.
Denn wir sind für uns selbst verantwortlich. So steht es auch in Ratgebern, klugen Büchern noch klügerer Leute, die letztlich alle steinreich und galaktisch glücklich sein müssten, weil sie doch so viel Richtiges wissen. Aber – selbst der beste Chirurg kann sich den Blinddarm nicht höchstpersönlich herausnehmen – spätestens bei der Vollnarkose endet der Versuch.
Ich gehöre zu denen, die in der Welt herumreisen und Reden halten zu Themen der Wissenschaft – und des Lebens. Als eines Tages jemand in einem Seminar, das ich leitete, nach einer Stunde aufstand und sagte: »Nun wird es aber Zeit, dass ich nach fünfzehn Jahren endlich erfahre, wie ich erfolgreich sein kann! Fangen Sie endlich damit an! Ausschließlich dafür bin ich hier!« wäre das kein sonderbares Verhalten, wenn, ja wenn, diese Dame sich nicht zu Beginn der Veranstaltung als »Erfolgs-Trainerin« vorgestellt hätte. Wie weit muss jemand von sich selbst entfernt sein, um derartige Statements vollen Ernstes und in aller Öffentlichkeit abzugeben? Das war mir lange ein Rätsel – bis heute.
»Was machst du hier eigentlich?«
Mit dieser launigen, jedoch durchaus sinnvollen Frage an mich in eigener Person startete der Ablösungsprozess von einem Leben, das ich nicht mehr verstand, aber schon viele Jahre zelebrierte. Ebenso von einer Beziehung, die nur insofern eine war, als dass es einen speziell definierten Bezug zwischen diesen zwei Personen gab. Begriffe, wie ›erfüllt‹, oder ›glücklich‹ kamen in der Gebrauchsanweisung zu diesem Beieinander nicht vor.
Eine Beziehung, in welcher mein Mann-Sein nur darin bestand, gendergerechte Kleidung zu tragen, nicht etwa in der orgiastischen Zweisamkeit lebender Wesen – meist unterschiedlichen Geschlechts. Das ›meist‹ ist der Tatsache geschuldet, dass durchaus andere Konstellationen existieren, die Lustgewinn erlauben, falls, ja, falls, es etwas von dem gibt, was gemeinhin als sexuelle Anziehungskraft beschrieben wird.
Das alles hatte zumindest dazu geführt, dass Zweifel an der Sinnhaftigkeit meiner Daseinsinterpretation aufkeimte, aus dem Dunkel hervorschimmerte und schließlich ein Gewächs hervorbrachte, das solche Schatten warf, dass sogar die pralle Sonne mein Gehirn nicht garkochen konnte, denn etwas in der Art muss es gewesen sein, was mich derartig blind hatte werden lassen.
Nun hatte ich gesiegt, über mich selbst, meine Illusionen, die Trägheit der Usancen meines Alltags und über die heimtückische Angst vor der Veränderung. Ich war allein! Endlich! Und: Es war elend. Nicht, dass es mir an etwas gemangelt hätte, an Materiellem oder an Bequemlichkeit.
Wenn Sie ein Leben geführt haben, in dem Sie vom Kochen über das Dirigieren der Handwerker bis zur Bespaßung der Beteiligten für alles den Hut aufhatten, mangelt es Ihnen nicht an Fertigkeiten und Fähigkeiten, einen Haushalt zu führen, anfallende Arbeiten zu verrichten oder dafür zu sorgen, dass Sie selbst nicht wie ein abgerissener Haderlump durch die Gegend laufen.
Ich beherrschte das seit jungen Jahren und erinnere mich, dass ich, einst, während einer Solo-Phase, am Weihnachtstag eine komplette Gans gebraten hatte, samt Kloß und Blaukraut. Nur für mich, obwohl es dann doch eine einzige Keule war, die ich verzehren konnte.
Andere beweisen sich, dass sie überlebensfähig sind, indem sie drei Tage ohne zivilisierte Nahrung durch die Wälder und um Seen streifen. Da ist mir die Gänsevariante als Beleg egozentrierter Selbstachtung deutlich ansprechender.
Nein, es war nicht der Mangel an Komfort, der mir die Einsamkeit so schwer werden ließ, es war die eingeschränkte Möglichkeit zu teilen, Freude, Lachen und Zärtlichkeit. Dieses »Schau, wie schön das aussieht!«, »Riechst du diesen wunderbaren Duft!« Oder schlicht das Streicheln einer Hand – ohne Worte; der kleine Kuss im Vorbeigehen, die Vorfreude, gemeinsam zu erleben – was immer es sein mochte.
Es war genauso wenig die Abwesenheit von Alltagsfähigkeiten, wie Putzen, eine Waschmaschine bedienen, Bügeln oder Essen zubereiten. Es war eher die Manie, all dieses in einer inneren Verbindung mit der Person zu verrichten, deren wohlwollende Wahrnehmung selbst Profanem, wie dem Abwaschen von Geschirr, emotionale Substanz verlieh. So ist das Kochen und die eigene Ernährung zu sichern, als kulinarisches Talent etwas Löbliches. Aber was macht es mit einem Menschen, wenn dieser es liebt, große Menüs zu komponieren und perfekt zuzubereiten, ihm jedoch die Gelegenheiten dafür fehlen? Personen, die das zu schätzen wissen und beglückt in sensorischen Sinfonien schwelgen, die er, völlig allein, erschaffen und aufgeführt hat, sind rar, sobald Alleinsein zur Norm aufgestiegen ist.
In heißen Phasen hatte ich blecheweise gebacken und danach handgefertigte Schilder in die Fenster gestellt mit der Aufschrift: »Kuchen!«, weil es Nachbarn gab, die mich mochten und die sich dann viele Tage darüber unterhielten, was der nette Mann von nebenan doch für ein Backtalent sei und dass man von ihm sogar Besseres gegessen hätte, als von der meisterlich backenden Schwiegermutter. Das war der Lohn, nach dem ich gierte: Wahrgenommen und geliebt zu werden, voller Stolz zu sein, auf etwas Eigenes, das ich exzellent beherrschte.
Alleinsein ist ein wichtiges Privileg, das uns Stärke und Souveränität erhält und für weitere Aspekte unserer Befindlichkeit vonnöten ist. Einsamkeit ist dessen tödliche Schwester.
Es gibt dann keine Resonanz mehr auf das, was wir tun und lassen. Es ist der Welt gleichgültig – wie letztlich selbst uns: »Was macht es schon aus, ob ich sieben oder neun Uhr abends zu Hause bin, an der Autobahn esse oder daheim? Wo immer ich bin, ist Leere.«
Viele Menschen kennen diesen Gedanken nur zu genau; es sind weit mehr, als es zugeben.
Der ganze Kampf ums Überleben als Einsamer besteht darin, auf sich einzureden, um eines Tages davon überzeugt zu sein, dass es Spaß macht, allein zu verreisen, solo in einem Restaurant zu sitzen oder ohne Seelenfreund ein Kunstwerk zu betrachten.
Bella
»Ich habe alles hinter mir gelassen!«
Ich sitze an meinem Schreibtisch, der eine Glasplatte hat und alles ist geordnet. So, wie ich das am liebsten habe: Hell, freundlich, warm, aber mit Übersicht. Das Beste daran ist, dass niemand mehr, absolut niemand, an dieser Ordnung etwas ändern wird – außer mir selbst. Ich kann vom Einkaufen kommen, vom Frisör, von einer Reise und kein Mensch wird auch nur einen Millimeter verrückt haben, was ich mit System oder spontan genau so und nicht anders platziert hatte.
Ich habe meine Rüschenbluse angezogen, die weiße. Für mich. Dazu die schlichte, kurze Kette. Den nachtblauen Businessrock. So etwas wie eine Uniform, meine Distanz gegen gedankliche Übergriffe. Selbst zu Hause, am Telefon gibt mir das Stärke. Vor mir liegt ein Buch. Ein Paperblank. Das hat Schnörkel, mit Gold, und die Seiten sind cremeweiß. Es ist einfach schön. Auf die erste habe ich geschrieben: »Mein Leben ab jetzt!«
Es gibt so viele faszinierende Bücher, in denen steht, dass Ziele das Wichtigste sind; dass wir sie artikulieren, aussprechen und niederschreiben sollen. Genau das tue ich jetzt.
»Ein Leben in Fülle und Reichtum.«
Das habe ich hineingeschrieben, in mein Buch. Gar nicht mal im Sinne von »viel Geld«. Aber, klar, natürlich auch. Nur nicht ausschließlich. Es kommt mir so billig vor, sich Geld zu wünschen, es als einziges Maß von Erfolg zu interpretieren, so grob materialistisch. In der Vergangenheit war es ja immer da, das Geld. Möglicherweise ist es mir materiell noch nie richtig schlecht gegangen, so dass ich es fast verschämt negiere. Dabei war mein Zuhause als jüngstes von sieben Kindern eher bescheiden. Nun, wo fast keins mehr zur Verfügung steht, drücken mich die schmerzlichen Konsequenzen seiner Abwesenheit.
Nur hat Geld mein bisheriges Leben lang niemals dazu geführt, glücklich zu sein. Er hatte es verdient, mein Mann, und nach Hause gebracht, regelmäßig, aber es hat nicht das Glück finanziert und nicht das Lachen. Es war die Rechtfertigung für ein engherziges, eingekapseltes Leben mit einem feindseligen Lächeln nach außen, immer darauf bedacht, dass es unter der Wahrnehmungsschwelle der Anderen blieb.
»Na, du hast es doch gut!«
Dieses langgezogene »gut«, wie mir das zuwider war! Zumal die Blicke dabei von flachem Desinteresse über Neid bis hin zu deutlichem Hass alles enthielten, nur nichts, das gut für mich war. Auch hinter blinden Spiegeln kann die Hölle lauern. »Warum denn gerade Die, wo Die doch nur…«
Das Geld war damals da und das Haus und die Reputation, aber es hat nicht helfen können, die sterbende Liebe zu erhalten. Es heilte nicht, es kaschierte nur, machte abhängig, war der Ersatz für ein Leben mit Emotionen, spontanen Aktionen, lautem Lachen. Und wenn ich tanzen, ein Konzert besuchen wollte, Leute einladen, dann erstarrte der, dessen Geld, das doch alles erlaubt hätte, von innen heraus.
Es tat mir so leid, diese Scheu zu erleben, ein gestandener Mann, intelligent, gutaussehend und inwendig ein angstvolles Bündel von Mikadostäben einer offenbar verlorenen Seele; jede Veränderung führte zu unkontrollierten Folgen im mühsam geschaffenen Gleichgewicht. Das Leben als Gefahr und die Wandlung als Bedrohung zu sehen; den Schein aufzupolieren, um sich verbergen zu können. Ein Fassadenmensch, der sein inneres Entsetzen wegtrank, immer öfter. Mit allem, was dazugehört.
Die schönen Gegenstände, die ich so gern drapierte, die liebevollen Freuden in Farbe und Form, ignoriert, gar verlacht. Das Buhlen um die Anerkennung meines Seins, meiner Vielfalt, meiner Auch-Bedeutung, war so ohne Wirkung auf diesen Mann und seinen Tag. Das Leben versickerte im Einerlei der Routinen und Rituale, deren Sinn nur in ihrer eigenen Existenz bestand.
Paul
»Südafrika! Im nächsten Sommer!« Ich scrolle die Endlosseite des Reiseveranstalters vor und zurück.
Mit dem Auto bis zu den Weinanbaugebieten. Die ewige Sehnsucht nach diesem Kontinent, die mir in der Kindheit schon wundersame Träume beschert hatte. Meist dann, wenn ich Bücher las, die mit Afrika zu tun hatten. Es waren die Tiere und die Weite, die mich aus den Zeilen heraus berührten. Neun Jahre alt, elf, auch später noch. Sehnsucht nach einem Ort, an dem ich gerade nicht bin. Weg vom Jetzt und Heute, nicht, weil es mir als Junge in diesem Alter schlecht ging. Es war das tiefe Gefühl der Neugier, eher nicht auf ›Informationen‹, nein, auf etwas, das zu schauen, zu riechen und zu hören war.
Wann immer ich meine Bücher aufschlug, wehte mich das an, was ich darin las. Mehr als das, es waren die Bilder, die sich formten in mir.
Ist diese Reise wirklich eine gute Idee? Nach so vielen Jahren, jetzt, wo ich allein bin, niemanden zum Teilen habe? Der Gedanke, genau das zu tun, überrascht mich, denn bislang kamen solche Ideen nicht einmal bis zur Tastatur. Das Alleinsein fraß diese Impulse auf.
Ist das das Signal, jetzt, in diesem Augenblick, dafür, dass die Zeit der inneren Zerfleischung vorüber ist? Dass ich bereit bin, wieder zu genießen, und zwar ohne Trauer selbst allein?
Ich sehe mich am Tisch eines Restaurants. Die Speisekarte ist studiert, das Essen bestellt. Was tun, bis es kommt? Nochmals die Karte studieren, auf dem Handy Nachrichten ansehen, ein Spiel machen, Tetrisvarianten gibt es ungezählte, oder eine Tageszeitung lesen? Sogar, sobald das Essen gekommen ist, links, leicht versetzt nach oben, neben dem Teller. Aber meist gibt es keine Zeitung. Falls ja, oft eine überregionale, in Hotelrestaurants, mit Seiten zum Zeltbauen so groß. Zuweilen altmodisch eingespannt in ein hölzernes Konstrukt, das man an einen Haken hängt, der neben der Garderobe im Lokal angebracht ist. Damit die Leute die Zeitung nicht mitnehmen. Nichts ist so ungeeignet zum Zeitunglesen, wie eine solche Vorrichtung, die den Bund der Blätter einklemmt, Textteile dadurch unlesbar macht, sperrig ist und schwer. Man braucht den ganzen Tisch dafür, stößt ständig irgendwo an. Während des Essens – unmöglich. Einmal hatte ich damit ein Wasserglas umgeworfen.
Lieber jemandem in die Augen schauen, reden, Gedanken austauschen, zusammengehören, die Hände der Frau ergreifen, die mir gegenüber sitzt, streichelnd die Gemeinsamkeit aufnehmen. Die Speise probieren vom anderen Teller, aufgeteilt bestellen, so dass man zwei Gerichte schmecken kann. Bereden, was als Nächstes kommt, das es anzuschauen lohnt oder doch direkt ins Hotel, pausieren, im Liegen lesen, sich berühren, Energie speichern für das Leben.
Inzwischen kann ich das Alleinsein am Tisch und das Essen genießen, eine Tour planen, die mir Sachen oder Orte zeigt, Landschaften. Nur passiert das jetzt eher zügig, so, wie das Abarbeiten eines Pflichtprogramms, Eindrücke austauschend im Selbstgespräch. Der Verlockung widerstehen, irgendjemanden anzurufen. Ja, das geht.
Werde ich dann eines Tages einer von denen sein, der fremden Leuten wortreich erzählt, was er gesehen und erlebt hat, fragend, ob man denn schon dieses oder jenes besucht hätte? Permanent das umfassende Wissen preisgebend, das niemand braucht oder mit mir teilen möchte?
Eine Freundin hatte mich einmal damit trösten wollen, dass ich letztlich, wann immer mir es einfiele, mein Bad putzen könne – selbst nachts gegen drei. Sicher ein Traum, den jeder von uns zwingend hat.
Wer weiß. Alles besser, als die platten Gedanken eines jemand zu ertragen, der sich unerträglich parlierend über tausend Sachen wortreich ausbreitet, sich darin verliert, selbstgerecht wertend, Menschen stets das Negative unterstellt. Der nur sich sieht und die Wärme gar nicht gewahr wird, die meine Hände für ihn haben.
Bella
»Ich will jeden Tag mindestens einmal laut lachen!«
Das war der zweite Satz in meinem Paperblank. Ich war zunächst erschrocken über ihn, denn ich war der Frohsinn in Person; vor vielen Jahren, als die Ehe mir ein Weg zu sein schien, frei zu werden von den Zwängen, jüngstes Kind zu sein. Niemals brauchte ich einen Grund für Fröhlichkeit. Dann dieser Satz, als müssten graue Schleier zerrissen werden, in die ich mich selbst eingewickelt hatte.
»Lerne, dich wieder wahrzunehmen, dich nicht nur zu verhalten«.
Ich hätte diesbezüglich manches zu erzählen, doch wem? Die glatte Front des Nichtverstehens meines Handelns begegnet mir täglich im Ort in den Gesichtern. Diese Wut darüber, selbst nichts zu verändern. Diese Ahnung davon, wie endlich doch alles ist. »Wie kann die das nur tun, wenn ich es auch nicht mache!« Nur Männerblicke haben unvermutet einen neuen Ausdruck von Interesse, teilweise rücksichtslos direkt. Wie wohltuend es wäre, Empathie zu erkennen, statt eines in Gang gekommenen Bewertungsroulettes durch ewig unzufriedene und selbstgerechte Nachbarn und Bekannte – nur Marionetten ihres armen Lebens.
Ich hatte jetzt eine Menge zu entscheiden für mich. Nicht mehr beeinflusst durch einen fremden Willen, doch beschränkt durch mein eigenes Wissen, die mangelnde Erfahrung, seine Sperre, wann immer ich etwas dazulernen wollte. Eine Anstellung zu bekommen ist nicht leicht, waren die letzten Jahre doch Pflege und Betreuung gewidmet, weit entfernt vom Beruf. Für Alternativen fehlt mir die Übersicht; und etwas Angst ist dabei.
Meine bitter gewonnene Freiheit hatte ich bisher nutzbringend investiert, das glaube ich zumindest. Hatte Events besucht, Bücher studiert und den alten Renault gegen ein knallrotes Auto eingetauscht. Rot, offen, spritzig.
Mensch, Bella, war das kühn.
Ich wollte endlich die sein, die ich bin, mich selbst wahrnehmen. Ohne zu fragen, in meinem eigenen, unvernünftigen Auto sitzen. Zu Veranstaltungen fahren, wohin, wann und wie lange ich das will. Die blöden Blicke muffiger Nachbarn inklusive.
Wie schnell ist doch die Freundlichkeit vorbei, die vorgebliche Empathie, sobald du aus der Reihe tanzt, den Pfad verlässt, den andre Leute dir zugedacht haben. Etwas zustande bringst, das sich keiner sonst traut. Vergessen sind die guten Taten in der Gemeinde, das Engagement bei Festen, bei Vereinen. Die tausendmal kaum mehr geduldig ertragenen Klagen über die Beziehungskatastrophen von Monika, die immer wieder auf die gleichen Kerle reinfällt. Veronika, die sich ständig zurückgesetzt vorkommt in der Firma, mit ihrem verstörten Ehemann, der mir mit seinem Glotzen bis heute an die Wäsche geht. Was hab ich mich eingesetzt für die Nachbarn, bei der Gemeinde oder damals beim Landrat für deren Interessen.
»Wie kannst du dich nur scheiden lassen!«
Das steht jetzt in Leuchtschrift über jedem Haus, in jedem Gesicht. Ich atme sie ein, diese Missbilligung, nur, weil ich das tat, was für mich richtig war. Weil ich mir erlaubt habe, mich zu befreien von einem unerfüllten Leben, über das ich niemals geklagt hatte, aber von dem jeder sehen konnte, wie leidvoll es für mich ist. Wenn ich eines weiß, dann ist es das: Ich werde sicher nicht nochmals heiraten!
Fremde Leute, ja, die zeigen Interesse, nehmen mich ganz anders wahr. Beurteilen nicht mein Gestern, sondern was ich gerade sage, wie ich heute handle; ich habe das erste Mal seit Jahren wieder das Gefühl, dass mich jemand ansieht und dabei mich meint.
Mich! Jetzt! Hier!
Nicht das Bild, das ich abzugeben habe nach Ansicht von Leuten, zu deren Leben ich marginal gehört habe, wie eine Wandfarbe oder ein Möbel, an dem man täglich vorbeigeht.
Ich war vor einiger Zeit in einem Vortrag; es ging um Chancen für die Zukunft, um Visionen im Kontext heutiger Gegebenheiten, um Barrieren in einer modernen Gesellschaft. Der Mann da vorn hat mir getaugt. Bildhaft, stringent, unterhaltend dabei. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass ihm nicht egal ist, was jeder mit seinen Gedanken und Worten anfängt. Und ich hatte mich seit langem wieder verstanden gefühlt, ernst genommen, mit Respekt behandelt. Auf eine Frage von mir, zugegeben, eine etwas ungeschickte, wurde ernsthaft geantwortet.
»Der meint tatsächlich mich!«
Das war mein Gefühl und das hatte ich lange vermisst. Zumindest in den letzten Jahren. In der Pause dann war ich genau darauf bedacht, zuzuhören, was er anderen sagt, geduldig, aufmerksam, nie von oben herab, wie abwegig die Frage sein mochte. Das hat mich beeindruckt. Ich war unversehens wieder jemand.
Ich rühre gedankenversunken in meinem Tee. In einem Tropfen davon, auf meiner gläsernen Schreibtischplatte, bricht sich das Grün der Bäume vor dem Fenster. Ich will so viele Dinge lernen, herausfinden, ob meine Gedanken einen Sinn ergeben, für meine Zukunft, über all das sprechen was ich entscheiden werde in den nächsten Wochen. Wie gut es wäre, darüber unbefangen zu reden, wenn mir jemand zuhörte, der mich nicht sofort in ein Muster einordnet, mir nicht innerhalb von drei Minuten Antworten von der Stange liefert.
»Falls Sie noch etwas loswerden möchten, oder eine Frage haben – meine Daten haben Sie!« Das war ein Satz in seiner Rede, bevor es ans Verabschieden ging und der Veranstalter eine lange Liste von Folgeterminen umständlich präsentierte. Ich hatte ihm daraufhin schon einmal eine juristische Frage gemailt und überraschenderweise hatte er mich sogar zurückgerufen. Seine Stimme war auch am Telefon sehr angenehm und es kam mir vor, als wüsste er, wer ich sei.
Genau das mache ich.
Ich werde ihn auch diesmal fragen.
Paul
Ping! Eine E-Mail. Schon haben mich die Bedürfnisse anderer wieder erreicht.
Diese Reise – mag sein. Muss ich ja jetzt nicht festlegen. Ich lese die Nachricht und freue mich darüber, dass da jemand meine Expertise schätzt, Fragen stellt, wie sich zu verhalten, wie zu entscheiden sinnvoll ist.
Antworten darauf gebe ich gern. Die Menschen sind mir wichtig, sie vertrauen mir und scheuen sich nicht, ihr Nichtwissen zu offenbaren. Sie fürchten keinen missbilligenden Blick, kein überhebliches Von-oben-herab-Getue. Sie fühlen sich in ihrem Wert nicht abhängig vom Grad ihrer Kenntnisse und Erfahrungen. Und – sie vertrauen sich mir an, genau mir; sie öffnen sich ohne Arg und ohne Sorge, verletzt zu werden. Ein gutes Gefühl.
Diese Nachricht ist von einer Frau, die ich bei einem meiner Vorträge im Saal hatte sitzen sehen. Ich kann mich erinnern: schlank, mit wachem Blick, lebendig, auffallend durch ihre gescheiten Worte.
Es ist nicht die erste Frage, die sie schriftlich stellt und vor einiger Zeit hatte ich, weil es unkomplizierter war, sogar mit ihr telefoniert und in groben Zügen ein Szenario entwickelt, das mir passend für sie schien. Die Telefonstimme hatte mich überrascht in ihrer Frische und Präsenz.
Nun, diesmal wirkte der fachliche Gegenstand heikel. Nicht, dass ich mich scheute, klare Positionen niederzuschreiben. Es ist eher das vernetzte Thema, das ohne Dialog nicht deutlich umrissen werden kann. Manchmal bin ich freilich zu bequem, ausführlich und mit Wenn und Aber ellenlange Texte zu verfassen. Doch hier stören mich die Vertraulichkeit des Gegenstandes und der Gedanke, die eigenen, vermutlich gar nicht perfekten Auslassungen ins Blaue zu schicken.
»Vielen Dank für Ihr Vertrauen und sehr gern gebe ich Ihnen meine Gedanken dazu preis, aber dieses Mal schlage ich vor, das bei einem Kaffee zu tun, hier in der Stadt, in der ich wohne.« So oder ähnlich fand ich Worte.
Erstaunlich, denke ich, du nimmst die Unbequemlichkeit in Kauf, das Haus zu verlassen, in irgendeinem Café, lärmumgeben, jemandem zuzuhören? Kaffee und Wasser vermutlich mit deinem Geld bezahlend, anstatt welches zu verdienen?
Das passt zu meinem Reisegedanken. Ist die Zeit des Nachtrauerns gewohnter Zweisamkeit tatsächlich vorüber? Beginne ich endlich, jetzt für mich selbst und zum eigenen Nutzen zu entscheiden und zu handeln? Verlasse ich soeben meine unsichtbare Klausur, um ein ›normaler‹ Mensch zu sein? Es wird Zeit, nach fast zwei Jahren. Das Gefühl, aus einem Raum hinauszugehen, die Türen offen, aber hinter mir, zurückzulassen, verlockt mich, stolz zu sein.
Ich bin plötzlich größer und stärker und das verschmitzte Lächeln, das man von mir kannte, ist zurückgekehrt, obwohl kein Spiegel mir das zeigt.
Bella
Ich habe einen Termin mit ihm, dem bekannten Referenten, auf einen Kaffee. Weil meine Frage sich nicht fürs Telefon eignet. Da sollte er mal hören, was mir Monika von ihrem Job bei der Stadt alles am Telefon erzählt hatte. Aber ich freue mich. Ich bin sogar ein Gespräch wert. Wie lange gab es das nicht, für wie lange war ich nur ›die Frau von …‹ oder noch früher ›die kleine Schwester von …‹.
Bin ich so empfindlich geworden, dass ich das im Nachhinein so deutlich wahrnehme?
Es ist erstaunlich, wie enge Begrenzungen, gerechterweise goldene Fesseln, uns einengen und trotz alledem die Täuschung vermitteln, wir hätten einen Spielraum? Wer seinen Käfig für die Welt hält, kann sich auch einbilden, dass sie das sei. Wie die Leute im Osten, die mir mal gesagt haben, dieser Trabant sei genau das Auto, das sie gut finden. Unsere Nachbarn hatten sie zu Besuch. Heute, nachdem wir mehr wissen, frage ich mich, wie sie zu der Erlaubnis gekommen waren, überhaupt hierher fahren zu dürfen.
Der Zeitpunkt für meine Reise zum Referenten war etwas ungünstig. Da gab es einen Termin mit einem Professor, der mir weiterhelfen könnte. Aber so sicher war ich seiner Motive nicht. Ich merke jetzt erst, wie wenig ich über diese Welt weiß, in die ich mich gerade hineinbewege, die Geschäftswelt. Es ist schwierig für mich, das Interesse an der Frau vom Interesse an deren fachlicher Kompetenz zu unterscheiden. Ist es Masche oder Geschäftssinn? Bin ich wirklich so blöd, dass ich da Zweifel habe? Wohl doch, denn sonst fiele es mir leichter. Ich will bewundert werden, weil ich etwas kann, nicht weil ich ›aussehe‹!
Neulich erst, da war ein Unternehmer, für den ich ein Konzept entwickeln sollte, für Events. Das kann ich gut. Aufs Geld habe ich nicht geschaut, aber was ich ihm geliefert habe, war deutlich mehr wert, als das, was er mir dann gezahlt hat. Bella, lass dich nicht wieder ausnehmen, wie ein Bio-Huhn!
Mein neues Auto hingegen liefert mir, neben dem Neid aus dem früheren Leben, erstaunliche Angebote: »Sei heute um 22 Uhr an dieser Adresse. Die Tür ist nicht verschlossen!« So der Zettel auf dem Fahrersitz. Es gibt so vieles, das ich nicht kenne.
Mich wieder als Frau zu fühlen ist schön, selbst über den Umweg eines knallroten Cabrios. Begehrt zu werden, nicht etwa begiert, wie von den Männern meiner Freundinnen oder den Nachbarn, Gemeindemitgliedern, die mit verlegenem Tätscheln eine Vertraulichkeit beschworen hatten, von der ich nichts wusste.
Die einsamsten Träume könnten nun alle wirklich stattfinden, sich vergegenständlichen. Aber ich werde jedes Mal anschließend nach Hause gehen, um nicht am nächsten Morgen in entzauberter Wahrheit erwachen zu müssen.
Paul
»Sie können sich darauf verlassen, das ist der größte Schwachsinn, den ich seit langem gehört habe!« Ich wandere auf und ab, das Headset auf dem Kopf, das Telefon liegt auf dem Schreibtisch. »Ja, das meine ich so! Genauso!« Mein Gesprächspartner sorgt sich, er fürchtet um einen Auftrag, den er noch gar nicht hat.
»Und wenn Sie dem zustimmen, werden Sie ihres Lebens nicht mehr froh, so lange das Ganze läuft!«
Etwas, das man nicht hat, kann man nicht verlieren. Aber unter wirtschaftlichem Druck, etwas zu akzeptieren, das über die Zeit einen so deutlichen Nachteil mit sich bringt, ist dumm und riskant. Ängstlichkeit ist ein schlechter Ratgeber beim Verhandeln.
»Ja, sagen Sie denen, in diesem Projekt sei für eine Qualität, die Sie gewöhnlich abliefern, kein Raum und wünschen Sie alles Gute. Dann gehen Sie nach Hause und rufen mich wieder an.«
Ich setze mich und greife zum Wasserglas. Wenn mir in solchen Phasen nur selbst ab und zu jemand begegnet wäre, der mit so deutlichen Worten die Richtung gewiesen hätte.
Mein Kalender für die nächsten Wochen hat noch Lücken. Ein Blick darauf hilft mir, mich zu kontrollieren und nicht zuzulassen, dass ich Zeitdruck fühle. Nichts ist dabei, was Begeisterung hervorruft, aber eine gewisse Zufriedenheit schon, denn ich mache meine Arbeit gern. Am liebsten zu Hause oder ganz weit weg, aber niemals zu lange dasselbe. Ich werde künftig nachsehen, ob an einem der Zielorte nicht etwas Sehenswertes existiert, das ich mir einmal näher betrachten könnte. Nun, wo ich die Freude am Alleinleben für mich entdeckt habe.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.