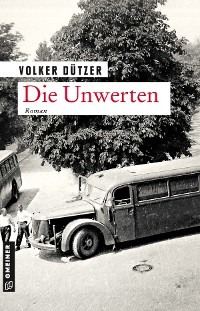Kitabı oku: «Die Unwerten», sayfa 3
Lubeck wagte nicht, bei all der Prominenz nachzufragen, aus Angst, sich zu blamieren. Es würde sich ohnehin nach und nach alles von selbst erklären. Bouhler und Brandt hatten bereits alles bis ins Letzte durchorganisiert und die einzelnen Abteilungen mit ihren jeweiligen Leitern und Ansprechpartnern eingerichtet, es gab sogar schon Briefköpfe. Für einen Transport der Kranken zu ihren Bestimmungsorten hatte man eine eigene Transportfirma ins Leben gerufen, die Gemeinnützige Krankentransport-GmbH, kurz Gekrat.
»Sie werden verstehen, dass wir für die einzelnen Abteilungen Tarnnamen verwenden«, referierte Blankenburg, »in der KdF ist man sich nicht sicher, ob das deutsche Volk den Weitblick besitzt, die Aktion in vollem Umfang zu unterstützen.«
Das wird es nicht, dachte Lubeck, man muss sich das mal vorstellen: Hier wird tausendfacher Mord geplant. Reiß dich zusammen. Schau dir Heyde an, der ist eiskalt. Dennoch, wenn das eines Tages rauskommt, sind wir alle erledigt.
Der Gedanke an absolute Macht gewann schließlich die Oberhand in ihm. Niemand würde ihn mehr verspotten, wenn er errötete wie ein Schuljunge. Mit einem Federstrich bestimmte er, wer leben durfte und wer sterben sollte. Er dachte an die Ratten, die er als Kind in Fallen gefangen und bei lebendigem Leib angezündet hatte, um seine Wut und das Gefühl der endlosen Demütigungen des Alten loszuwerden.
Aber hier ging es nicht um Ratten oder ein paar überzählige Katzen, die man in einen Sack steckte und ertränkte, sondern um Menschenleben. Und gerade das machte den Reiz unwiderstehlich.
Er versuchte, in den Mienen der anderen Ärzte zu lesen. Was ging in ihnen vor? Waren sie so abgebrüht wie Heyde?
Ich weiß nicht, ob ich das kann, dachte er. Lähmende Zweifel plagten ihn. Blankenburg hatte von einem neuen Verfahren gesprochen, einer Methode, die weitaus effizienter war, als Patienten mit einer Überdosis Luminal oder Scopolamin zu töten. Er versuchte, sich vorzustellen, wie er die tödliche Nadel in die Vene eines zur Euthanasie bestimmten Kranken einführte. In ihm kämpfte die Angst zu versagen gegen eine sexuelle Erregung, die wie ein Stromschlag seine Nervenbahnen entlang raste. Sicher würden auch Frauen unter den Opfern sein.
In Gegenwart einer schönen Frau setzte sein Denken aus und er brachte nichts weiter als dümmliches Gestammel hervor. Anschließend brannte meist heiße Wut in seinem Bauch, und er verspürte eine irrsinnige Lust zu bestrafen und zu töten. Wenn er offizieller Gutachterarzt der Aktion T4 war, würden die Frauen ihn anflehen, sie am Leben zu lassen. Dafür wären sie zu allem bereit. Ob es nur um Schwachsinnige ging? Blankenburg hatte erwähnt, dass auch Alkoholiker und notorische Querulanten ins Visier gefasst wurden.
»Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass die Teilnahme an der Aktion T4 freiwillig ist«, sagte Blankenburg. »Sollten Sie also zu dem Entschluss kommen, dass Sie Ihre Pflicht als Nationalsozialist nicht erfüllen können, dann verlassen Sie jetzt den Saal. Selbstverständlich haben Sie über das soeben Gehörte Stillschweigen zu bewahren. Andernfalls müssen Sie mit erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die Aktion T4 ist geheime Reichssache. Wir haben uns verstanden.«
Blankenburg setzte sich. Niemand verließ den Saal. Detailfragen wurden diskutiert, anschließend wurde jedem der anwesenden Psychiater ein Gebiet zugeteilt. Lubeck würde nach Frankfurt gehen.
»Ich bat Blankenburg, Sie zu Landesrat Brunner zu schicken. Er ist Dezernent für das Anstaltswesen in Hessen-Nassau. Schöne Gegend übrigens. Der Fritz ist genau der Richtige, um Sie in die besten Kreise einzuführen«, erklärte Heyde lächelnd.
»Und nun«, er rieb sich mit der flachen Hand über den Bauch, »lassen Sie uns etwas essen gehen. Dieses Gerede macht hungrig.«
Stühlerücken setzte ein, Lubeck folgte den anderen in einen extra für die Gesellschaft hergerichteten Speisesaal. Es gab Gulaschsuppe, die in einem riesigen Kessel dampfte, dazu ofenfrisches Brot. Er musste sich zwingen, einen Bissen herunterzuwürgen. Was mochte es mit der Vorführung auf sich haben? Er kaute auf einem Stück Kruste und schluckte. Der klebrige Teig verstopfte seine Kehle, er hatte das Gefühl zu ersticken und spülte den Klumpen mit Mineralwasser hinunter.
Am Nebentisch unterhielten sich zwei Ärzte über die Vorzüge und Nachteile der verschiedenen Gifte und Narkosemittel, mit denen sie bereits Patienten getötet hatten. Sie sprachen so beiläufig darüber, als ob es darum ging, wie man ein Schwein am besten schlachtete.
Heyde berichtete von seiner Arbeit in Würzburg und lobte den Alten in höchsten Tönen. Lubeck hörte kaum zu, langsam geriet er in Panik. Mitgefangen, mitgehangen. Aber denk an die Frauen. Denk an die Macht in deinen Händen!
Er schaffte es schließlich, den Teller auszulöffeln. Heyde paffte eine Zigarre, Bouhler quatschte von der Überlegenheit der arischen Rasse.
Nach dem Essen fuhren sie mit einem gemieteten Omnibus der Reichspost nach Brandenburg an der Havel, wo die Vorführung, von der Blankenburg gesprochen hatte, stattfinden sollte. Das ehemalige Zuchthaus an der Neuendorfer Straße glich einem gewaltigen Ziegelstein, in den Hunderte Arbeiter Schlitze und Fenster gemeißelt hatten. Die Vorstellung, dass sich hier an diesem 4. Januar 1940 sein Schicksal erfüllen könnte, erzeugte in Lubeck eine Mischung aus Furcht und Erregung. Von der Vorsehung ausgewählt worden zu sein, erfüllte ihn mit Stolz, aber auch mit einer gehörigen Portion Unsicherheit. Ach, Unsinn … Es kam nur darauf an, sich rechtzeitig auf die richtige Seite zu stellen.
Lubeck konnte sich später nicht erinnern, wie er in das Kellergeschoss gelangt war. Es stank nach Desinfektionsmitteln, Schweiß und Angst. In die Zellentüren auf beiden Seiten des schmalen Ganges waren vergitterte Fenster eingelassen. Von Zeit zu Zeit hörte man Wimmern oder irres Gemurmel, ab und zu einen gedämpften Schrei, die meiste Zeit aber herrschte Stille.
Sie verließen den Kellertrakt wieder und betraten einen zentralen Lichthof, wo sie ein Glatzkopf mit Zweifingerschnauzer und Brille empfing. Er schlug die Hacken zusammen und stellte sich als SS-Obersturmführer Christian Wirth vor. Lubeck atmete dankbar die frische Luft ein, ihm war leicht übel.
Wirth führte sie in einen Trakt im gegenüberliegenden Gebäude und stoppte vor einer offenen Tür, hinter der er ein gekachelter Raum lag. Er erklärte, was nun folgen sollte. Seine Worte drangen bald nicht mehr bis an Lubecks Ohren, denn ein Wärter trieb ein Dutzend Menschen den Gang entlang und in den gekachelten Raum. Sie waren nackt und hielten schützend die Hände vor ihre intimsten Stellen. Lubeck starrte eine junge Frau von etwa zwanzig Jahren an, sie wirkte apathisch, in ihre innere Welt zurückgezogen. Doch schien sie zu wissen, was passieren würde.
Die Tür schloss sich. Wirth erklärte die Wirkung des Kohlenmonoxidgases, das nun in die Kammer geleitet wurde. Heyde und Blankenburg drängten sich vor ein Guckloch, das in den Stahl eingelassen war. Lubecks Magen verkrampfte sich. Er machte kehrt, rannte den Korridor entlang, durch den sie gekommen waren, und fand eine Tür mit der Aufschrift Klosett.
Explosionsartig übergab er sich in die stinkende Kloschüssel und würgte, bis sein Magen leer war. Er wollte raus, wollte alles, was er gesehen und gehört hatte, ungeschehen machen und aus seiner Erinnerung verbannen. Er ahnte, dass sich die Bilder der Tür, die sich schloss, für immer in sein Gedächtnis eingefressen hatten. Das Letzte, was er wahrgenommen hatte, waren die Augen der jungen Frau gewesen, teilnahmslos, ergeben und von der fiebrigen Schönheit einer Schwindsüchtigen. Sie hatte ihr Schicksal akzeptiert. Er war überzeugt, dass sie den Tod als Erlösung empfand. Nicht wegen einer unheilbaren Krankheit, die ihr Schmerzen bereitete, sondern weil das Leben in der Welt, die Brandt, Bouhler und er selbst gerade erschufen, für sie nicht schlimmer sein konnte als die Hölle.
Er stemmte sich hoch und drehte den Hahn über dem Waschbecken auf. Dann schöpfte er kaltes Wasser in die hohlen Hände und spülte sich den Mund aus. Die Teilnahme an der Aktion T4 war freiwillig, Blankenburg hatte es bestätigt. So sehr ihn die Vorstellung lockte, Macht über Leben und Tod zu erlangen, war er nicht hart genug dafür. Er würde sich der Schande aussetzen und um seine Entlassung bitten.
Lubeck wischte sich die Lippen mit dem Handrücken ab und verließ den Waschraum. Im Korridor begegnete ihm Heyde, den nach dem vielen Cognac offenbar ein Bedürfnis quälte.
»Wo stecken Sie denn? Sie haben das Beste verpasst. Großartig, das Gas wird die Effizienz der Aktion enorm steigern.« Er runzelte die Stirn. »Geht’s Ihnen nicht gut? Was Falsches gegessen?«
»Es war wohl der Cognac«, antwortete Lubeck. »Ich vertrage keinen Alkohol, trinke sonst nie welchen.« Wie sollte er Heyde beibringen, dass er zu weich war? Was seinem Vater sagen, wenn er nach Würzburg zurückkehrte?
»Sie machen mir doch wohl nicht schlapp?« Heyde legte ihm die Hand auf die Schulter. »Sie müssen härter werden, Mann. Das deutsche Volk braucht Sie!« Er deutete den Gang entlang. »Das sind doch gar keine richtigen Menschen – Schwachsinnige, Epileptiker, Juden und Unruhestifter, die sich nicht anpassen wollen. Sehen Sie es so: Wir tun ihnen einen Gefallen und beenden ihre Leiden auf humane Weise. Sie hätten es erleben müssen, dann würden Sie verstehen, was wir hier leisten.«
Lubeck nickte, unfähig, etwas zu entgegnen.
Heyde trat dicht an ihn heran. »Ich kann Sie zu nichts zwingen«, sagte er leise, »aber wenn Sie jetzt nicht die Arschbacken zusammenkneifen, kann nicht mal ich Sie vor dem Fronteinsatz retten. Oder wollen Sie, dass die Wehrmacht Sie einkassiert? Polen ist erst der Anfang, da kommt noch mehr auf uns zu, glauben Sie mir. Die meisten Ärzte Ihres Jahrgangs schuften schon in den Feldlazaretten. Ich konnte gerade noch verhindern, dass Ihr Einberufungsbescheid rausging – von wegen unabkömmlich aufgrund von T4 und so weiter, Sie verstehen?«
»Es war wirklich nur der Cognac«, versicherte Lubeck.
»Dann lassen Sie in Zukunft die Finger von dem Zeug. Ich dachte schon, ich müsste mir Sorgen machen. Wüsste nicht, wie ich das Ihrem Vater beibringen sollte. Morgen früh ist Abmarsch Richtung Frankfurt. Melden Sie sich bei Landesrat Fritz Brunner. Sie werden dort Meldebogen erstellen, bis Sie zusammenbrechen, haben Sie das verstanden?«
»Jawohl, Hauptsturmführer Heyde.«
»Gut, gut. Und machen Sie mir keine Schande, Lubeck.«
5
Hannah riss ein Blatt vom Kalender ab. Heute war der 12. Januar, ein Freitag. Die Zahl verschwamm vor ihren Augen, in ihrem Kopf kündigte sich ein neues Gewitter an.
Die Weihnachtstage waren vergangen, Schnee fiel und taute wieder, das Wetter schlug Kapriolen. Nachdem sie am 31. Dezember vom Fenster ihrer Wohnung aus das Neujahrsfeuerwerk bestaunt hatten, leisteten sich Hannah und ihre Mutter eine Flasche Sekt und stießen auf das neue Jahr an. Malisha legte Platten auf ein Grammofon, das Joschi besorgt hatte. Sie tanzten zu Jazz und Bebop, der offiziell als entartet galt, aber in den Nachtklubs gespielt wurde, und freuten sich, dass sie lebten. Die Ohnmachtsanfälle hatten sich nicht wiederholt, Hannah schöpfte Hoffnung und überredete Malisha, den Arztbesuch aufzuschieben. Doch nun konnte sie nicht länger verheimlichen, dass es ihr schlechter ging.
Am späten Freitagnachmittag begleitete Joschi die beiden zu Dr. Rademann. Das Universitätsklinikum lag auf der südlichen Mainseite, etwa vier Kilometer von ihrer Wohnung entfernt, die in dem Mietshaus über Malishas Schneiderladen lag. Joschi ließ es sich nicht nehmen, Hannah zu tragen. Ihren Widerstand erstickte er mit einem unwilligen Knurren. Eingehüllt in eine warme Decke, machte das Schaukeln sie schläfrig. Joschi schien die Kälte nichts anhaben zu können. Malisha schützte Hals und Gesicht mit einem dicken Wollschal.
Hannah bemerkte kaum, wie die Zeit verging. Die Dämmerung des kurzen Wintertags brach bereits heran, als Joschi sie durch den Haupteingang der Klinik trug und auf die Füße stellte.
»Mir geht es gut«, sagte sie trotzig. »Ich bin nicht krank.«
»Komm jetzt!«
Ihre Mutter war selten streng, wenn sie allerdings eine Entscheidung durchsetzen wollte, nahm ihre Stimme einen Tonfall an, der keinen Widerspruch duldete. Dann reichte ein einziges Wort, um Hannahs Trotz zu brechen.
Sie liefen durch Korridore, in denen es nach Bohnerwachs und Desinfektionsmitteln roch. Zweimal verirrten sie sich, bis sie die Praxis von Dr. Rademann im dritten Stock fanden.
Hannah setzte sich auf einen Stuhl und wartete, während Malisha mit einer Krankenschwester sprach. Die grauhaarige Frau mit dem verkniffenen Gesicht trug eine weiße Schürze und ein steifes Häubchen.
Joschi blieb draußen auf dem Gang. Hannah beugte sich vor und sah durch den Türspalt, dass er auf und ab lief und seine Mütze knetete. Das tat er immer, wenn er angespannt war. Da er nicht sprechen konnte, achtete sie stets auf seine Körpersprache, seine Haltung und seine Gesten, um zu verstehen, was in ihm vorging. Joschi hatte Angst. War er besorgt, weil sie krank war? Oder fürchtete er sich so wie sie vor Ärzten und den spitzen Instrumenten, mit denen sie einem zu Leibe rückten? Oder argwöhnte er, dass man sie in eine Anstalt stecken würde? Hannah hatte keine klare Vorstellung davon, was sie dort mit den Kranken machten; auf jeden Fall musste es noch schlimmer sein als in einem Krankenhaus.
Sie schloss die Augen und lauschte. Bis auf die leise Unterhaltung zwischen der Schwester und Malisha war es still. Ab und zu quietschten Schuhsohlen auf dem Linoleum, eine Tür wurde geöffnet und wieder geschlossen, Schritte entfernten sich.
Hannah war noch nie in einer Klinik gewesen. Sie stellte fest, dass sie den Geruch und die düsteren Gänge mit den vergilbten Wänden nicht mochte. Joschis Unruhe übertrug sich auf sie. Vielleicht würde der Doktor darauf bestehen, dass sie hierbleiben musste. Oder sie würden ihren Kopf aufschneiden, um nachzusehen, was die Gewitter darin verursachte. Ängstlich spähte sie durch den Türspalt. Sie könnte einfach davonlaufen. Doch wohin sollte sie gehen? Außerdem würde sie an Joschi niemals vorbeikommen.
Die Krankenschwester klopfte an eine Tür und trat in das dahinter liegende Sprechzimmer. Malisha setzte sich neben Hannah und drückte ihre Hand. Ihre Finger waren eiskalt.
Durch das Fenster sickerte die Dämmerung in das Wartezimmer. Die Schwester erschien wieder. Ihre schmalen Lippen bewegten sich kaum, als sie sprach. »Doktor Lubeck wird Sie jetzt empfangen.«
Malisha sprang auf. »Wir wollten zu Dr. Rademann.«
»Er praktiziert nicht mehr. Dr. Lubeck ist ein ebenso guter Arzt.«
Hannah folgte dem unsicheren Blick ihrer Mutter, der zwischen der offenen Tür zur Praxis und dem Ausgang hin und her wechselte.
»Joschi passt auf uns auf«, flüsterte Hannah.
Malisha schüttelte unmerklich den Kopf und schob sie in den Behandlungsraum. Sie hatten keine andere Wahl. Würden sie jetzt umkehren, machten sie sich verdächtig und die Schwester mit dem verkniffenen Mund würde den schwarzen Mann rufen.
Hinter dem Schreibtisch im Behandlungszimmer saß ein schlanker Mann in einem weißen Arztkittel. Er war jung, nur wenige Jahre älter als Malisha. Auf den ersten Blick mochte Hannah ihn nicht. Schnell breitete sich die Angst in ihrem Bauch aus wie ein Hornissenschwarm. Der schwarze Mann war nicht schwarz, und er war auch keine Erfindung. Er war blond und blass, hatte wässrig blaue Augen, eine scharfe, gerade Nase und einen schmallippigen Mund.
Lubeck las in einem dünnen Pappordner und sagte, ohne aufzuschauen: »Setz dich.«
Sie rutschte zögernd auf den Stuhl vor dem Schreibtisch.
»Du heißt Hannah Bloch?«
»Ja.«
»Bloch … ein jüdischer Name. Du bist Jüdin?«
»Ich bin Jüdin«, warf Malisha ein, die hinter Hannah stand.
Lubeck schien sie erst jetzt wahrzunehmen. Er hob den Kopf und starrte sie an, als wäre er einem Gespenst begegnet. Seine Wangen röteten sich. Hannah war es gewöhnt, dass fremde Männer ihre Mutter mit großen Augen betrachteten. Manche schauten fasziniert, beobachteten sie heimlich oder verfolgten sie schüchtern mit bewundernden Blicken. Lubeck gaffte sie an wie einen funkelnden Edelstein, den er um jeden Preis der Welt besitzen wollte.
»Sie … können bleiben. Aber stören Sie meine Untersuchung nicht.«
Malisha schien sein Starren ebenfalls zu bemerken und hielt schützend ihre Tasche vor den Körper gepresst. Lubeck bot ihr keinen Platz an.
Er stellte die gleichen Fragen, die auch Dr. Blumberg an sie gerichtet hatte, sonst unternahm er nichts. Schweigend füllte er ein Formular aus.
»Können Sie Hannah helfen?«, fragte Malisha.
»Wir werden sehen. Sie muss in der Klinik bleiben.«
»Würden Sie mir bitte Ihre Diagnose mitteilen?«
Lubecks Mundwinkel zuckte. »Ihre Tochter leidet an einer Form von Epilepsie. Um die Entwicklung der Krankheit vorhersagen zu können, sind weitere Untersuchungen hier im Haus notwendig. Sie müssen sich darauf einstellen, dass dies geraume Zeit in Anspruch nimmt.«
Hannah sprang auf und flüchtete zu ihrer Mutter. »Ich will nicht hierbleiben.«
»Außerdem ist ein Eingriff unumgänglich«, fuhr er fort.
»Eine Operation?«, fragte Malisha.
»Was bedeutet das?« In Hannahs Kopf kündigte sich das nächste Gewitter an, Lubecks Gesicht verschwamm vor ihren Augen.
»Nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 müssen Sie sich mit dem Gedanken einer Sterilisation auseinandersetzen«, erklärte Lubeck.
Malisha legte einen Arm um Hannahs Schulter. »Das werde ich nicht zulassen.«
Lubeck schob seinen Stuhl zurück und stand auf. »Ich habe das Gesetz nicht gemacht. Aber es besteht und muss befolgt werden. Warten Sie hier.«
Er öffnete eine Seitentür. Hannah hörte, wie er die Krankenschwester bat, ein freies Bett herzurichten.
»Komm! Und nimm das verdammte Formular mit!«, flüsterte Malisha.
Hannah griff nach dem Blatt, das Lubeck ausgefüllt hatte, und steckte es in die Manteltasche.
»Beeil dich!«
Hastig verließen sie das Sprechzimmer. Der Platz der Schwester im Vorraum war leer. Joschi stieß gerade die Tür zur Praxis auf; er schien zu ahnen, was passiert war.
Malisha rannte kopflos den Korridor entlang, ihre Panik übertrug sich auf Hannah.
»Da war doch eben ein Lift. Wo sind wir?«
Sie drehte sich suchend im Kreis und wandte sich nach links. Joschi schüttelte den Kopf und schob sie in die entgegengesetzte Richtung, wo sie auf ein Treppenhaus stießen. Als sie in der Eingangshalle im Erdgeschoss angelangten, war Hannah schwindelig vor Anstrengung und Aufregung.
»He Sie! Bleiben Sie stehen!«
Ein Pfleger in weißer Arbeitskleidung kam auf sie zu, ein zweiter folgte ihm im Laufschritt. Sie hatten ihre Flucht also schon bemerkt. Joschi trat ihm entgegen. Beim Anblick des vernarbten Riesen blieb der Pfleger stehen und gab sein Vorhaben auf, sie festzuhalten.
Durch eine Tür gelangten sie in den Park, der sich an das Gelände der Klinik anschloss. Nach dem trockenen Mief des Krankenhauses fühlte sie sich die Luft klar und frisch an. Es roch nach Schnee.
»Werden sie die Polizei einschalten, weil ich mein Kind nicht von diesem Lubeck behandeln lassen will?« Malisha sah Joschi flehend an. »Das werden sie nicht, oder?«
Doch, das würden sie tun. Hannah hatte sich nie zuvor so gefürchtet. Sie wusste nicht, warum das alles geschah, aber sie hatte Lubecks Augen gesehen. Die Augen eines schwarzen Mannes, der blond war.
Wir brauchen einen Wagen, signalisierte Joschi.
Er wies mit dem Kinn auf den Lieferwagen einer Wäscherei, der vor einem Lieferanteneingang stand. Der Fahrer schlug gerade die Türen zu. Jemand rief ihn in das Gebäude, er lief los und ließ den kleinen Laster unbewacht zurück. Joschi rannte auf das Fahrzeug zu und öffnete die Hecktür. Sie stiegen in den Laderaum, in dem es nach verschwitzten Bettlaken roch. Hannah ließ sich auf einem der Wäschesäcke nieder, während Joschi leise den Zugang zur Ladefläche zuzog. Kurz darauf hörten sie, wie der Fahrer zurückkehrte, einstieg und den Motor startete. Der Lieferwagen verließ das Gelände der Klinik.
»Was habe ich denn getan?«, fragte Hannah leise.
Malisha strich ihr über das Haar. »Nichts. Es ist nicht deine Schuld.«
»Was ist eine Sterilisation?«
»Eine Operation, die dafür sorgt, dass du keine Kinder mehr bekommen kannst.«
»Warum will der Doktor nicht, dass ich welche bekomme?«
»Weil du krank bist und er befürchtet, sie könnten auch krank werden.«
Hannah schloss die Augen und passte sich dem Schaukeln des Lieferwagens an. Ob sie jemals Kinder haben würde? Sie stellte sich die Söhne und Töchter vor, die sie nicht bekommen durfte. Was sollte sie ihnen sagen? Dass die Nazis keine jüdischen Kinder wollten? Dass sie Jungen wie Koschka wollten, und Mädchen mit blonden Zöpfen, die Steine warfen?
Hannah tastete in der Manteltasche nach dem Zettel, den sie von Lubecks Schreibtisch gestohlen hatte, und faltete ihn auseinander. Mühsam entzifferte sie die krakelige Schrift.
Meldebogen 1
Name der Anstalt: Hadamar
Vor- und Zuname des Patienten: Hannah Bloch, geb. 07.03.1925, Halbjüdin
In ein freies Feld neben den Personendaten hatte Lubeck die Adresse der Frankfurter Klinik gestempelt. Es folgten verwirrende medizinische Ausdrücke sowie die Diagnose: Epilepsie. Zwischen die Zeilen hatte er gekritzelt: Zur Anzeige gebracht von Reinhold Pilz, Volksschullehrer, Feldgerichtstrasse 31, Frankfurt am Main. Bemerkung: Das Kind ist nicht abrichtbar. Verdirbt andere Schüler.
In einen schwarz umrandeten Kasten am Ende des Blattes hatte er mit Rotstift ein Kreuz eingetragen.
Der Wagen wurde langsamer und hielt schließlich an. Die Fahrertür wurde zugeschlagen. Joschi öffnete leise die Hecktüren, stieg aus dem Laderaum und half ihnen hinaus. Der Fahrer lief auf einen Kiosk zu und kaufte eine Zeitung. Er hatte in der Nähe des Bahnhofs gehalten. Bis zur Pagode war es nicht weit.
Joschi trieb sie zur Eile an. Malisha zog an ihrer Hand. Sie liefen über die große Kreuzung auf eine Seitenstraße zu. An Häuserwänden und Fahnenmasten flatterten blutrote Hakenkreuzflaggen, deren Farbe Hannah an das Kreuz auf dem Meldezettel erinnerte. Der Schwindel kehrte zurück. Diesmal kam mit der heranrasenden Dunkelheit die unheilvolle Ahnung einer ungewissen Zukunft. Zum ersten Mal begriff sie die Gefahr, in der sie schwebte, in vollem Umfang. Hitler war ein Krake, seine Fangarme waren die großen und kleinen Nazis, die überall herumschnüffelten und sich nahmen, was er haben wollte. Niemand war vor ihm sicher, das hatte Hannah am eigenen Leib gespürt. Vor einem Jahr hatten alle jüdischen Kinder die Schule verlassen müssen. Hannah durfte bleiben, weil sie eine Halbjüdin war, ein Mischling. Warum unterschied sie sich deshalb von anderen Menschen? Wenn sie sich in den Finger schnitt, hatte ihr Blut die gleiche Farbe wie das von Pilz oder Lubeck, und sie empfand die gleichen Schmerzen.
Unter den Kindern, die nicht mehr zur Schule durften, waren zwei Mädchen gewesen, mit denen sie sich angefreundet hatte und die in der Nähe gewohnt hatten. Hannah hatte sie besucht, aber es hieß, die Familien seien fortgezogen. Wohin, wusste niemand. Ihre Mutter sagte, sie hätten das Land verlassen, weil sie glaubten, in Deutschland nicht mehr sicher zu sein. Malisha dagegen war überzeugt, dass die Herrschaft der Nationalsozialisten höchstens noch ein paar Jahre dauern würde. Eine überschaubare Zeit, die sie irgendwie überstehen würden.
Die Scheinwerfer einer vorbeifahrenden Straßenbahn stachen wie ein Messer in Hannahs Augen. Sie spürte ihre Füße nicht mehr und hatte das Gefühl, über dem Asphalt zu schweben. Unweit der Pagode brach sie zusammen.
*
Hannah schlug die Augen auf und versuchte zu schreien. Kein Laut kam über ihre Lippen, so sehr sie sich auch anstrengte. Zuerst glaubte sie, die Polizei hätte sie geschnappt und in einer Zelle an eine Pritsche gefesselt, weil sie sich nicht bewegen konnte. Doch dann wurde ihr klar, dass sie im Sirup steckte.
Sie sah die schwarz-weiße Katze, die sich auf dem Fensterbrett zusammengerollt hatte, nahm den Lichtschein der Lampe neben dem Bett wahr und hörte Joschis leises Schnarchen. Er saß in einem Sessel und war offenbar eingenickt.
Hannahs Sinne flirrten wie die Luft an einem heißen Sommertag. Es dauerte quälende Minuten, bis sie den milchigen Schleier durchdrangen, der sie umgab. Wie stets endete der quälende Zustand so plötzlich, als hätte jemand das Licht eingeschaltet. Endlich sah sie klar. Sie lag auf dem Bett in Joschis kleiner Wohnung über dem Lokal im Bahnhofsviertel. Die Tür zur Küche stand einen Spalt offen, sie hörte leise Stimmen. Die eine gehörte Malisha, die andere einem fremden Mann. Er sprach mit einem leichten Akzent, den sie nicht einordnen konnte.
»Du warst leichtsinnig. Ich habe dir schon vor einem Jahr geraten, Deutschland zu verlassen. Für Juden wird die Lage immer gefährlicher, und nicht nur für sie. Schau dir an, was sie mit Joschi gemacht haben. Jeder, der nicht Heil Hitler brüllt, macht sich verdächtig. Sie machen weder vor Priestern noch Kindern Halt.«
»Blumberg hat angedeutet, dass sie Kranke umbringen, Schwachsinnige und Behinderte«, sagte Malisha. Sie senkte ihre Stimme zu einem heiseren Flüstern, Hannah musste sich anstrengen, um ihre Worte zu verstehen.
»Eines muss man den Nazis lassen«, erwiderte der unbekannte Mann, »sie wissen, wie man den Massenmord organisiert. Ja, es stimmt. Blumberg hat sich Zugang zu Todesfallstatistiken psychiatrischer Kliniken besorgt. Die Zahl tödlicher Lungenentzündungen und Embolien ist explodiert. Sie beschäftigen einen ganzen Stab von Ärzten, die falsche Totenscheine ausstellen. In Grafeneck unten bei Reutlingen soll es eine Anstalt geben, in der sie Kranke mit Gas töten.«
Malisha gab ein ersticktes Wimmern von sich. »Aber warum? Was haben diese armen Menschen denn getan?«
»Die Nazis sind besessen von der Reinhaltung der arischen Rasse. Sie werden nicht aufhören zu morden, bevor die ganze Welt in Schutt und Asche liegt.«
Hannah hörte das Klicken eines Feuerzeugs.
»Ihr müsst so schnell wie möglich raus aus Deutschland. Ich habe Freunde in Hamburg, die euch eine Schiffspassage besorgen werden.«
»Und wo sollen wir hin?«, fragte Malisha.
»Warum gehst du nicht nach England?«
»Steve ist verheiratet. Ich will ihn nicht in Schwierigkeiten bringen.«
Der Mann lachte. »Er hat dich in Schwierigkeiten gebracht.«
Hannah war plötzlich hellwach. Nun kannte sie endlich den Namen ihres Vaters. Er hieß Steve, und er lebte in England.
»Du sprichst doch ganz passabel Englisch«, fuhr der Mann fort. »Damit kommst du überall durch. Am besten geht ihr in die USA. Joschi wird euch begleiten.«
»Das kann ich nicht verlangen.«
»Er wird es freiwillig tun. Du hast dem guten Kerl das Leben gerettet, das vergisst er dir nicht. Außerdem hat er einen Narren an der Kleinen gefressen. Sicher, er ist nicht der schönste Mann, den man sich vorstellen kann, aber er hat ein großes Herz und Kräfte wie ein Bär.«
Malisha schien nachzudenken.
»Die Amerikaner nehmen keine Emigranten mehr auf, schon gar keine jüdischen«, entgegnete sie.
»Du hättest eben schon vor Jahren auswandern sollen.«
»Niemand hat geglaubt, dass es so schlimm kommen würde«, antwortete Malisha.
»Du hast doch ein bisschen was gespart. Für den Anfang wird es reichen. Wenn du dich entschließt, das Gewerbe zu wechseln, könntest du reich werden, gleich wohin du gehst. Die Kerle sind verrückt nach dir.«
Hannah setzte sich auf, ihr Herz pochte schmerzhaft gegen ihre Rippen. Joschi regte sich in seinem Sessel. Sie musste ihre Mutter überzeugen, nach England zu gehen. Dann würde sie endlich ihren Vater kennenlernen.
»Ich kann auf andere Weise Geld verdienen«, sagte Malisha.
»Wie du meinst, es war ja nur ein Vorschlag. Arthur wird euch neue Papiere besorgen, er ist der beste Fälscher, den ich kenne. Damit kommt ihr überall durch«, sagte der Mann. »Kannst du bis elf im Laden aushelfen? Maja ist krank, die Lunge wieder mal.«
»Ja, natürlich. Du kannst dich auf mich verlassen.«
Fort! Deutschland verlassen! Hannah hatte in Büchern von Helden gelesen, die Hals über Kopf fliehen mussten. Ihre anfängliche Begeisterung wich einer aufkeimenden Furcht. Dies hier war kein Abenteuerroman, sondern die Wirklichkeit. Ihr Leben verwandelte sich ohne Vorwarnung in einen Albtraum. Hannah wollte nicht fort, sie hatte Freunde hier in Frankfurt. Das alles musste ein schrecklicher Irrtum sein.
»Malisha?«, krächzte sie heiser.
Joschi war sofort wach, stemmte sich aus dem abgewetzten Ohrensessel hoch und kam herüber.
Malishas vertrautes Gesicht tauchte im Lichtkegel der Lampe auf. »Wie geht es dir?«
»Mir fehlt nichts. Aber ich will nicht fort von hier, ich …«
»Hat sie gelauscht? Gib ihr was, damit sie schläft«, rief der Mann aus der Küche.
Joschi reichte ihr ein Glas. Er war nicht eher zufrieden, bis sie es ausgetrunken hatte. Das Wasser hatte einen bitteren Beigeschmack.
»Schlaf jetzt«, beruhigte ihre Mutter sie. »Morgen sieht alles anders aus.«
Hannah ließ den Kopf auf das Kissen sinken. Er fühlte sich mit einem Mal federleicht an. Das Letzte, an das sie dachte, war das rote Kreuz auf dem Meldebogen des Arztes.