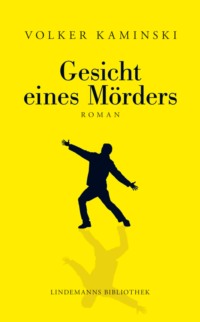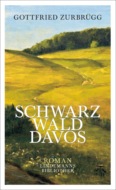Kitabı oku: «Gesicht eines Mörders»

Volker Kaminski
Gesicht eines Mörders
Roman

1
Fünf Monate Beirut waren genug. Steiner musste wieder nach Deutschland zurück, auch wenn es selbstmörderisch war. Sein Heimweh war zuletzt übermächtig geworden. Er hatte nicht mehr als ein paar Brocken Arabisch gelernt und nie den Plan gehabt, in Beirut Fuß zu fassen. Also hatte er sich endlich ein Flugticket gekauft, seine Sachen zusammengepackt und war zum Rafiq-Hariri-Flughafen gefahren.
Regen und kühle Luft empfingen Steiner in Frankfurt. Die Leute schienen abgelenkt, keiner beachtete ihn. Bevor er ins Taxi stieg, musterte er sein Spiegelbild in einer Fensterscheibe: dunkler Anzug, helles Hemd, schräg sitzender Strohhut. Es kam ihm so vor, als hätte er immer gleich ausgesehen, mit siebzehn wie mit Anfang dreißig.
Zwei Stunden später stand er in der Frankfurter Altstadt und ließ eine Horde Schulkinder passieren. Die Wolkendecke war aufgerissen, immer wieder brach für Minuten die Sonne durch.
Nachdem er sein Gepäck ins Hotel gebracht hatte, ging er los, um etwas zu essen, merkte aber, dass er keinen Appetit hatte. In der Ferne war eine Polizeisirene zu hören. Hier klingen die Sirenen ganz anders, dachte er, nicht so schrill und aufgeregt. Eher wie Spielzeugautos. Als ob mit dem melodischen TA-TÜ-TA-TA von etwas Unangenehmem abgelenkt werden sollte.
Fürs Erste hatte Steiners Plan funktioniert. Möglicherweise hatte er sich alles viel zu schwierig vorgestellt. Er war wieder zu Hause, spürte Frankfurter Pflaster unter den Füßen. War frei wie jeder X-beliebige.
Ein paar Ecken weiter war das Büro. Pontens Büro. Vielleicht würde ihn Ponten noch einmal anstellen, wenigstens für die erste Zeit. Bis der Albtraum ausgestanden war.
Er überquerte eilig eine größere Kreuzung und bog in eine Seitenstraße ein. Schon von Weitem erblickte er das gelb gestrichene Haus. Es war unübersehbar in der grauen Einheitsfront der anderen Gebäude. Die obersten Stockwerke waren von hellem Sonnenlicht beschienen. Miras Dachwohnung musste jetzt davon durchflutet sein. Er hatte nicht den Mut direkt darauf zuzusteuern und ging auf der anderen Straßenseite weiter, bis die großen Scheiben eines Cafés seinen Blick ablenkten. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass ihm niemand gefolgt war, ging er hinein.
Das „Silberstein“ war am frühen Nachmittag fast leer. An der Bar saß ein älterer Grauhaariger bei seinem Bier und spielte mit dem Handy. Zwei Frauen in bequemen Sesseln unterhielten sich in der Fensternische neben der Tür. Sie hoben den Blick bei Steiners Eintreten, und wie er es zugegebenermaßen erwartete, ruhten ihre Augen einen Moment lang auf ihm. Vielleicht wunderten sie sich auch nur über seinen Hut. Steiner stellte sich an die Bar, mit dem Rücken zur Theke, und blickte zur Straße.
Sein Herz hatte heftig gepocht, als er die gelbe Fassade wiedersah. Er fürchtete, Fritz’ erstarrtes, schreckensbleiches Gesicht : im nächsten Augenblick vor sich zu sehen.
In Beirut waren die Erinnerungen rasch schwächer geworden, bis ihm die ganze Sache fast irreal erschienen war.
Abdul war ihm als Erstes eingefallen, als er damals panikartig das Haus verlassen hatte. Der reiche, diskrete Abdul würde keine lästigen Fragen stellen, wenn Steiner mit dem Koffer vor seiner Tür stand. Sie kannten sich aus Steiners Zeit bei Ponten. Später hatten sie sich in Amerika wieder getroffen. Steiner hatte Abdul ein paar Mal wertvolle Anlagetipps geben können, die verhinderten, dass er sein Geld in verlustreiche Spekulationen steckte. Dafür war ihm Abdul noch immer dankbar.
Steiner war die Zeit in Beirut quälend lang vorgekommen. Die Stadt war viel zu heiß, die weißen Hausfassaden blendeten ihn. Nicht einmal in einer schattigen Teestube fühlte er sich besser.
Abdul versorgte ihn mit Geld und gewöhnte sich schnell an ihn. Er stellte ihn seinen Freunden und Familienmitgliedern vor, durchweg gebildete, gut situierte Leute, Ärzte, Rechtsanwälte, Immobilienhändler. Steiner gab sich charmant und steuerte mehr oder weniger geistreiche Bemerkungen bei. Keiner wagte ihn zu fragen, was er eigentlich in Beirut trieb. Manchmal begleitete er Abdul ins Büro und half ihm beim Übersetzen von Korrespondenz.
So verging der Sommer, bis Steiner klar wurde, dass er zurückkehren musste. Es sollte alles wieder so werden wie früher. Abdul hatte es ihm prophezeit: Du wirst wieder nach Deutschland gehen, wenn die Zeit dafür reif ist.
Jetzt brauchte Steiner Geld, er musste sich eine Arbeit suchen, und er wusste nicht, ob er in Frankfurt sicher war. Viel hing davon ab, was Mira ihm erzählen würde.
Während er die kleine Espressotasse zwischen Daumen und Zeigefinger hielt und den stark duftenden Kaffee schlürfte, stiegen Erinnerungen in ihm hoch.
Miras Dachwohnung hatte immer ein Kaffeeduft durchzogen. Die Wohnung strahlte etwas Pariserisches aus mit der quer durchs Zimmer gespannten Wäscheleine, dem Vogelkäfig mit grünem Wellensittich am Küchenfenster, den orientalisch gemusterten Kissen auf dem Bett. Ausgelassen und barfüßig durchtanzte Mira ihr kleines Reich. Über sein Verhältnis zu Mira war Steiner sich nicht im Klaren, damals so wenig wie heute. Er war einfach nur gern in ihrer Wohnung, die ihm wie ein warmes Nest vorkam. Ihm gefiel das ganze Haus mit seinem bohemeartigen Charme, seinen bunten Briefkästen. In dem Haus wohnten überwiegend Studenten und Freiberufler – mit Ausnahme von Fritz.
Fritz war anders. Er verbrachte sein einsames Leben damit, Modellschiffe zu bauen. Auf dem Weg zu Miras Wohnung war Steiner ihm manchmal begegnet. Mit seinem hilflosen Lächeln hielt Fritz ihn im Hausflur auf und begann von seinen Schiffen zu erzählen; Steiner musste ihm in seine Wohnung folgen und ihm dabei assistieren, ein Holzruder anzukleben oder ein Papiersegel aufzusetzen. Fritz konnte nicht aufhören, ihm die Modelle bis ins Detail zu erklären. Länge, Breite, Höhe, Baujahr der Originalschiffe. „Du bist ganz schön durchgeknallt“, hatte Steiner manchmal gesagt und war dann einfach zu Mira hochgegangen.
Es war ihm damals selbst verrückt vorgekommen, dass er sich eines Tages darauf einließ, bei Fritz einzuziehen. „Ich brauche doch keine drei Zimmer für mich“, hatte Fritz gesagt. „Was musst du im Hotel wohnen? Ist doch viel zu teuer.“
Tatsächlich war Steiner nach seiner Rückkehr aus Amerika gerade wieder knapp bei Kasse. Und es sollte ja nur für ganz kurze Zeit sein, bis das Geld aus einer geschäftlichen Transaktion angewiesen war.
Steiner bekam das größte Zimmer in Fritz’ Wohnung. Nach seinem Einzug versuchten sie in einer gemeinsamen Aktion etwas Ordnung ins Chaos zu bringen. In allen Zimmern, sogar im Flur, lagen Modellbaukästen verstreut, flüchtig aufgerissene Kartons, Plastiksäckchen mit Einzelteilen. Daneben Kleider, schmutzige Wäsche, Gummistiefel. Die Küche stank nach Essensresten und gebrauchtem Geschirr. Fritz gab sich Mühe, das bemerkte Steiner, aber er war nicht lange zu ertragen. Steiner mied seine Wohnung, so oft es ging.
Warum er ihm plötzlich mehr als sonst auf die Nerven ging, konnte er nicht sagen. Er erinnerte sich nur daran, wie sie eines Abends zusammen im Wohnzimmer standen und sich seine Wahrnehmung plötzlich verengte. Er sah nur noch diese hässlichen fleischigen Lippen, die sich pausenlos bewegten. Ein Rhythmus, der nur unterbrochen wurde vom Saugen am Hals der Bierflasche. Er hätte sich umdrehen und weggehen können; lass ihn reden, hätte er sich sagen können, was interessiert dich der Typ? Aber da war es schon zu spät.
Er hatte Fritz angeschaut, ihn fixiert, bis dieser endlich schwieg und die Flasche an den Mund setzte, um wieder zu trinken. Als der Flaschenhals seine Lippen berührte, packte Steiner die Flasche und rammte sie Fritz in den Mund. Es war ein Reflex, er hatte nicht vorgehabt ihn zu ermorden.
Was danach kam, davon wusste er nur noch Bruchstücke.
Fritz taumelte, stieß mit der Hüfte an die Tischkante. Ein Schiffskörper schaukelte und einzelne Bauteile fielen herunter. Fritz lag am Boden und röchelte. Steiner konnte es nicht ertragen, dieses Gurgeln und Ächzen. Die Flasche war zerbrochen. Er sah das runde teigige Gesicht, die Augen hervorgequollen, die schweißnassen Haare angeklebt. Ihm wurde übel, und er riss sich los. Stehend blickte er auf den reglosen Körper hinunter.
Irgendwann stand er in seinem Zimmer und raffte wahllos einige Kleidungsstücke zusammen, ein T-Shirt, ein Sakko, das über der Lehne hing, ein Paar Socken. Er stand mit dem Kleiderknäuel minutenlang da, seine Hände heiß und verkrampft. Nur mit allergrößter Anstrengung gelang es ihm schließlich, die Schranktür zu öffnen und den Koffer herauszunehmen.
Nach dem dritten Espresso beschloss Steiner zu zahlen und hinüberzugehen.
Der klassizistische Altbau mit den Sprossenfenstern und dem braunen Giebeldach, eingezwängt zwischen zwei unscheinbaren Nachkriegsbauten, zog ihn unwiderstehlich an. Er brauchte nicht lange zu warten, bis ein junger Mann die Tür von innen öffnete und herauskam. Steiner drückte sich an ihm vorbei und gelangte in den Hausflur.
Langsam stieg er die Treppen hoch; so schwer hatte er sich noch nie gefühlt, als ob Gewichte an seinen Füßen hingen.
Auf dem Stockwerk, wo Fritz gewohnt hatte, musterte er das Klingelschild. Es stand ein neuer Name darauf.
Ganz oben stand immer noch „Mira Weller“ auf einem lila Pappschild.
„Du? Hier ... ?“
Mira trug eine cremefarbene Hemdbluse, die ihr bis knapp übers Knie reichte. Darunter waren ihre bloßen Beine zu sehen.
„Ich muss mit dir reden.“ Etwas Besseres fiel ihm nicht ein. Sie streckte den Kopf in den Gang hinaus und blickte nach links und rechts. Er war schon in der Wohnung, durchquerte das Arbeitszimmer und schaute durch das geöffnete Fenster auf die gegenüberliegende Dachseite. Von unten waren Stimmen zu hören, die erstaunlich nah klangen, obwohl man vom Dachfenster aus nicht auf die Straße sehen konnte.
Mira stand vor ihm, die Hände in den Hüften, den Kopf zur Seite geneigt.
„Wie siehst du aus? Mit Bart ... ?“
Ihre langen schwarzen Haare waren wie damals zurückgebunden und lässig durch ein Samthaarband gezogen.
„Sind sie hinter dir her?“
„Weiß ich nicht. Kommt darauf an, was du der Polizei erzählt hast.“
„Nichts. Ich habe ihnen gesagt, dass ich nur deinen Vornamen kenne.“
Lächelnd ließ er sich in den Sessel neben dem Klavier fallen.
Mira ging Zigarette rauchend im Zimmer auf und ab. Auch er zündete sich eine an. Sie bot ihm nichts zu trinken an, aber das machte ihm nichts aus.
„Hör zu, ich wollte Fritz nicht töten. Das musst du mir glauben.“
„Hattet ihr Streit?“
„Nein, es war eine Verkettung saublöder Umstände. Ein Unfall. Er ist mir auf den Wecker gegangen mit seinem andauernden Gerede. Er wollte einfach nicht aufhören. Auch nach dir hat er mich pausenlos gefragt.“
„Nach mir?“ Sie blieb neben einem wackligen Bücherturm stehen, der einen halben Meter von der Wand entfernt aufgebaut war. „Was wollte er denn von mir wissen?“ Sie machte ein Gesicht, als ob sie nie von selbst darauf gekommen wäre.
„Na, was wohl. Ob wir zusammen wären, zum Beispiel. Er hat mich ständig über dich ausgefragt, als ob er auf dich scharf wäre.“
„Und da bist du wütend geworden.“
„Auf Fritz konnte niemand richtig wütend sein, oder? Der war doch wie ein Kind. An diesem Abend ging er mir allerdings gewaltig auf die Nerven, er war ziemlich betrunken und wurde immer aufdringlicher.“
„Und dann?“ Sie schaute ihn mit großen Augen an. Wenn sie so aussah, kam ihm ihr Gesicht wie eine schöne Maske vor. Ihre hohen Wangenknochen, ihr heller Teint. Scharf geschnittene Augenbrauen.
„Sag schon, was ist passiert?“
Steiner zuckte mit den Schultern. „Ich hab’ die Nerven verloren, mir ist die Sicherung durchgebrannt.“
„Die Polizei sagt, er wurde erwürgt.“
„Ich hab ihm seine verdammte Flasche in den Hals gerammt!“
„Du hast was? –“
„Er hat getrunken, gequatscht, wieder getrunken, es war wie ein Reflex. Zack! hatte er die Flasche in der Kehle.“
„Hast du ihn erwürgt?“
„Nein ... vielleicht waren meine Hände kurz an seinem Hals. Ich weiß nicht, ob ich zugedrückt habe. Jedenfalls war Fritz auf einmal still.“
Mira ging zum Tisch und drückte ihre Zigarette im Aschenbecher aus. Sie sah ihn eine Weile schweigend an. „Die Polizei hat alle Hausbewohner befragt. Es hat angeblich keiner etwas bemerkt. Von dir haben sie nur eine vage Beschreibung bekommen. Das Phantombild sieht dir auch nicht wirklich ähnlich.“
Das Telefon klingelte. Mira nahm den Hörer ab und telefonierte eine Weile. Dann sagte sie ihm, er müsse gehen, sie bekomme gleich Besuch.
Als sie ihn zur Tür brachte, lästerte sie wieder über sein Aussehen. „Du siehst echt komisch aus, mit Bart und Hut. So alt!“
„War schön, dich zu sehen“, sagte er.
Er stand in der offenen Wohnungstür, die Anzugjacke über dem Arm, und deutete eine leichte Verbeugung an. „Jedenfalls, danke ...“ Er wollte noch etwas sagen, aber er hörte, dass jemand die Treppe hochkam, und ging los.
Auf dem zweiten Treppenabsatz blieb er stehen. Er hörte an den Schritten, dass es eine Frau war, die sich näherte. Auf einmal durchströmte ihn ein seltsames Glücksgefühl. War die Frau aus Fritz’ ehemaliger Wohnung gekommen? Er sah eine schwarze Strickjacke zwischen den Streben des gedrechselten Holzgeländers und schulterlanges schwarzes Haar. Gleichzeitig stieg ihm zarter Parfümduft in die Nase.
Er merkte erst jetzt, wie stickig es im Hausgang war. Diese eigenartig schwere Luft kannte er von früher. Eine permanente Feuchtigkeit, die alle Gerüche im Hausflur übertünchte. So, genauso, kannte er diesen Aufgang. Ein dunkler, steinerner, kalkig riechender Turm. Der Duft, der von der Frau ausging, war unter dieser Feuchtigkeit kaum wahrzunehmen. Während sie sich näherte und er schon ihr Gesicht sehen konnte, hatte er plötzlich ein Bild vor Augen: Er sah die Frau, wie sie den Telefonhörer ablegte und den Schlüsselbund griff, um zu Mira hochzugehen; und der Geruch, den sie schon den ganzen Tag an sich trug, begleitete sie die Treppen hoch. Er schaute ihr neugierig entgegen, fing einen selbstbewussten Blick auf und stellte fest, dass sie nicht nur sehr leichtfüßig ging, sondern auch außerordentlich hübsch war.
An einem Kiosk in der Nähe kaufte er sich eine Zeitung. Er schlenderte durch die Straßen, bis er die Fußgängerzone erreichte. An einem Eckcafé, vor dessen Eingang Holztische und Bänke standen, blieb er stehen und starrte eine Weile auf die Tische, als würden sie ihm etwas sagen. Es war zu kühl, um draußen zu sitzen, trotzdem beschloss er einen Kaffee zu trinken. Einen Teil der Zeitung benutzte er als Sitzunterlage. Es waren kaum 15 Grad. Der Himmel war wieder bleigrau. Aber es war windstill, und im Sakko war es auszuhalten.
Aus einem parkenden Wagen am Straßenrand schaute eine junge Frau zu ihm heraus. Sie trug eine Hochsteckfrisur und eine Sonnenbrille. Sollte er sie ansprechen, einfach so? Er war doch frei. Er konnte zu ihr hinübergehen und sie in ein Gespräch verwickeln. Sie erinnerte ihn an eine frühere Kollegin, die auch bei Ponten gearbeitet hatte. Als er sich fast dazu entschlossen hatte aufzustehen, lächelte sie plötzlich jemand anderem zu. Ein Mann kam aus einem Hauseingang und stieg zu ihr ins Auto.
Steiner durchblätterte den Anzeigenteil. Las ein Stück, blätterte weiter. Er konnte sich nicht konzentrieren, immer wieder schweiften die Gedanken ab. War er nach Fritz’ Tod allzu panisch gewesen? Wenn die Polizei ihn gar nicht suchte und keinen konkreten Hinweis besaß, dann hatte er das letzte halbe Jahr glatt verschenkt.
Kein Mensch konnte sich vorstellen, wie sehr Steiner Frankfurt vermisst hatte. Wie er es jetzt genoss, die Schilder und Werbeplakate der Geschäfte wieder zu lesen. Die Kunden vor den Kaufhäusern zu betrachten, ihre Jacken und Anzüge zu vergleichen und sich zu erinnern, dass er früher – vor seinem Amerikaaufenthalt – geglaubt hatte, die Deutschen verstünden sich nicht zu kleiden.
Von den letzten sieben Jahren hatte er vier im Ausland verbracht – zwei davon in Los Angeles, wo er wegen der Nähe zu Hollywood für einen Immobilienmakler gearbeitet hatte. Der Mann hatte ihn eingeladen an die Westküste zu kommen; er wollte ihn mit ein paar wichtigen Leuten aus der Filmbranche zusammenbringen.
„Du hast das richtige Gesicht“, hatte er gesagt, „du siehst besser aus als Helmut Berger ...“
Steiner hatte ihm von seinem lang gehegten Traum Schauspieler zu werden erzählt. Auch von den Werbefilmen fürs Fernsehen und einer ambitionierten Fotostrecke für ein edles Herrenmagazin. Das Angebot des einflussreichen, irischstämmigen Donald Hurst war ihm daher sehr verlockend vorgekommen und so hatte er bei Ponten gekündigt.
Hollywood war dann aber eine Enttäuschung gewesen. Nur ein einziger Kontakt und ein zehnminütiges Gespräch mit einem Filmproduzenten, dem Steiners forsches Auftreten zu gefallen schien. Es war aber nichts daraus geworden. Hurst hatte ihn als Mädchen für alles missbraucht, und so war Steiner schließlich desillusioniert nach Frankfurt zurückgekehrt.
2
Steiner saß im Schneidersitz auf seinem Hotelbett, um ihn ein Meer aus Zeitungsblättern. Links von ihm stand das Telefon bereit. Eine große schwarze Fliege trieb sich schon seit mehreren Minuten auf den Seiten herum, auf dem dünnen Papier waren die Kratzgeräusche ihrer flinken Beinchen zu hören. Nach einem erneuten Rundflug setzte sie sich genau auf die Telefonnummer einer Annonce, die Steiner gerade mit dem Textmarker angestrichen hatte.
„Sie sind Top-Verkäufer und haben Erfahrung in der Gastronomie? Sie suchen einen attraktiven Job in Teilzeit (86,6 Std./Monat)? Sie sind engagiert und gerne in Kontakt mit Gästen? Wir suchen Sie: Eine flexible Verkaufskraft (m./w.) für unsere neu gestalteten Verkaufsstände in Frankfurt Westend.“
War vielleicht doch etwas zu riskant, sich so in der Öffentlichkeit zu präsentieren, dachte Steiner. Es war nicht auszuschließen, dass ihn jemand aufgrund des Phantombilds erkannte. Steiner nahm an, dass es in zahlreichen Medien veröffentlicht worden war. Fünf Monate waren keine sehr lange Zeit, um ein Gesicht verblassen zu lassen, selbst wenn es ihm nur wenig ähnelte.
Die Fliege krabbelte zielstrebig auf die darunterstehende Annonce und blieb auf der vorletzten Zeile stehen, um ihre Vorderbeine zu putzen.
„Internetdienstleister aus Frankfurt sucht freie oder feste Mitarbeit für Vertriebsaufgaben. Übernehmen Sie für uns Recherche und telefonische Terminanbahnungen. Wenn Sie Erfahrungen in Telefonakquisition haben, sich durch Verhandlungssicherheit und freundliches Auftreten auszeichnen, über gute Kenntnisse der englischen Sprache verfügen und Erfahrungen mit dem Medium Internet mitbringen, dann senden Sie Ihre Bewebungsunterlagen.“
Als er bei der Firma anrief und sich als Bewerber vorstellte, sagte der Mann am Telefon: „Fein, dann kommen Sie einfach mit Ihren Unterlagen vorbei – wenn Sie sich fühlen.“
„Wie soll ich mich denn fühlen?“, fragte Steiner.
„Na so, dass Sie vorbeikommen können.“
Es klang nicht gerade so, als ob die Suche nach einem neuen Mitarbeiter besonders dringend war.
Er hatte den Hörer gerade aufgelegt und sich nach der Fliege umgesehen, die sich einer anderen Zeitungsseite zugewandt hatte, als das Telefon klingelte. Steiner fuhr zusammen. Er hatte nur Mira seine Nummer im Hotel auf einen Zettel geschrieben.
„Hallo Frank, wie geht’s? Sag mal, hast du heute Abend schon was vor?“
„Hallo, Mira. Heute Abend? Warte mal ... ich glaube nicht.“
„Was hältst du davon, wir könnten doch zusammen essen gehen. Du erinnerst dich doch sicher an diese kleine Trattoria Marconi, drei Querstraßen von mir entfernt, wo wir früher öfter saßen?“
„Na klar, das war doch unser Italiener – okay, ich komme.“
„Super“, sagte sie, „na dann also bis um acht. Wir freuen uns.“
Steiner hatte bereits wieder aufgelegt, als er über das „Wir“ stutzte. Worauf ließ er sich da nur ein, und dann auch noch ein Treffpunkt im alten Kiez. Mira war manchmal unberechenbar, aber immerhin hatte sie ihn ja nicht verraten, warum sollte sie ihn jetzt in Schwierigkeiten bringen. Dennoch konnte er nicht verhindern, dass ihm noch stundenlang dieses „WIR“ im Kopf herumspukte.
Steiner betrat das Marconi gegen acht. Über den Rand seiner Sonnenbrille hinweg blickte er sich im Lokal um, das um diese Zeit noch recht leer war. Als er Mira nirgendwo entdeckte, steuerte er einen Vierertisch im hinteren Teil des Restaurants an. Von der rot gepolsterten Bank aus, auf der er Platz genommen hatte, konnte er den Eingangsbereich gut beobachten. Den Strohhut legte er neben sich auf die Bank.
Er ließ sich die Weinkarte bringen und bestellte einen Viertelliter Montepulciano. Das Lokal schien ihm unverändert. Viel Backstein, heller Dielenboden, schwere Holzstühle, an den Wänden Schwarz-Weiß-Poster aus italienischen Filmen der fünfziger Jahre.
Bevor das Warten anfing ihn nervös zu machen, sah er Mira hereinkommen. Sie winkte ihm von Weitem zu. Ihre Begleitung erkannte er sofort wieder, es war die Frau aus dem Hausgang.
„Das ist Doreen“, sagte Mira noch im Stehen. „Und das ist Frank.“
„Hallo“, sagte Steiner.
Doreen begrüßte ihn matt lächelnd.
Im Sitzen redete Mira sofort weiter.
„Doreen ist eine tolle Sängerin. Sowas hast du noch nicht gehört. Wir kennen uns schon lange, aber seit einem Vierteljahr wohnt sie bei mir im Haus. Das ist so wunderbar, wir machen zusammen Musik, weißt du, und haben Wahnsinnspläne miteinander ...“
Doreen saß neben Mira und verzog keine Miene. Steiner bemerkte den gleichen stolzen Gesichtsausdruck an ihr wie vorgestern. Eine Attitüde, die nur verschwand, wenn sie lächelte. Steiner fühlte sich von ihr gemustert, doch anders, als er es sonst von Frauen gewohnt war. Nicht so, als wäre sie an ihm als Mann interessiert.
Als sie ihr Essen bestellt hatten und der Rotwein gebracht worden war, entstand eine kurze Gesprächspause. Steiner versuchte das Schweigen zu überbrücken, indem er davon sprach, wie schön ihm Frankfurt vorkomme. Er genieße das städtische Leben, das er in Amerika vermisst habe.
Ehe er weiterreden konnte, fiel ihm Mira ins Wort.
„Frank, hör mal zu, ich – nein – wir, also, Doreen und ich – wir haben ein Problem ... Wir möchten gern mit dir darüber reden.“
„Ein Problem? Lass uns doch erst einmal essen und etwas relaxen.“
Er warf Doreen einen Blick zu.
„Ja klar“, sagte Mira und fuhr sich durch die Haare. „Ich wollte nur ... ich meine ... es ist sehr wichtig!“
Sie kam ihm durcheinander vor. So kannte er sie nicht, normalerweise ließ sie sich von nichts aus der Ruhe bringen. Sie war der Typ, der bei jeder Gelegenheit – beim Spazierengehen, Lesen, Arbeiten – vor sich hin summte, scheinbar ganz in ihre Welt versunken. Jetzt schaute sie nervös zu ihrer Freundin, die ihrerseits sehr gelassen wirkte.
Ihre Pizzen wurden serviert und sie begannen schweigend zu essen. Am liebsten hätte Steiner jetzt Vergleiche angestellt zu den Pizzen, wie man sie in den Staaten bekam, aber irgendwie hatte er den Eindruck, dies sei das falsche Thema. Die Frauen wirkten abwesend.
Als die Atmosphäre zunehmend beklemmender wurde, dachte sich Steiner: Also gut, reden wir von dem „Problem“.
Doch jetzt wollte Mira nicht davon sprechen. Stattdessen war sie auf einmal ziemlich aufgedreht. Sie machte witzige Bemerkungen über eine neue italienische Filmkomödie und versuchte Doreen zum Lachen zu bringen. Es ergab sich ein halbwegs angeregtes Dreiergespräch über Filme – ein dankbares Thema, um Peinlichkeiten unter Fremden zu überbrücken.
Als sie die nächste Karaffe Wein bestellt hatten, lehnte sich Steiner bequem zurück und betrachtete die beiden nebeneinandersitzenden Frauen. Mira war eindeutig die Schlichtere, Direktere. Sie war nicht in der Lage, etwas lange für sich zu behalten, plauderte wie ein Mädchen, impulsiv und uferlos. Doreen erschien ihm wesentlich zurückhaltender, hintergründiger. Sie war keineswegs schweigsam, sprach aber kontrollierter, mehr auf die Wirkung ihrer Worte bedacht.
„Was habt ihr beide denn jetzt für ein wichtiges Problem?“, fragte Steiner plötzlich. „Erst schien es ganz dringend und jetzt redet ihr nicht mehr davon.“
„Ja, stimmt, du hast Recht, wir sollten jetzt darüber reden“, sagte Mira. „Es ist zwar die reine Scheiße, aber es hilft nichts, es muss sein.“
Ein vielversprechender Auftakt, dachte Steiner.
„Du kannst dir nicht vorstellen, was für Schweine manche Männer sind“, sagte Mira.
Das wird ja immer besser. Steiner legte die Hände aufeinander. „Dann lass mal hören.“
Mira beugte sich nach vorne. „Traust du dir zu, einen, der es verdient hat, kaltzumachen?“
„Das meinst du jetzt nicht ernst, Mira.“
„Doch, du musst uns helfen. Der Typ ist echt ein Fiesling.“
Sie machte eine kleine Kunstpause, ehe sie heiser flüsternd loslegte.
„T.B. – ich nenne ihn mal so –, T.B. ist das größte Arschloch der ganzen Welt. Er hat sich einmal in seinem Leben angestrengt, sich ein einziges Mal zu einer Heldentat aufgerafft und begonnen einer schönen Frau den Hof zu machen, sie zu verwöhnen, mit Komplimenten zu überhäufen. Mit einem Wort, er hat sie sich unter den Nagel gerissen. Nicht ungeschickt, wie ich zugeben muss. Aber kaum hat er sie an der Angel, sperrt er sie in den goldenen Käfig ...“
Steiner kam nicht umhin, sich das schiefe Bild vorzustellen: ein Fisch in einem Vogelkäfig, zum elenden Sterben verurteilt ...
„Geht’s nicht ein bisschen konkreter“, unterbrach er sie. „Wer ist T.B.? Und warum bist du so wütend auf ihn?“
„Ich komme ja gleich dazu.“ Mira rutschte unruhig auf ihrem Stuhl hin und her. Ihr Gesicht bekam einen giftigen, verkniffenen Ausdruck. Er konnte nicht sagen, ob ihre Wut echt war oder bloß gespielt.
„Er sperrt sie in den goldenen Käfig – weißt du, was das heißt? Sie soll zu Hause sitzen, bis er kommt. Sie darf nicht raus, Freunde treffen, geschweige denn Kollegen, oder auf Reisen gehen – sie darf überhaupt keinen Beruf ausüben, stell dir das vor! T.B. sagt ihr, was sie zu tun hat, er kontrolliert sie jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Sie ist nur dazu da, um an ihm zu kleben. Wie ein Abzeichen auf seiner Brust. Sie soll sich wie eine Prinzessin benehmen, aussehen wie eine Prinzessin, sich kleiden wie eine Prinzessin. Sie bekommt alles, was sie mag, Schmuck, teure Kleider, Schuhe, sie braucht nichts im Haushalt zu machen, dafür sorgen die Angestellten. Sie kann sich voll und ganz auf das Leben mit ihm konzentrieren und soll nur an ihren Prinz denken, der ihr das alles ermöglicht.“
Steiner hielt es nicht mehr aus, beugte sich vor und fasste Miras Handgelenk. „Stopp, Mira, ich habe verstanden. Warum erzählst du mir das alles? Was willst du von mir? Ich verstehe nicht, was das alles soll!“
„Scht, scht ...“, hörte er Doreen von der Seite sagen. Dazu schloss sie besänftigend die Augen. Sie wirkte entspannter als zuvor.
„Also, dieser Mann ist Winzer“, begann Mira von Neuem.
„Weinhändler“, verbesserte sie Doreen.
„Ja gut, Weinhändler. Er kommt aus einer wohlhabenden Familie, er sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ein reicher Fettsack ist er und ein riesiges Ekel. Du wirst ihn hassen, ihn verabscheuen, sobald du ihn kennst. Eine richtige Sau auf zwei Beinen. Jemand, wie es ihn nur in rückständigen Weindörfern gibt, wo noch die alten verkrusteten Strukturen herrschen und die Männer das Sagen haben. Diese mittelalterlichen Käffer eben.“
„Wie alt?“, fragte er.
„55“, sagte Doreen.
„Das muss man sich mal vorstellen!“, sagte Mira aufgeregt. „Seine Kundschaft ist weit über Europa verstreut, er liefert seine Weine in alle möglichen Länder. Spricht mehrere Sprachen, ist charmant und überhaupt kein Dummkopf. Und sperrt seine Frau ein! Das findet er richtig so, dass er der Herr ist und sie der Knecht. So soll es zugehen in der Welt. Wie in seinem kleinen beschissenen Dorf.“
Steiner seufzte und griff nach seinem Hut, der neben ihm auf der Bank lag. „So einen darf man eben nicht heiraten“, sagte er.
„Genau. Aber wenn es einmal passiert ist? Was dann? Was würdest du vorschlagen, Frank?“
„Scheiden lassen, ganz einfach.“
„Das geht eben nicht so einfach. Er gibt sie nicht frei, er droht ihr. Er denkt gar nicht daran sein Vögelchen fliegen zu lassen. Eher bringt er sie um. Und jetzt stell dir vor, was dieses Dreckschwein gesagt hat. Doreen, was hat er gesagt, kannst du es bitte noch mal wiederholen?“
Doreen wirkte ruhig und distanziert. Mit einem schwachen Lächeln auf den vollen roten Lippen sagte sie: „Wenn du gehst, bist du tot.“
„Hmhh.“ Steiner hielt den Hut eine Weile unbewegt in den Händen, bevor er ihn wieder ablegte. Eigentlich enthielt ihr Satz nichts Überraschendes; er hatte nichts anderes von dem mächtigen dicken T.B. erwartet. Es ärgerte ihn, dass ihn der Satz trotzdem beeindruckte. Vielleicht lag es an Doreens unterkühlter, lässiger Sprechweise, die sich so sehr von Miras heißblütiger, mit Ausfälligkeiten gespickter Tirade unterschied.
„Bist – du – tot!“, wiederholte Mira und betonte jedes einzelne Wort. „Er lässt sie lieber umbringen, als dass er sie gehen lässt, verstehst du? Sie hat es gewagt, ihm Adieu zu sagen, die Käfigtür zu sprengen und das Weite zu suchen. Jetzt soll sie erleben, wie mächtig er ist. Er wird jemanden dafür bezahlen, dass er Doreen umbringt. Brunn ist der Mann, der so etwas eiskalt in die Tat umsetzt.“
„Brunn? Jetzt wissen wir wenigstens mal seinen Namen.“
„Ja, Brunn“, sagte sie ein wenig leiser, „das ist sein Name. Im Moment weiß er noch nicht, wo Doreen steckt, aber er ist wild entschlossen, sie zu vernichten, wenn sie nicht zu ihm zurückkehrt. Das ist der Stand der Dinge.“
Steiner kam das Gespräch zunehmend merkwürdig vor. Dass es sich bei der „Prinzessin“ um Doreen handelte, hatte er schon geahnt. Er fragte sich nur, warum Mira ihm das alles erzählte. Sie glaubte doch nicht im Ernst, dass er bereit wäre, sich in irgendeiner Weise in diesen Ehekrieg hineinziehen zu lassen. Und warum saß Doreen die meiste Zeit schweigend daneben, als hätte sie mit der Sache nichts zu tun?
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.