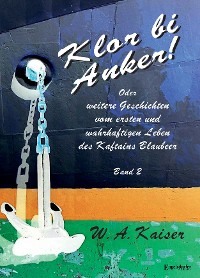Kitabı oku: «Klor bi Anker! Oder Weitere Geschichten vom ersten und wahrhaftigen Leben des Kaftains Blaubeer (Band 2)»
W. A. Kaiser
Klor bi Anker!
Oder
Weitere Geschichten vom ersten und wahrhaftigen Leben des Kaftains Blaubeer
Band 2
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2019
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2019) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte bei Wolf A. Kaiser, Umschlagsentwurf und Fotos:
Wolf A. Kaiser
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Wie Band 1 endete
Hansa Victory (2003)
Hansa Victory (2003/04)
Hansa Victory (2004)
Hansa Victory (2004)
Hansa Lambda (2004/05)
Hansa Victory (2005)
Hansa Brutus (2006)
Wie Band 1 endete
Die ersten sechs Jahre als Kapitän waren im Nachhinein betrachtet wohl nur Lehrjahre gewesen, allerdings von besonderer und hoher Güte. Gerade mit den Bananenjägern, die ohne Bugstrahler auskommen mussten und häufig nur kleine Häfen anliefen, die oftmals auch nur eine unzureichende Schlepperassistenz zur Verfügung stellen konnten, waren jene Einsätze die besten Lektionen, die mich praktisch herausforderten und sicherer machten.
Doch wie oft hatte oder brauchte ich einen Schutzengel? Wohl oft genug und unbewusst war er sicherlich stets gegenwärtig, denn von ernsthaften Unfällen blieb ich komplett verschont. So manches Mal mochte ich aber lieber gar nicht erst wissen, was in so mancher Nacht, während ich ein Deck tiefer den Schlaf des Gerechten schlief, wirklich auf der Brücke los war.
Meine ersten Zeiten auf Containerschiffen bereiteten mich gezwungenermaßen recht gut auf die reale Zukunft der Schifffahrt vor. Um diese, von mir sehr ungeliebte Fahrerei konnte sich niemand drücken, leider. Mit überwiegend guten und sehr angenehmen Kollegen, die die Frage nach dem „Woher?“ hintenanstellten und Leistung und Kennung in den Vordergrund rückten, war es mir immer ein Leichtes gewesen, mich zu integrieren – ohne meinen Standpunkt zu verleugnen. Insofern hatte ich auch wieder einen guten Start.
Die nachfolgend geschilderten Einsätze waren daher auch nur eine logische Folge, lediglich der ruppige Bruch zum Schluss war unvorhergesehen und hinterließ einen ziemlich ungewollt bitteren, enttäuschenden Nachgeschmack.
Aber: wo sich eine Tür schließt – da öffnet sich eine andere, neue, vielleicht sogar eine – bessere?
Hansa Victory (2003)
Das schlimme Freifallbootsmanöver
Pitcairn und die HMS „Bounty“
Mann über Bord
Panamakanal
Das Desaster der „Tricolore“
Ablöser mit Handikap
Lukenprobleme #2
Osaka verlassend, navigierten wir mit der Segel-Order, den Hafen von Tauranga nicht früher und nicht später als am 06. August zu erreichen, los. Mit leerem Schiff, einem ganz leeren Schiff. Die Laderäume wurden von der Crew gewaschen, gereinigt und die vielen Beschädigungen an Wänden und Grätings repariert, die sich zwangsläufig einstellten, wenn Gabelstapler und Hubwagen auf den Decks herumfuhren. Niemand nahm Rücksicht, nicht mal unsere eigenen Leute, die, wenn sie als Raumwache eingesetzt waren, solche Schäden zu melden hätten und allein durch ihre Gegenwart dieses eigentlich verhindern sollten. Das war in der Realität eben nicht so, Fraternisierung mit dem ‚Gegner’, Augen zu und weggeguckt. In solchen Momenten waren unsere Jungs fast ohne Erinnerungsvermögen: Der Moment zählte, dass aber all diese Schäden sehr kostenund arbeitsaufwändig später durch uns selbst zu beseitigen waren, war dann für sie ohne Belang – im Moment, wenn sie als Raumwache eingesetzt waren.
Diese Arbeiten waren wichtig genug, dementsprechend waren alle anderen Arbeiten dem nachgeordnet worden. Nicht zu vergessen: Wie’s der Zufall so wollte, war unsere liebe gute „Tante Victory“ beim letzten Mal wegen mangelnder Sauberkeit in den Luken geblacklistet worden! Das war erst im März gewesen. Und die Kiwi-Bauern vergaßen so schnell nicht, ohne das Gegenteil gesehen zu haben. Also ein Makel, der uns an der Backe klebte und den wir so schnell wie möglich tilgen mussten. Zumal das nicht stillschweigend vonstattenging, sondern richtig im Rundumschlag bekannt wurde: der Charterer fand es nach uns als Erster auf dem Tisch, dass ‚sein‘ Schiff den bekannt hohen Ansprüchen der exportierenden Bauern Neuseelands nicht gerecht wurde, zusätzlich trudelte dann bei dem auch noch unser Bericht ein, der darüber Auskunft gab, dass das Schiff soundsoviel Zeit für Nacharbeiten brauchte, und in dieser Zeit nicht ladetüchtig war, wie es in den Verträgen festgeschrieben stand. Der Charterer rief dann natürlich sofort den Eigner, also unseren Reeder an, der sich nix sehnlicher wünschte, als morgens irgendeine Botschaft mit Geldforderungen auf seinem Schreibtisch zu finden. Der wiederum klingelte mich ohne Berücksichtigung des Zeitunterschiedes sofort aus den Federn und verlangte dazu Erklärungen! Tja, und wenn man dann sagen musste, dass die Luken zwar gemacht wurden, aber die Kontrollen durch den Chief Mate wohl nicht ganz so exakt gewesen waren, dann hattest du beim Reeder schlechte, sehr schlechte Karten, wenn du denn dann mal um eine Lohnerhöhung bitten wolltest.
Also ließ man das besser sein und machte Nägel mit Köpfen. Und passte scharf auf. Mit diesem Wissen machte ich natürlich Druck auf den Chief Mate, der aber auch von sich aus schon bestrebt war, die Scharte seines Vorgängers nicht noch tiefer zu hauen, sondern besser großflächig auszubügeln. So konnte man erkennen, dass auch diesen Chief Mate keine Schuldzuweisung traf; ebenso wie ich war er erst nach dem Zwischenfall hier aufgestiegen. Nur die Crew war noch die alte, die damals ihre Hausaufgaben ungenügend erledigt hatte.
Und diese, könnte man meinen, sollte selbst so viel Stolz besitzen, diese ‚Schmach‘ auszulöschen. Aber wieder einmal ein typischer Fall von ‚Denkste‘! Denen war es doch völlig egal, ob sie eine Woche oder hundert Wochen in den Luken hockten! Sie wurden nach Zeit bezahlt, egal, was am Tagesende dabei rauskam. Das war denen sowas von schnurz-pieps am Mors vorbei! Nur die täglichen vier Überstunden zählten: Das war bares Geld. Und mehr nicht. Man konnte nur kopfschüttelnd danebenstehen, wenn man den Mackern beim Arbeiten zusah! Technisch waren sie bis auf zwei einzelne Nasen wirklich doof, gerade mal, dass sie wussten, wo beim Hammer der Stiel saß und was ein Nagel war. Damit hatte es sich auch schon. Aber immer schön auf einem Haufen zusammensitzen! Könnte man verrückt werden.
Mit dem Chief Mate hatte ich dann eine Art Strategie entworfen, wie wir das Problem der mangelnden Produktivität etwas mindern konnten. Wir hatten den Fitter aus der Maschine noch dazu genommen und zwei Gruppen gebildet, die wir in zwei verschiedene Luken steckten. Und dann immer schön von 0600 Uhr morgens bis 2100 Uhr, nur durch die Mahlzeiten und Smoketimes unterbrochen. Glücklich wurden sie dadurch nicht wirklich richtig. Ich aber eigentlich auch nicht, da ich nun zeitweilig die Wache von Chief Mate übernahm, damit der seine Schafe zuhauf trieb, wenn sie meinten, unkontrolliert die Zeit absitzen zu können, was also meistens in der regulären Wachzeit des Chief Mates war. Schließlich hatte ich mit dem Chief Mate zwei Tage vor Erreichen des Hafens, als die Luken klargemeldet worden waren, einen Rundgang (mit weißen Baumwollhandschuhen!) gemacht.
Selbstverständlich wurden wir da fündig! Aber solcherart ‚Feiertage‘, dass man sich unwillkürlich genötigt sah, sein Auge scharfen Blickes in die Runde zu werfen und zu fragen, ob das nicht doch willentlich geschah? Zumal der Chief Mate vorher selbst einen Check gemacht hatte und diesen Zustand für gut befunden hatte. Und nun der Alte noch höchstpersönlich! Damit aber hätte er rechnen müssen! Ich wollte mir doch nicht vorwerfen lassen, nichts getan und mich ihm blindlings ausgeliefert zu haben, was zwar für ein ausgesprochenes tolles Verhältnis spräche, aber dafür hätte ich mir ja nun gleich gar nix kaufen können, weil das Kind erst am Brunnen mit dem Krug zusammenbrach!
Wir fanden sozusagen die Inkarnation des Bösen selbst: Vergammelte Bananen der vorigen Reise! Alleine schon, dass eine Handvoll Bananen, und die hätte sogar noch grün oder gelb sein können und nicht schwarz wie diese, zu finden war, hätte einem Besichtiger doch nichts Anderes bedeutet, als dass hier wohl sichtlich gereinigt, aber nicht sorgfältig genug und vor allem der Laderaum unkontrolliert abgenommen worden war. In summa, dass sich die Schiffsleitung auch nicht des Übereifers schuldig gemacht hatte! Dazu kamen noch etliche Beschädigungen, die übersehen worden waren und Schmierfettflecken von den Gabelstaplern. Es war eine schier endlose Latte, die wir zusammentrugen. Der Chief Mate guckte schon ganz finster. Nur noch zwei Tage bis Buffalo! Und dann flog die Schwalbe über den Eriesee … John Maynard …
Unsere Krieger mussten nochmal in die Schlacht ziehen. Zu diesem Zeitpunkt setzte uns ein wunderschön hoher, südlicher Schwell ziemlich zu. Das leere Schiff, dessen Schwerpunkt naturgemäß sehr tief lag, benahm sich dann wie ein Stehaufmännchen und es rollte stark nach beiden Seiten, was zwar am deutlichsten auf der Brücke bemerkbar wurde, aber in der Luke nicht minder hinderlich war, weil mit Kreissäge und Flex gearbeitet werden musste und sich der Boden unter einem und der ganze Raum drumrum sowieso bewegte!
Tage vorher erhielten wir die Anfrage, ob wir nicht doch etwas früher vorliegen könnten, da das Schiff vor uns die ‚pre-loading-survey‘, also genau das Ding, was wir hier gerade bekämpften, nicht bestanden hätte und wir sofort an die Pier könnten. Na, Schiet aber auch! Wir hatten doch sogar schon reduziert, um nicht zu früh dort zu sein, was ja wegen des damit verbundenen höheren Spritverbrauchs auch eigentlich nicht erwünscht war. Na, nochmal gerechnet und dann zurückgetelext: Yes, können wir! Waren also am 5. nachmittags schon da. Das hieß für den Chief: Eine Kohle mehr auflegen und für die Deckscrew: Sich sputen mit den Luken.
Am Einlauftag erhielt ich morgens die Nachricht, dass das andere Schiff die Mängel nun doch noch behoben hätte und wir demzufolge bis zum nächsten Tag auf Reede warten sollten. Auch nicht schlecht, Herr Specht!
So erreichten wir Tauranga, meinen kleinen Lieblingshafen in Neuseeland, bei strahlendem Sonnenschein und legten uns weisungsgemäß mit fünf Längen Kette zu Wasser auf siebzehn Meter Wassertiefe vor Anker.
Die ruhige See flüsterte mir angesichts der besten Voraussetzungen eine gefährliche Botschaft ins Hirn: Mach ein Bootsmanöver! Mach! Mach doch! Lass es fallen! Feigling, Feigling! – Ja, dieses Manöver sollte man mal gemacht haben und turnusmäßig wäre es sogar dran gewesen. Sicherheitshalber konsultierte ich aber dann doch lieber noch schnell den Chief, was er denn so zu meiner Absicht meinte. – Nee, antwortete er, dann passiert immer irgendwas, weil’s immer so war, wenn das Boot zu Wasser ging und er dann mit Reparatur und so’n Schiet zu tun hätte, wo er doch schon genügend Sorgen hatte mit seiner Maschine und den begnadeten Ingenieuren. Nee, besser wohl nich, oder?
Aber die Bedingungen waren geradezu bilderbuchmäßig ideal! Wie für ’n Film! Kaum Schwell, kein Wind, Sonne mit Blende 8 und die Luken waren endlich auch fertig! Außerdem wusste schon keiner mehr, wann das Boot das letzte Mal zu Wasser war. So wär’s doch schnell hinter uns zu bringen, oder? Also was soll’s? Ich gab meine Absicht dem zweiten Mate bekannt und bestimmte, wer alles mit ins Boot musste. Nach der nachmittäglichen Coffeetime ging’s zu Wasser. Der Chief schüttelte nur den Kopf und wandte sich ab. Dienst ist Dienst, sagte ich mir, nur schnell zu Wasser, eine Runde um das Schiff und wieder hoch. Konnte nicht allzu lange dauern. Außerdem war der Chief Mate, der beim Mann-über-Bord das Kommando im Boot haben würde, und der dritte Mate noch nie mit dem Boot runtergefallen.
Der Koch meldete sich sogar freiwillig, den kleinen Steward muss ich erstmal suchen, um ihm zu sagen, dass er auch Teil der Crew wäre, ebenso den zweiten Ingenieur, der sichtlich nervös und ängstlich war, die wollten nicht mit, weil ‚das nicht sicher sei‘ und anderer lahmen Argumente mehr, die vorzubringen niemand verlegen war, wenn es half, an Bord zu bleiben. Aber bei mir? Auf Granit gebissen, meine Herren! Hier fiel ins Wasser, wer’s brauchte! Letztlich waren acht Leutchen im Boot und wir starteten das Manöver.
Ich gab das Kommando zum Wassern und dann, wie erwartet, ruckte das Boot kurz auf der Laufbahn und rumpelte gleitend, immer schneller werdend die Schräge hinab und schoss ins Wasser, dass die Gischt hoch aufschäumte! The boat was waterborn! Es schnitt nur gering mit dem Bug unter und entfernte sich, eine dunkelgraue Abgasfahne hinter sich herziehend, schnell von der Eintauchstelle. Gratulation! Die Jungs, die sich neugierig auf der achteren Station eingefunden hatten, applaudierten laut. Okay, das war’s. Schnell zur bereits ausgebrachten Lotsenleiter, den Koch und Steward abgegeben, damit wir abends was zum Mampfen hätten und eine Runde ums Schiff und zurück in Mutterns Schoß.
Ich schaute mir die Aktion vom Brückendeck aus an, weil ich sozusagen anstatt des Chief Mates nun die Wache hatte. Der Wagen, also der bewegliche Teil des Davits, der gefiert wurde, um, in der unteren Endlage angekommen, wie ein Galgen das Boot mittels Drähte und Haken aufzunehmen, lief gehorsam und ohne Sperenzchen bis zur Endlage die Laufbahn hinab. Nun hätte sich eigentlich programmgemäß durch die schräge Lage des Davits die Traverse, an der die Haken zum Aufnehmen des Bootes befestigt waren, diese zu Wasser fieren lassen müssen. Was aber ausblieb. Ärgerlich, das! Ich orderte den Davit nochmal ganz nach oben. Wunschgemäß fuhr das tonnenschwere Gefährt wieder hoch. Und noch einmal mit offener Bremse den Wagen in untere Lage laufen lassen, wieder und wieder.
Es verging Zeit. Irgendwas beklemmte wohl die Traverse in der oberen Lage. Ich schickte den Bootsmann mit noch zwei Leuten nach Brechstange und Holz und dann hoch aufs Davit mit den dreien. Die hingen wie ein Schluck Wasser in der Kurve oben auf dem Davitkopf, gesichert mit einem Fallschutzgurt und strampelten sich ab, bewegten aber auch nichts. So ein Mist aber auch! Es ließ mir keine Ruhe, ich flitzte in die Kammer, zog mich schnell um und war nach kurzem wieder am Platz des Geschehens. Ich musste mir selbst den Schaden besehen. Der Chief guckte finster und begleitete mich zum Davit.
Dann kam noch der Chief Mate dazu. Mit vereinten Kräften versuchten wir, das verdammte Teil, das bombenfest saß, zu bewegen. Auf einer Seite der Traverse gelang es uns, das Teil um wenige Millimeter, immerhin aber wenigsten sichtbar, wenn auch bei Weitem nicht ausreichend, zu bewegen. Die andere Seite rührt sich aber nicht den Hauch eines Millimeters! Wir quälten uns, denn Platz war da oben auch nicht recht und die Brechstange mit Aufsatzrohr mittlerweile schon so voll Fett geschmiert, wenn man da nicht aufpasste, rutschte man ab und knallte vielleicht noch irgendwie hin oder gar runter! Aber das Ding wollte und wollte nicht.
Natürlich standen starke Mooringwinden unter dem Davit auf der achteren Station, aber wir brauchten dann einen Fixpunkt, der hinter dem Schiff angebracht sein müsste, um mit Schmackes in diese Richtung zu ziehen, da sich der Davit, wenn er ausgeklappt war, ungefähr sechs Meter hinter der Achterkante des Schiffes befand, wo die Hakentraverse eigentlich frei in Richtung Wasser nach unten laufen sollte. Dort bräuchten wir einen, der da mal anfasste, aber wir hatten nix als das Boot im Wasser. So versuchten wir es mit unserem Vier-Tonnen-Leichtgewicht von Boot, angetrieben von einem dänischen Fünfzig-PS-Diesel. Das war die einzige jämmerliche Chance, die uns zur Verfügung stand. Wir befestigten zwei dreißig Meter lange Leinen an den beiden Haken und gaben sie zum Boot runter, wo sie mit dem Aufheißgeschirr verbunden wurden. Nun fierten wir den Davit wieder in die untere Lage und das Boot sollte nun mit Karacho und Anlauf von der Bordwand nach achteraus dampfen und dabei so viel Speed wie möglich aufnehmen.
Das geschah wunschgemäß. Und nichts passierte. Das achtundzwanzig Millimeter dicke Tauwerk straffte sich – und das Boot stoppte. Mit weichem Nicken nahm es trotz seiner Maschine, die auf „Voraus Voll“ lief, wieder Fahrt übern Achtersteven auf. Wir hatten dafür gar kein Auge, wir starrten nur gebannt auf die Traverse. Tat sich da was? Ruckte das nicht doch schon etwas stärker? Also nochmal, und wieder und wieder. Es ging auf 1900 Uhr. Der Koch wartete schon über eine Stunde auf Kundschaft. Ich war dem Wetter sehr dankbar, dass sich nicht verändert hatte. Es war zwar nun dunkel, aber der Wind blieb aus und der leichte Schwell hatte ebenfalls nicht zugenommen. Immerhin günstige Bedingungen für ein Manöver wie dieses. Dann endlich geschah das Unfassbare: Die eine Seite kam völlig frei und nun hing die Traverse schon auf halb acht. Kam eine, würde auch die andere kommen! Wir enterten wieder hoch, zum x-ten Mal mit der Brechstange und das zeitigte endlich langsam Erfolge, das geringe Rucken durchs Boot hatte etwas bewirkt, zwar noch lange nicht genug, aber ausreichend für einen leichten Hoffnungsschimmer. Es dauerte noch so eine weitere halbe Stunde, bis alles jauchzte und jodelte: Die andere Seite war nun auch endlich frei! Nun konnten wir aufatmen und schon mal an das Wohl unserer Wänster denken, deren Äsung in greifbarere Nähe rückte. Wir fierten die Traverse zu Wasser und die Leute verbanden deren Haken mit dem Heißgeschirr des Bootes. Ready to heave up! Ich drückte den Nach-oben-Knopf der Anlage und folgsam hob sich das Boot langsam, das Heck voran, aus dem Wasser und – dann stand die Winde! Das hieß, der Motor drehte zwar hörbar weiter, aber die Drahttrommel drehte sich einen Scheißdreck!
Den Davit wieder runterzufieren ging problemlos, weil es über Schwerkraft geschah, daran hatte der Motor keine Aktien! Aber hoch, das schaffte der Motor nur bis zu einer gewissen Last und kein Deutchen mehr. Guter Rat war nun nicht billig! Ich konnte ja morgen früh so nicht einlaufen: das Rettungsboot vielleicht noch im Schlepp! Irgendwie war die Winde auch verdammt heiß!
Also entschied ich mich. Wir ließen das Boot wieder zu Wasser, es sollte längsseits verholen, wo wir es mit einem Ladekran an Deck hieven würden, um uns in aller Ruhe der Winde widmen zu können. Weiterhin beauftragte ich Leute, ausreichend Holz zum Abpallen bereitzuhalten und wir verholten uns alle auf das Hauptdeck. Ein erfahrener Mann hoch in den Kran, die anderen rannten und trugen, zerrten und wirbelten an Deck. Der Koch wartete immer noch. Und es war nun schon fast 2000 Uhr!
Nach einigem Hin und Her war dann endlich auch ein entsprechender Drahtstropp gefunden worden, stark genug, um das Boot gefahrlos aus dem Wasser zu heben. Ab ging die Post, sprich: der Ladehaken. Mir kamen leichte Bedenken als ich beobachtete, wie stark der Haken, noch ohne Last, begann, gefährlich hin und her zu pendeln. Da kamen Massen in Bewegung, die man mit bloßer Hand nicht mehr dirigieren konnte! Das Schiff hob und senkte sich ja doch etwas in der flachen Dünung. Und wenn das Pendel mit den Schiffsbewegungen harmonisierte, dann könnte das richtig gefährlich werden, weil sich die Bewegungen aufschaukelten! Stichwort: Resonanz! Gar nicht daran zu denken, dass dann ein schweres Boot am Haken hängen würde, das zu allem Überfluss auch noch schräge mit dem Bug abwärtszeigend hochgenommen werden musste! Denn so war das originale Aufheißgeschirr ausgelegt worden, nämlich mit der notwendigen Schräglage, um das Boot zurück in den Davit zu kriegen. Der Kranhaken wurde nochmal erreichbar für die Crew an Deck gefiert. Nur mit Mühe konnte der schwere Haken eingefangen und an ihm zwei Beiholer befestigt werden. Nur mit den beiden Leinen konnten wir etwas Kontrolle auf ihn und seine Last ausüben, indem wir sie mit ein paar Turns um die Reling ständig straff hielten!
Die beiden verbliebenen Leute im Boot befestigten den Drahtstropp am Bootsgeschirr, verließen eiligst das Boot, indem sie hurtig die Lotsenleiter hochhampelten, und wir starteten die geplante Rückholaktion. Auch am Boot befanden sich vorn und achtern Beiholer, um unerwünschte Schwingungen oder Drehungen rechtzeitig zu verhindern. An Deck war mittlerweile aus Bohlen und alten Paletten ein ‚Bett‘ für das Boot hergerichtet worden. Dort setzten wir es nach vielem Geschrei, Gezerre und Hin und Her – und nach langen bangen Minuten endlich, endlich! – ab! Krachend und knirschend setzte der Kiel des Bootes auf die hölzernen Polster auf und zerdrückte sie gnadenlos das hatten wir vorhergesehen und mit einer ausreichende Menge Holzes bedacht. Nun wurde es nur noch gelascht, so dass es nicht mehr auf die Seite fallen konnte. Schon war die um 15:20 Uhr begonnene Ausflugstour beendet. Es ging auf zweiundzwanzig Uhr. Sehr nett.
Hatte der Chief doch Recht behalten. Aber eigentlich hatten wir beide mehr dem Boot denn dem Davit den Part des Übelmanns zugetraut! Weil der Motor des Bootes früher mal überhitzt worden war, waren dort die Kühlung und Schmierung nicht mehr klar getrennt, sondern das Kühlwasser mischte sich so peu-á-peu unter das Schmieröl, was nicht gesund war und die Leistung des Motors negativ beeinflusste. Na, die Ingenieure waren noch bis gegen Mitternacht an der Winde, um die Ursachen für deren Versagen zu finden, während ich mich schon immer mal mit der Reederei in Verbindung setzte, um die nächsten Schritte zu beraten. Ich kriegte eine Adresse für eine Werkstatt hier in Tauranga, die auch gleich meinen Anruf mit der Aufforderung, morgen an Bord zu kommen, erhielt.
Unser Untersuchungsteam wurde nach Aufnahme der Winde schnell fündig: ein ausgelaufenes Lager hatte sich so festgefressen, dass die Bremsandruckscheibe gerissen war, wodurch der nichtmetallische Bremsbelag wie mit einer Raspel fein säuberlich und vollständig abgeschält worden war, bei jeder Umdrehung etwas mehr, bis Metall auf Metall schliff, und dann hielt und bremste bekanntlich gar nix mehr.
Der nächste Tag kam, nun jedoch grau und wieder nieselverhangen. Die erste Frage des Lotsen, nachdem er an Bord war, galt dem Rettungsboot. Klar, das erregte Aufsehen, wenn ein Handelsschiff sein Boot nicht im Davit, sondern an Deck sehr unorthodox geparkt hatte. Unser Partner, der den Liegeplatz ockupiert hatte und der die Huddelei mit den Luken hatte, lief aus und wir passierten uns an der Ansteuerung. Ein kleineres Schiff, auch für Europa bestimmt, aber von einem anderen Charterer. Die bekannte 90°-Kurve kurz vor dem Strand und um den ehemaligen Vulkan Mount Maunganui herum und schon waren wir in der kleinen natürlichen Bucht, die den Containerhafen, die Marina sowie die Stückgutpier, an der wir nun zum Liegen kamen, beherbergte. Gut, wieder hier zu sein. Bei den Lotsen hatte ich nie einen schlechtgelaunten oder schlechtinformierten angetroffen; sie waren alle durch die Bank gut und die Schlepper stark und modern.
Was wollte ein Blaubeer mehr vom Meer?
Schnell und gekonnt wurden wir gedreht und waren noch vor dem Abendbrot fest vertäut. Ich verabschiedete den Lotsen, klarte die Brücke auf und ging in mein Office, um auf die Behörden zu warten.
Ich wartete wenigstens zwanzig Minuten – vergeblich. Also wollte ich dann erstmal was essen gehen und wurde von der Messe aus gewahr, dass sich ein Haufen unserer Leute irgendwie am Landgangssteg zu schaffen machte. Misstrauisch ging ich nach draußen und sah den Lotsen immer noch bei uns an Deck stehen, mit den Mates und der Deckscrew, die gerade den Landgangssteg, nicht die Gangway, aus der Vertäuung lösten! Auf meine Frage, was der Grund eines solchen Tuns sei, kriegte ich zu hören, dass die Gangway doch out of order wäre. Ich guckte doof und sah den Elektriker bekümmerten Gesichts am Schaltkasten stehen. Nix ging mehr. Die ganze Kiste war abgesoffen und vorerst nicht so schnell zu reparieren. Zumal auch der Motor der Gangwaywinde einen Schlag Wasser abgekriegt haben musste und damit ebenfalls höchstens noch teurer Schrott war.
Was nicht für ein Schiff! Innerlich verfluchte ich den Herrn über mir und konnte es mir wieder mal nicht ganz verkneifen zu fragen, womit ich das alles verdient hatte. Okay also, dann die zweite Garnitur, den Landgangssteg. Ein sperriges, langes Mordsinstrument und schwer wie Hulle. Um ihn zu bewegen, musste der Proviantkran benutzt werden. Und?
Na, man wird es erraten haben, richtig! Auch der konnte nicht, weil er auch zu viel vom Wasser genascht hatte und somit ebenfalls nicht einsatzklar war. Ich entschuldigte mich mehrfach bei dem geduldig wartenden Lotsen, der mit gelassener Gemütsruhe unserem Treiben zusah. Es war aber auch zum Auswachsen! Ging denn überhaupt noch was auf diesem Luxusboot? Der Lotse bot mir an, einen mobilen Landgang vom Hafen zu organisieren, das ginge in wenigen Minuten, wäre aber kostenpflichtig. Sofort stimmte ich zu. Ja, das sollte er man machen, dann könnten die Behörden an und der Lotse von Bord und auch die Arbeiter ebenfalls mit den vorbereitenden Arbeiten beginnen. Jau, ich bestellte so ein Ding, was nur lächerliche achtzig Dollar Miete pro Tag kostete. Das war es mir doch mal eben wert. Wo gab’s denn sowas, ha?
In kürzester Frist kam auch richtig ein Gabelstapler mit so einem Ding vorgefahren und unser Problem konnte erstmal auf diese Weise gelöst werden. Ich begrüßte die Behörden, Makler, Besichtiger und Charterers Vertreter und wir gingen in meine Butze, um alles Weitere zu bekakeln und zu besabbeln. Mann, was war man froh nach jeder Problemlösung!
Der Chiefmate begann sofort mit dem Besichtiger seine Tour durch die Luken. Auch die Maschine ließ der Besichtiger nicht aus. Es war zwar schwer verständlich für uns, warum der Kiwi-Bauern-Vertreter sich nicht nur den Notgenerator vorführen lassen wollte, sondern sich sogar vom Chief auch noch die Kompressoren starten und vorzeigen ließ, genauso wie er den Sauberkeitszustand der Maschinenanlagen in seinem Besichtigungsblatt vermerkte. Mir berichtete der Besichtiger nach erfolgreicher (!) Besichtigung, dass er sehr erstaunt gewesen sei, dass wir so viele Ersatzgratings an Bord hätten. Das waren spezielle Bodenplatten aus wasserfestem Sperrholz, vierundzwanzig Millimeter dick, die eine große Anzahl Löcher für die Zirkulation der gekühlten Luft aufwiesen, auf denen in den Decks die Ladung stand. Die kalte Luft wurde mittels Gebläse von unten durch die Grätings gedrückt, durchströmte die Ladung – das war übrigens auch der Grund für die ausgestanzten Löcher in Bananen- und anderen Kisten – und gelangte im Luftstrom über der Ladung wieder zurück zu den Lüftern, die die Luft wieder durch den Wärmetauscher drückten. Wie ein Kühlschrank, bloß etwas größer. Diese Gratings hätte unser Vorgänger gar nicht vorrätig gehabt und musste sie für sehr viel Geld hier in Tauranga einkaufen, um seine Luken vorzubereiten. Indische Besatzung … Die Laderäume sollen bei denen ausgesehen haben wie Übungsplätze für Handgranaten, so elend war deren Zustand. Was musste denn das bloß für ein Eigner sein? Na, wir waren jedenfalls fein durch die Kontrolle geschlüpft, nur ein paar Nägel, die nicht zurückgeschlagen waren und nun durch einige Platten durchpikten, mussten wir kappen und dann konnte das Laden beginnen.
Aber eine kleine Hürde hielt der Flaggenstaat Liberia noch für mich bereit: Die Liberianische Sicherheitsinspektion hatte ihr Kommen angekündigt. Die kamen einmal jährlich und just das Jahr war nun um. Und ich war ja gerade auch da, nöch? Also kam noch so ein Stundenklauer und nervte mich mit Fragen, wollte Dokumente sehen, ließ sich Anlagen vorführen und checkte unsere Arbeits- und Wachsorganisation. Ich liebte es geradezu, wenn diese Leutchen kamen. Man hätte ja sonst zu viel Zeit gehabt. Übrigens hätte er, wenn denn das Boot im Davit gewesen wäre, ein Manöver sehen wollen, aber so war der Beweis ja schon schlüssig erbracht worden, dass das am vorherigen Tag bereits passiert war.
Auch die Leute der Werkstatt kamen verabredungsgemäß an Bord und beguckten sich unseren Windenschaden. Ja, meinte der Oberheini, da könnte man wohl was machen. Und da wir erst am folgenden Tag auslaufen sollten, stimmte er mich sehr zuversichtlich. Morgen wolle er mit den reparierten oder neuen Teilen zurück sein. Und solange bräuchten wir ja nun auch keinen Mobilkran, den höben wir uns bis zum Schluss auf, falls wir ihn denn überhaupt noch bräuchten. Denn falls die Werkstatt nicht in der Lage sein sollte, die Reparatur durchzuführen, müssten wir doch wenigstens das Boot wieder im Davit haben, sonst ließen die uns doch gar nicht aus dem Hafen raus. Runter für den einen Notfall ginge es ja immer, nur in unserem Falle dann nicht wieder gleich zurück. Also keine Übungen, falls die Winde nicht repariert werden konnte oder es länger dauern würde. Eine zeitliche begrenzte Ausnahmegenehmigung wäre sicherlich dafür sofort zu bekommen und würde uns eine gewisse Zeit Seefahrt genehmigen, wenigstens bis Europa.
Dann kam noch der Schiffshändler, der mich strahlend begrüßte, nicht nur, weil wir ihm einen dicken Auftrag verschafft hatten, sondern weil er mich wiedererkannte. Da war die Freude auf beiden Seiten groß. Feiner Macker. Hatte mir damals mehr als einmal geholfen und auch das Unmögliche möglich gemacht. Schön, dass er es mit uns und wir es wieder mit ihm zu tun hatten. Da konnte ich gleich meine Sonderwünsche loswerden. Er nahm mich am nächsten Vormittag mit in die Stadt, wo ich drei Stunden durch die Straßen schlenderte, in bekannte Shops einguckte und das eine oder andere einkaufte. In dieser winzigen Stadt zu spazieren war mir immer eine Freude und Erholung. Schön übersichtlich und geruhsam. Keine Wolkenkratzer säumten die Straßen, alles anheimelig und gemütlich. Ich genoss den Bummel durch Tauranga. Leider wurde es später ziemlich nieselig und wenn das so weiterginge, würden wir hier noch eine Verspätung wegen Regens kassieren. Denn dann könnte aus verständlichen Gründen nicht geladen werden. Wo die Kiwi-Bauern doch sowas von pingelig waren! In einer Kunstgalerie bekam ich auch noch die eine und andere Kleinigkeit, ehe ich mir ein Taxi rief, das mich innerhalb von zehn Minuten zurückbrachte.