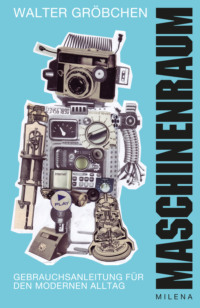Kitabı oku: «Maschinenraum», sayfa 2
HANDSHAKE MIT DEM GROSSEN BRUDER?
An einer potenziell hilfreichen App entzündet sich das Misstrauen der Staatsbürger. Ausgerechnet!
Extra noch mal nachgezählt: Ich habe aktuell 106 Apps auf meinem Smartphone installiert. Seit vorgestern eine mehr, aber dazu später. Von diesen Apps greift mehr als die Hälfte ungeniert auf mein Adressbuch oder meine Facebook-Freundesliste zu, schaltet nach Bedarf Kamera und Mikrofon ein, zeichnet meinen Standort auf, die Bewegungsdaten und den Browser-Verlauf. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich für mein Gewicht, den Pulsschlag und die Blutdruckwerte interessieren. Freilich kann man das Gros der Greifarme dieser Datenkraken ausschalten, aber die Werkseinstellung ist zunächst auf Neugier programmiert. Und nicht wenige Nutzer vergessen, den Auslieferungszustand nicht wörtlich zu nehmen und die entsprechenden Um- und Einstellungen vorzunehmen. Aus Bequemlichkeit, aus Schlendrian, aus Unwissen. Oder auch (oft gehört!), weil man »eh nichts zu verbergen« hat. Für Konzerne, deren Geschäftsmodell sich in Big-Data-Schürfrechten erschöpft, ein gefundenes Fressen. Dass generell kaum eine Applikation unseres digitalen Lebensstils den Implikationen der Datenschutzgrundverordnung genügt, ist Allgemeingut.
Umso erstaunter war ich, als in den letzten Tagen einer potenziell hilfreichen, ja lebensrettenden App besonderes Misstrauen und vorauseilender Hohn entgegenschlug. Sie wird vom Österreichischen Roten Kreuz angeboten, allein das sollte vertrauensstiftend sein. Die App, leger »Stopp Corona« benannt, ist dazu gedacht, den Verbreitungswegen des Virus auf die Schliche zu kommen. Und User zu warnen, wenn sie mit Menschen in Berührung waren, die später positiv getestet werden. Relativ unkompliziert, elegant und unbestechlich. Dass Nationalratspräsident Sobotka – ein Oberlehrer vor dem Herrn – vorschnell hinausposaunte, er spräche sich für eine verpflichtende Installation auf dem Handy jedes Staatsbürgers aus, war kontraproduktiv. Allein die Idee ließ unzählige Bedenkenträger und Querulanten hinter den Büschen hervorspringen. Dass Fachleute zwar forderten, den Quellcode (die DNA des Programms) offenzulegen und einige Details nachzuschärfen, sonst aber wenig Übles diagnostizierten, beruhigte die Gemüter kaum. Misstrauen rules OK. Nun denn: Teert mich, federt mich, sprecht Gebete und politische Bannflüche! Ich habe es getan. Ich habe die Corona-App runtergeladen.
Um sie zu testen. Sie macht eigentlich nichts anderes, als per digitalem »Handshake« auf Knopfdruck eine Art anonymisiertes Begegnungstagebuch anzulegen. Sollte ich eine Benachrichtigung erhalten, weiß ich, dass ich potenziell angesteckt wurde. Mehr nicht. Es werden weder meine Spaziergänge getrackt noch mein YouPorn-Konsum entlarvt, und es gibt auch, pardon!, keine Direktverbindung mit dem Führerbunker von Sebastian Kurz. Lästern mag man eventuell über die Finanzierung der App-Entwicklung durch einen Versicherungskonzern. Oder darüber, dass man einmal mehr einen eigenen Weg geht und nicht auf ähnliche, rückhaltlos transparente Konkurrenzprodukte im EU-Ausland setzt. Da wir freilich im Zeitalter des ritualisierten Misstrauens leben, solche Apps aber einer gewissen Verbreitung bedürfen, um zu funktionieren, ist das Ding leider schon tot. Derweil Covid-19 noch quicklebendig unter uns weilt.
WELTMASCHINE, HALT!
Allerorten wird ein Neustart beschworen. Sollte man nicht zuvor die Fahrtrichtung festlegen?
Was ich gelernt habe: dass einer Pandemie menschliche Meinungsverschiedenheiten egal sind, in ihrer Vorhersehbarkeit eventuell sogar todlangweilig. Wobei: Das harmlose Wort »Meinungsverschiedenheit« trifft es nicht ganz. Die Bannflüche, Justament-Standpunkte, Expertisen und Gegenexpertisen, die akut von allen verfügbaren Kanzeln im Glaubenskrieg des 21. Jahrhunderts verkündet werden, lassen die Vermutung zu, dass neben Covid-19 noch ein zweites Virus grassiert, das vorrangig Gehirnzellen angreift. Die einen orten es in Menschenschlangen, die erwartungsfroh vor Baumärkten in Reih’ und Glied stehen. Das sind eher die harmloseren Fälle. Die anderen ordnen es Kassandrarufern zu, die lautstark das dicke Ende kommen sehen, aber die Implikationen genauso verdrängen (müssen) wie ihre vermeintlichen Widersacher. Ich frage Sie: Sitzen wir nicht alle im selben Boot? Es leckt gewaltig, so viel ist sicher.
Was ich noch gelernt habe: Der Götze unserer Zeit ist »die Wirtschaft« – etwas, das ich bislang für ein eher banales Mittel zum Zweck hielt. »Ziel der Wirtschaft«, schlage ich umgehend in Gablers Wirtschaftslexikon nach, »ist die Sicherstellung des Lebensunterhalts und, in ihrer kapitalistischen Form, die Maximierung von Gewinn und Lust mithilfe unternehmerischer Freiheit, zugleich die Erzeugung von Abhängigkeit, ob von Anbietern oder Produkten, bis zum – nicht unbedingt gewünschten, aber erwartbaren – Kollaps des Systems.« Na bitt’-schön. Das klingt jedenfalls nicht nach einem Werbefuzzi der Wirtschaftskammer. Wenn der Kollaps eines Systems »erwartbar« ist – und man muss jetzt weder Bill Gates, den Club of Rome, Naomi Klein oder Greta Thunberg bemühen –, dann sollten wir den Warnschuss, den die Menschheit gerade abbekommen hat, doch nicht ungehört verhallen lassen. Sofern man überhaupt an einen glücklichen Ausgang der Geschichte glaubt. Wenn die Wiedergeburt eines schwer rekonvaleszenten Patienten darin besteht, dass er in den nächsten Konsumtaumel verfällt, darf man ruhig daran (ver)zweifeln. Aber vielleicht hilft ja frisch geernteter Spargel mit Schmierspuren virulenter Profitgier über die nächste Depression.
Was ich weiters gelernt habe: Menschen lösen sich nicht von ihren kleinlichen Problemchen, Psycho-Defiziten und Sichtweisen, selbst wenn ringsum die Welt untergeht. Zu wenig persönlicher Freiraum beim strikt lebensnotwendigen Fitnesslauf im Schlosspark? Skandal! Unvollständig ausgefüllte Formulare im Kampf mit der Krisen-Bürokratie? Abmahnung! Immer noch Autos, die in den weithin leeren Begegnungszonen der Gegenwart unterwegs sind? Sofort das Waffenrad gesattelt! Selbst die Warnrufe der ewigen Kämpfer für das Wahre, Gute, Schöne (und die perfekte Demokratie sowieso) bekommen mitunter einen schneidenden Ton. Das Falter-Abo bleibt trotzdem aufrecht!
Was ich nicht gelernt, aber geträumt habe: dass Gsellmanns Weltmaschine – bitte googlen, wenn Ihnen das gar nichts sagt – das perfekte Kunstwerk und Sinnbild für unser Dasein ist. Die Maschine läuft nie rund, man kennt ihren Zweck nicht, ihr Erbauer hat sich längst absentiert. Sie produziert auch nichts. Aber das Ding lässt uns ahnen, dass jemand einst einen Plan hatte. Er ist verloren gegangen.
ALLTAG
»Jede hinreichend fortschrittliche Magie ist von Technologie nicht zu unterscheiden.«
Arthur C. Clarke
»Wenn ich die Folgen geahnt hätte, wäre ich Uhrmacher geworden.«
Albert Einstein
»Die verdammte Technik verändert unser aller Leben, fragt uns aber nie, ob sie das darf. Ich prangere das an.«
Vanessa Wieser
CAT CONTENT
Heute kauft man nicht mehr die Katze im Sack, sondern im Internet. Oder besser auch nicht.
Und nun, um mit Monty Python zu sprechen, zu etwas ganz anderem. Ich weiß nicht wirklich, ob die Geschichte eine Ente ist, wiewohl sie von einer Katze handelt, aber: selten so gelacht. Diese Woche fand sich in Österreichs Zeitungslandschaft – off- und online, Zeitungen bestehen ja nur noch bedingt aus Papier – flächendeckend die Meldung von einem Internet-Betrugsfall. Einem der herzzerreißenden Sorte. Samt allen Ingredienzien für eine Story, aus der jeder wirklich populistische Schlagzeilen-Texter eine Stadt und Land aufwühlende Titelgeschichte gemacht hätte.
Die Geschichte geht so: Eine junge Frau aus Thalgau bei Salzburg beschließt, sich ein Haustier zuzulegen. Sie geht im Internet auf die Suche und findet eine Adresse, wo eine »britische Kurzhaarkatze« angeboten wird. Auf ihre E-Mail-Anfrage, wie sie denn zu der Mieze komme und zu welchem Preis, folgt postwendend der Hinweis, die Katze selbst koste nichts, aber für den Transport aus Kamerun müsse sie ein Flugticket übernehmen. Das aber sei – Hauskatzen sind ja keine Königstiger – mit 100 Euro recht günstig. Die potenzielle Besitzerin willigt ein. Dann aber folgen, man ahnt es bereits, weitere Depeschen, Botschaften und Hinweise aus Afrika. Es seien noch diese und jene kleinen Beträge für Versicherung, Impfungen, EU-Pass, Quarantäneaufenthalte, Transportkisten und »gewisse Papiere« (so die APA) auszulegen. Das Geld werde aber gewiss zurückerstattet. Und sodann alles hurtig klappen wie versprochen.
Nun: Nach insgesamt dreiundzwanzig (!) Überweisungen ist die junge Salzburgerin insgesamt 22.051 Euro los. Aber die Katze immer noch nicht da. Schließlich nimmt sich – die Dame war nun doch allmählich stutzig geworden – die Polizei der Sache an. Ich fürchte, mit wenig durchschlagendem Erfolg.
Ein Lehrstück über die unwägbaren Gefahren des dunklen Kontinents Internet? Oder doch eher Stoff für eine Tragikomödie über die ewige Schwachstelle Mensch? Entscheiden Sie selbst. Wenn Sie in den Leserforen der Presse nachgraben – einige Kommentare zu dieser Story sind wirklich zum Zerkugeln. Ein gewisser »Fidel Gastro« etwa meint da trocken: »Die Katze kam nie an: ein weiteres Argument für den verstärkten Ausbau von Glasfaserleitungen.« Andere zitieren Einstein (»Die Dummheit des Menschen und das Universum sind unendlich. Nur beim Universum bin ich mir nicht so sicher.«). Oder schlagen gar eine gerichtlich bestellte Sachwalterin für die Katzennärrin vor.
Ich sage nur: Wäre das World Wide Web eine bessere Welt als die reale, hätte ihr schon ein Facebook-Freund eine lebendige, miauende Trostspenderin überreicht. Gratis.
KURSZIEL SKLAVENFABRIK
Apple hat an der Börse mittlerweile sogar Microsoft überholt. Aber es gibt nicht nur Gewinner.
Ich bereue ja nicht allzu viel in meinem bisherigen Leben. Aber wirklich, pardon!, in den Arsch beißen könnte ich mich für die fatale Unterlassung, ein paar Euro in Aktien der Firma Apple Inc. gesteckt zu haben. Etwa am 25. April 2003, da kostete so ein Anteilsschein gerade mal 5 Euro 90 Cent. Und ich sagte dem Unternehmen zu diesem Zeitpunkt – als früher Besitzer eines iPods und wohlbestallter Berater internationaler Musikkonzerne (die Schnittmenge war lange erstaunlich gering) – durchaus eine güldene Zukunft voraus.
Knapp sieben Jahre später steht der Apple-Aktienkurs bei über 200 Euro, Experten von Credit Suisse sagen gar ein Kursziel bei 300 Dollar voraus. Das Wunderding namens iPad, seit dieser Woche auch in Deutschland auf dem Markt (Österreich folgt wohl spätestens im Herbst), befeuert die Fantasien, die Börsen verhielten sich wie isländische Vulkane. Seit 2004 legte die Apple-Aktie um über 2300 Prozent (!) zu, die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei gut 222 Milliarden Dollar, 40 von 44 bei Bloomberg gelisteten Analysten empfehlen nach wie vor den Kauf des Wertpapiers. Und, wer hätte das noch Mitte der Neunzigerjahre für möglich gehalten, Steve Jobs hat damit Bill Gates überholt. Der Börsenwert von Apple liegt erstmals vor jenem von Microsoft.
Aber es ist, wie’s ist: Das Aktiengeschäft ist mir fremd. Ich habe schnarchlangweilige Bausparverträge und Lebensversicherungen in der Schublade. Die Chance aus, sagen wir, 10.000 Euro ein Vermögen zu machen (nach Adam Riese fast 340.000 Euro, wenn ich den Betrag 2003 investiert hätte), ist passé. Pessimisten meinen, ewig werde der Aufwärtstrend wohl nicht anhalten. Sie haben zwangsläufig recht. Irgendwann. Letztendlich immer. Eventuell schon bald.
Und es gibt, bei allem Respekt vor der Apfel-Weltdominanz, auch bittere Aspekte. Umstände, die einem die Freude am neuen iMac oder am glänzenden iPhone ordentlich vermiesen können, vom Aktienkurs ganz zu schweigen. Denn gebaut werden viele der eleganten Gerätschaften in China, unter – man muss es so deutlich sagen – dreckigsten, menschenunwürdigen Umständen. Die Firma Foxconn in Shenzen, einer der Dienstleister von Apples Gnaden, kam dieser Tage einmal mehr durch Selbstmorde von Arbeitern ins Gerede. Es sind Hunderttausende, die in den Foxconn-Fabriken leben, schlafen, rund um die Uhr malochen. Und bisweilen den Druck nicht mehr ertragen.
Nebstbei: Auch Sony, Hewlett-Packard und Nokia bedienen sich dieser modernen Billiglohn-Sklaven. Es gibt keine Gewinner ohne Verlierer.
KÜHLE ENTSCHEIDUNG
Die Energieeffizienzklassen von Kühlschränken lassen Konsumentenschützer nicht kalt.
Die Hundstage machen ihrem Namen alle Ehre. Man musste nicht zum Video des gleichnamigen Films von Ulrich Seidl – einem der brachialsten Meisterwerke heimischen Kinoschaffens – greifen, um die letzten Tage über richtig ins Schwitzen zu geraten. Mediziner raten in solchen Situationen zu reichlicher Wasserzufuhr, eventuell auch zum Genuss lauwarmer Beruhigungstees. Sicher aber nicht zu eiskalten Getränken (eventuell gar mit Alkoholanteilen), die man literweise in sich hineingurgelt. Der Gang zum Eisschrank war und ist dennoch eine der meistunternommenen Wallfahrten der Jetzt-Zeit.
Blöd, wenn denn die selig machende Maschinerie einmal ausfällt. Rasch, ein neuer Kühlschrank her! Die Prospekte der Elektronikketten quellen ja über vor Angeboten. Wie aber eine vernünftige Wahl treffen? Oberflächlich schauen die Geräte, sieht man von ihrem Volumen und – in höheren Preisklassen – polierten Edelstahl-Fronten oder Retro-Designanklängen ab, alle ziemlich gleich aus. Okay, einige spenden Eiswürfel, protzen mit »No Frost«-Automatik (die das Abtauen erspart), LCD-Displays und LED-Beleuchtung. Aber letztlich sind es alle plumpe Kästen, die ordentlich Strom verschlingen. Dabei gibt es ja kaum noch Geräte in den Geschäften, die nicht mindestens die Energieeffizienzklasse »A« besitzen. Bestens, denkt man sich, und greift zu.
Der Trick ist: »A« ist eher B oder C. Oder gar D. Jedenfalls nicht gerade auf dem neuesten Stand der Technik. Da müsste man schon auf »A+« oder »A++« bestehen. Seit Ende 2010 gibt es sogar »A+++«-Kühlschränke. Das vermeintliche »A«-Klasse-Schnäppchen mit dem grünen Balken könnte sich also auf lange Frist als teurer Stromfresser entpuppen – und einmal mehr ein Sparefroh in einem einkommensschwachen Haushalt als gelackmeierter Naivling. »A+++« verbraucht im Vergleich zum schlichten »A« im Schnitt 60 Prozent weniger an Energie (also bis zu 200 kWh), ist aber in den meisten Märkten nicht zu finden. Dafür stehen dort zunehmend protzige »Side-by-Side«-Kombinationen mit Flügeltüren, mit denen man ganze Fußballmannschaften versorgen könnte. Für den Normalkonsumenten sind sie überdimensioniert, aber dennoch schwer in Mode.
Warum die Energieeffizienzklassen nicht schon längst den Erfordernissen von heute angepasst wurden (etwa indem man Triple A zur neuen Benchmark erklärt, und alles darunter deutlich abstuft), müssen uns die Marketing-Kapazunder von Bauknecht, Bosch, Miele, Gorenje & Co. demnächst erklären. Aber vielleicht fallen die ja selbst auf denselben Schmäh rein wie Wertpapierexperten, die vermeintliche Triple-A-Schuldner nicht mehr von jenen mit Ramsch-Status unterscheiden können. Oder wollen.
HEISSER HASE, SCHWARZER STECKEN
Nach dem Smartphone wird nun auch die Steckdose intelligent. Wo steuern wir hin?
Apps, Apps, Apps. Mittlerweile beherrschen die smarten kleinen Programme mit den zuckerlbunten Logos unseren Alltag. Diese spielerische Form der Darreichung von »Anwendungsprogrammen«, also zweckdienlicher Software für den Hausgebrauch, scheint der Multitasking-Unwilligkeit (eventuell auch -Unfähigkeit), die offenbar in uns allen steckt, enorm entgegenzukommen. »One pill makes you larger / and one pill makes you small«, sangen schon Jefferson Airplane in ihrer Sixties-Hymne »White Rabbit«. Die meinten damit zwar Lysergsäurediethylamid und andere Drogen, aber allzu fern sind auch die digitalen Beruhigungspillen für den Durchschnittsnerd nicht.
Man sollte keineswegs den Fehler machen, die Miniatur-Programme zu unterschätzen. Ihre Mächtigkeit und Universalität erschließen sich oft erst in Verbindung mit Hardware, der sie – vorzugsweise gesteuert via iOS- oder Android-Smartphone – sanft ihren Willen aufzwingen. Gibt es überhaupt noch Menschen da draußen, die z. B. »normale« Fernbedienungen benutzen? Gewiss, eine überspitzte rhetorische Frage. Noch. Denn demnächst wird man wohl auch die Temperatur des Badewassers, den Stromverbrauch des Kühlschranks oder die Messung der durchschnittlichen Schnarch-Dauer und -Intensität des Lebensabschnittspartners über eine App kontrollieren.
Wie das? »QGate«, die Entwicklung eines österreichischen Start-up-Unternehmens, hat zu diesem Zweck eine »schlaue Steckdose« mit integrierter Funkanbindung (868 MHz) entwickelt, die mit einem Energiemesser, einem Helligkeits- und Temperatursensor, einem Mikrofon und einer eigenen SIM-Card ausgestattet ist. Das Ding lässt sich via Mobiltelefon von überall auf diesem Planeten an- und ausschalten. Und sogenannte »QApps« – clevererweise lässt man die Entwicklerumgebung für jeden Hobbyprogrammierer offen – sagen dann dem Zwischenstecker, was er genau tun oder lassen soll. Fehlt nur noch ein fernsteuerbarer Roboterarm.
Von einem »Schweizer Messer der digitalen Nomaden« spricht denn auch »QGate«-Erfinder Martin Buber. Dann noch ein »On/Off«-Schalter für das, was wir Realität nennen, und eine Instant-App für Glück, Geld und Schnarchfreiheit – und er ist ein gemachter Mann.
FITNESS HIJACKING
Bitte verpassen Sie Ihrem inneren Schweinehund einen digitalen Maulkorb!
Ich gestehe: Ich habe Ungehöriges getan. Aber es war nicht bös gemeint. Ich dachte, wer mich kennt, wird mir das sowieso nie glauben. Und den Witz an der Sache umgehend erkennen. Wie immer aber, wenn im Netz Ironie ins Spiel kommt, wird man missverstanden. Und nicht gerade wenige meiner Facebook-Freunde haben eine meiner Statusmeldungen der letzten Tage für bare Münze genommen. Die Meldung nämlich, ich sei 15,6 Kilometer gelaufen. Und zwar in knapp zwei Stunden. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 7:42 Minuten pro Kilometer. Und einem Energieverbrauch von 1323 Kilokalorien.
Die Wahrheit ist: Diese Strecke – sie ist kartografisch irgendwo zwischen Maria Enzersdorf und Brunn am Gebirge angesiedelt – ist jemand anderer gelaufen. Ich Spaßvogel habe einfach die Statusmeldung seines Runtastic-Accounts per Copy & Paste ausgeschnitten und in meine Timeline übertragen. Und darf damit taxfrei als Erfinder der neuen Social-Media-Kategorie »Fitness-Hijacking« gelten. Einige Freunde gratulierten umgehend zu meinen sportlichen Aktivitäten, andere erklärten Zeit, Strecke und Kalorienverbrauch für verbesserungsfähig. Ich gestehe abermals: Zuerst lächelte ich still in mich hinein, weil ich nun, ohne einen einzigen Schweißtropfen vergossen zu haben, als halbwegs fitter Zeitgenosse galt. Endlich konnte ich mich einreihen in die wachsende Liste jener Sportskanonen, die dem Rest der Welt ungefragt ihre Laufstrecken und Rundenzeiten mitteilen. Und sich gegenseitig übertrumpfen in den Fußstapfen von Emil Zatopek. Dann aber kam mir der Originalinhaber der tolldreist gekaperten Runtastic-Werte auf die Schliche. Und in die Quere. Er meinte – vollkommen zu Recht übrigens –, ich solle meine Scherze doch mit jemand anderem treiben, aber nicht mit ihm. Ehrenwort, kommt nicht wieder vor!
Dabei ist die Instant-Fitness-Dokumentation die positive Seite eines generellen Online-Exhibitionismus, die zwischen lässlicher Eitelkeit und bedrückenden Einblicken in die Intimsphäre Fremder oszilliert. All die Pulsuhren, Fettanalyse-Waagen, Activity Tracker und Körpervermessungsinstrumente gieren als »Smart Meters« ja förmlich danach, nicht nur ihrem Besitzer Einblick in seinen Gesundheitszustand zu geben, sondern das auch gleich dem gesamten digitalen Universum mitzuteilen. Und ehrlich gesagt, das will und muss ich nun wirklich nicht wissen (und schon gar nicht augenblicklich), dass Ihr Blutdruck mit dem Lesen dieser Kolumne bedenklich angestiegen ist.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.