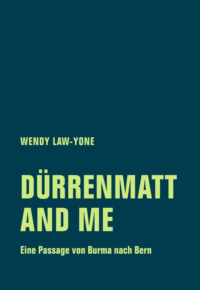Kitabı oku: «Dürrenmatt and me»

Wendy Law-Yone
DÜRRENMATT UND ICH
Eine Passage von Burma nach Bern
DÜRRENMATT AND ME
A Passage from Burma to Berne
Aus dem Englischen von Johanna von Koppenfels
Mit einem Nachwort von Marijke Denger
Texte zur Friedrich Dürrenmatt Gastprofessur
für Weltliteratur
Herausgegeben von Oliver Lubrich

Die burmesisch-amerikanische Autorin Wendy Law-Yone beschreibt in diesem Buch, wie wichtig für sie und ihr Schaffen die Begegnung mit der deutschen Sprache und dem Werk Friedrich Dürrenmatts gewesen ist. Über die deutsche Sprache kam sie zum Schreiben. Beeindruckt von Dürrenmatts Tragikomödie »Der Besuch der alten Dame«, beschäftigte sie, die von der Militärdiktatur aus ihrem Land vertrieben wurde, sich insbesondere mit dem Thema der Rache. Ihr Bericht ist sehr persönlich, offen und heiter.
Dieser Band präsentiert einem deutschsprachigen Publikum erstmals ein Werk einer postkolonialen Autorin, die im englischsprachigen Raum bereits eine anerkannte Größe ist.
Wendy Law-Yone wurde 1947 in Mandalay, Burma, geboren und wuchs in der damaligen Hauptstadt Rangun auf. Ihr Vater gründete 1948 die erste englischsprachige Zeitung nach der Unabhängigkeit des Landes. Sie wurde in Folge des Militärputschs 1962 aufgelöst, Law-Yone als Herausgeber verhaftet. Auch Wendy Law-Yone wurde inhaftiert, konnte 1967 jedoch ausreisen, zuerst nach Thailand und später in die USA. Dort studierte sie, arbeitete als Journalistin und publizierte ihre ersten Romane, »The Coffin Tree« (1983) und »Irrawaddy Tango« (1993). 2002 übersiedelte sie nach Großbritannien, wo 2010 ihr dritter Roman, »The Road to Wanting«, erschien. 2013 folgte »Golden Parasol: A Daughter’s Memoir of Burma«. Wendy Law-Yone lebt heute in London und in der Provence.
INHALT
Von Bern nach Burma und zurück
Wendy Law-Yone, Friedrich Dürrenmatt und Weltliteratur
Oliver Lubrich
From Berne to Burma and Back
Wendy Law-Yone, Friedrich Dürrenmatt, and World Literature
Oliver Lubrich
Dürrenmatt und ich
Eine Passage von Burma nach Bern
Wendy Law-Yone
Dürrenmatt and Me
A Passage from Burma to Berne
Wendy Law-Yone
Wendy Law-Yone und die burmesische ›Nation‹: Veränderungen (be)schreiben
Marijke Denger
Wendy Law-Yone and the Burmese ‘Nation’: Writing (About) Change
Marijke Denger
Bibliographie Wendy Law-Yone
Biographien
Förderer
For Phyllis Richman, through passage after passage.
Von Bern nach Burma und zurück
Wendy Law-Yone, Friedrich Dürrenmatt und Weltliteratur
Oliver Lubrich
Von Burma nach Bern führte Wendy Law-Yones Weg, und Friedrich Dürrenmatt spielte dabei eine besondere Rolle. So berichtet die burmesische Autorin in diesem Buch.
Geboren 1947 in Mandalay, in Zentral-Burma, wuchs Wendy Law-Yone als Tochter eines unabhängigen Journalisten auf, Edward Law-Yone (1911–1980), Gründer und Verleger der Zeitung The Nation. Ihm widmete sie ihre Memoiren, Golden Parasol: A Daughter’s Memoir of Burma (2013). Als nach dem Militärputsch in ihrer Heimat (1962) ihr Vater verhaftet und sie selbst am Studium gehindert wurde, lernte Wendy Law-Yone Deutsch. »Um mich herum herrschte das Chaos«, erinnert sie sich, »aber die deutsche Sprache gab mir Struktur«. Als die Bibliothek des Goethe-Instituts in Rangun aufgelöst wurde und sie dabei half, die Bücher einzupacken, entdeckte sie Friedrich Dürrenmatt.
Nach ihrer Flucht aus Burma schrieb Law-Yone einen Essay über Dürrenmatt, der ihr die Türen einer Universität in den USA öffnete. Als Abschlussarbeit reichte sie einen Entwurf ihres ersten Romans ein, The Coffin Tree (1983). Als Antwort auf Dürrenmatts Theaterstück Der Besuch der alten Dame (1956) konzipierte sie ihren zweiten Roman, Irrawaddy Tango (1993), der von der Heimkehr und Rache einer Vertriebenen erzählt, die einst die Geliebte des Herrschers war. Die deutsche Sprache und Dürrenmatts Literatur werden bei Wendy Law-Yone zu einer politischen und existentiellen Metapher. Sie stehen für die Auseinandersetzung mit Burma, seiner Geschichte und seiner Diktatur.
Im Herbstsemester 2015 kam Wendy Law-Yone als Friedrich Dürrenmatt Gastprofessorin für Weltliteratur an die Universität Bern – in den Heimatkanton des Schweizer Schriftstellers. Hier unterrichtete sie ein wöchentliches Seminar zur asiatischen Gegenwartsliteratur: »Explosive Transformation: Globalisation and its Discontents in Asian Fiction«. Auf dem Programm standen Romane von Aravind Adiga aus Indien (The White Tiger), Mohsin Hamid aus Pakistan (How to Get Filthy Rich in Rising Asia), Yu Hua aus China (The Seventh Day) und Wendy Law-Yone selbst (The Road to Wanting), dazu Kurzgeschichten unter anderem von Krys Lee aus Korea und Prajwal Parajuly aus Nepal. In einem Doktoranden-Workshop mit dem Titel »The Road to Wanting: a Zomian Journey« führte Law-Yone Berner Promovierende anhand ihres Romans The Road to Wanting (2010) in das burmesisch-chinesische Grenzgebiet. Die Autorin setzt sich für die Rechte ethnischer Minderheiten ein und kritisiert öffentlich die Behandlung der muslimischen Rohingya. Neben ihrem Seminar und dem Doktoranden-Workshop an der Universität hielt Wendy Law-Yone in Bern, Basel, Biel, Zofingen und Zürich öffentliche Vorträge, sie gab Lesungen und nahm an Diskussionen teil.
Die Friedrich Dürrenmatt Gastprofessur für Weltliteratur wurde 2013 an der Universität Bern eingerichtet, um Literatur »aus erster Hand« zu vermitteln, durch internationale AutorInnen. Es geht dabei weder um »Kreatives Schreiben« noch um »Poetikvorlesungen«. Die Gäste unterrichten ein Thema ihrer Wahl in einer Form ihrer Wahl. So ergeben sich neue Inhalte im Lehrprogramm, wie sie von den Dozierenden sonst nicht angeboten werden. Und es entstehen neue Formate des Unterrichts in einem kreativen Freiraum abseits von »Bologna-Reform«, »Modularisierung« und »Obligatorien«. Joanna Bator aus Wałbrzych zum Beispiel gab einen Kurs über »Unheimliche Orte« und lud die TeilnehmerInnen ein, solche in Bern selbst zu erkunden. Juan Gabriel Vásquez aus Bogotá diskutierte seine Ideen von der »DNA« des Romans nicht nur mit seinen Studierenden, sondern auch mit internationalen Kollegen, die im Seminarraum per Skype zugeschaltet wurden – etwa Javier Cercas aus Madrid. David Wagner aus Berlin lehrte die Kunst der »Promenadologie« – mit Walter Benjamin und Robert Walser und mit »ambulanten Referaten«. Es ging darum, das Eigene mit fremdem Blick neu sehen zu lernen.
Friedrich Dürrenmatt wurde 1921 in Konolfingen im Kanton Bern geboren. Er studierte an der Universität Bern. Der Name Dürrenmatt steht für eine Weltliteratur aus Bern. Von Wendy Law-Yone erfahren wir, dass Dürrenmatts Literatur bis nach Burma gelangte und dort eine neue Bedeutung bekam. Die nach ihm benannte Gastprofessur kehrt Dürrenmatt um. Sie bringt Weltliteratur nach Bern. Ihre Inhaber kamen bislang aus Deutschland, Polen, Haiti, Kuba, dem Kongo, Kolumbien, Dänemark, China, der Türkei, Israel und Frankreich sowie aus der Schweiz. Und nicht zuletzt aus Mandalay beziehungsweise aus Rangun in Burma.
Die Friedrich Dürrenmatt Gastprofessur für Weltliteratur wurde geschaffen mit großzügiger Unterstützung durch die Stiftung Mercator Schweiz, und sie wurde verstetigt mit Hilfe der Burgergemeinde Bern. Der vorliegende Band wurde verwirklicht mit einer Förderung durch die Stiftung Pro Scientia et Arte. Im Projektteam mitgewirkt haben Thomas Nehrlich, Delia Imboden, Vera Jordi, Elena Bertagna und Livia Notter, Petra Riedweg, Michael Toggweiler, Ariane Lorke, Gabriel Rosenberg und Viviane Blanchard sowie Manuela Rossini.
From Berne to Burma and Back
Wendy Law-Yone, Friedrich Dürrenmatt, and World Literature
Oliver Lubrich
Wendy Law-Yone’s journey led from Burma to Berne, and Friedrich Dürrenmatt accompanied her on it. This is what the Burmese author tells us in this book.
Born in Mandalay, central Burma, in 1947, Wendy Law-Yone grew up as the daughter of the independent journalist Edward Law-Yone (1911–1980), founder and publisher of the daily newspaper The Nation. Her memoir, Golden Parasol: A Daughter’s Memoir of Burma (2013), is a tribute to her father’s legacy, professional and familial. It was after the military coup in 1962, when her father was imprisoned and she was barred from higher education, that Law-Yone first learned German. ‘All around me was chaos,’ she remembers, ‘but the German language gave me a structure.’ When the library of the Goethe Institute in Rangoon closed and she helped pack the books, she discovered Friedrich Dürrenmatt.
Following her flight from Burma, Law-Yone wrote an essay on Dürrenmatt that helped open the doors to a university in the USA. She graduated with an honours degree, submitting for her thesis an early version of what would become her first novel, The Coffin Tree (1983). Her second novel, Irrawaddy Tango (1993), was a response to Dürrenmatt’s play, The Visit (1956), and centres on the return and revenge of an exiled woman who was once the dictator’s lover. In Wendy Law-Yone’s life and work, the German language and Dürrenmatt’s writing form a political and existential metaphor. They represent her engagement with Burma, its history and its dictatorship.
In the fall term of 2015, Wendy Law-Yone was the Friedrich Dürrenmatt Guest Professor for World Literature at the University of Berne, in the home canton of Switzerland’s celebrated writer. She taught a weekly seminar on contemporary Asian literature, ‘Explosive Transformation: Globalisation and its Discontents in Asian Fiction’. The syllabus featured novels by Aravind Adiga from India (The White Tiger), Mohsin Hamid from Pakistan (How to Get Filthy Rich in Rising Asia), Yu Hua from China (The Seventh Day), and her own work (The Road to Wanting), in addition to short stories by Krys Lee from Korea and Prajwal Parajuly from Nepal, and others. In a workshop entitled ‘The Road to Wanting: a Zomian Journey’, Law-Yone took a group of doctoral students on an imaginary voyage to the border region between Burma and China, using her novel The Road to Wanting (2010) as a guidebook. The writer advocates the rights of ethnic minorities and publicly criticizes the treatment of the Muslim Rohingya. In addition to her seminar and the PhD workshop at the University, Law-Yone gave public lectures and readings and took part in discussions in Berne, Basle, Biel, Zofingen and Zurich.
The Friedrich Dürrenmatt Chair for World Literature was established at the University of Berne in 2013. Its goal is to convey literature ‘firsthand’, with international authors as teachers. The programme is neither ‘Creative Writing’ nor ‘Lectures in Poetics’. Rather, the guest professors teach a topic of their choice in a form of their choice. Their curricula feature new content not ordinarily offered by academic scholars. The introduction of experimental forms of teaching in an open space of creativity are an attempt to counterbalance the ever more bureaucratic course of studies. Joanna Bator from Wałbrzych, for example, held a class on ‘Uncanny Places’, and encouraged her students to explore those in Berne. Juan Gabriel Vásquez from Bogotá discussed his theories about the ‘DNA’ of the novel with his students and with international colleagues—among them Javier Cercas from Madrid, via Skype conference calls. David Wagner from Berlin taught the art of ‘promenadology’ as practiced by Walter Benjamin and Robert Walser, in the old town and the hills of Berne. The aim was ‘to look at the familiar with the gaze of the foreigner’.
Friedrich Dürrenmatt was born in Konolfingen in the canton of Berne in 1921. He studied at the University of Berne. The name Dürrenmatt thus stands for world literature from Berne.
Wendy Law-Yone proves that Dürrenmatt’s literature travelled all the way to Burma and took on new meaning there. The guest professorship named after him acknowledges Dürrenmatt’s reach in reverse, bringing world literature to Berne. The authors have come from Germany, Poland, Haiti, Cuba, Congo, Colombia, Denmark, China, Turkey, Israel, and France as well as from Switzerland. And from Rangoon, Burma.
The Friedrich Dürrenmatt Guest Professorship for World Literature was created with the generous support of the Mercator Foundation Switzerland and with the Burger Community Berne. This book was made possible thanks to the Pro Scientia et Arte Foundation. Thomas Nehrlich, Delia Imboden, Vera Jordi, Elena Bertagna, Livia Notter, Petra Riedweg, Michael Toggweiler, Ariane Lorke, Gabriel Rosenberg, Viviane Blanchard, and Manuela Rossini have contributed to the project since 2013.
Dürrenmatt und ich
Eine Passage von Burma nach Bern
Wendy Law-Yone
Es war mein erster offizieller Auftritt, und ich war spät dran. Oliver Lubrich, der Programmdirektor und Gastgeber des Abends, wartete draußen auf den Stufen des Universitätsgebäudes, einer beeindruckenden neobarocken Villa, die mich innehalten ließ. Aber jetzt war keine Zeit zum Trödeln. Halb rennend hastete ich über den Rasen, atemlos und eine Entschuldigung murmelnd. Doch Oliver Lubrich empfing mich ohne ein tadelndes Wort, obwohl er, während er mich hineingeleitete, scherzend bemerkte, er habe gerade begonnen sich zu fragen, wer als Ersatzredner für mich in Frage käme …
Unter prachtvollen hohen Decken durchschritten wir die Eingangshalle: vergoldeter Stuck und Gesimse, bemalte Wände, allegorische Friese, eine Marmortreppe … Der Hörsaal befand sich im Obergeschoss, und einen Moment lang wollte ich im Boden versinken, als mir klar wurde, dass ich etwa 30 Leute hatte warten lassen, die alle ruhig dasaßen. Auf eine Wand des eleganten Konferenzsaals waren zwei Bilder nebeneinander projiziert: eines von Rangun und eines von Bern. Ich hatte das Farbfoto von Rangun ausgewählt. Es zeigte eine typische Innenstadtstraße mit ihrem Gewirr aus elektrischen Leitungen, die wie Girlanden vor den oberen Etagen der Gebäude hingen. Das Bild von Bern war eine typische Aufnahme der Altstadt: Arkaden aus beigegrünem Stein und bunt flatternde Fahnen, die auf einen Uhrenturm zuliefen. Auch hier waren dünne Kabel über die Straße gespannt: aber symmetrisch, fast unsichtbar – für die Straßenbahn.
»Heute Abend zu Ihnen sprechen zu dürfen, ist mehr als eine große Ehre für mich«, lauteten meine ersten Worte, nach den formellen Einführungen.
Natürlich war es schon eine Ehre für mich, als Schriftstellerin, die in Burma geboren und aufgewachsen war, eine Antrittsrede an der Universität Bern zu halten. Aber die Friedrich Dürrenmatt Gastprofessur für Weltliteratur innezuhaben war mehr, weit mehr als eine Ehre. Denn was die Auswahlkommission, die für meine Berufung zuständig gewesen war, nicht wusste, und was ich nun verriet, war die Tatsache, dass ich eine ganz besondere, fast intime Beziehung zu dem Mann gehabt hatte, nach dem meine Professur benannt war. Mein Verhältnis zu Herrn Dürrenmatt war in der Tat so einzigartig, so verschwiegen, dass der große Mann bis zu seinem Tod nie etwas davon erfuhr.
Ein leichtes, höfliches Lachen kam aus dem Publikum. Ein geheimer Seufzer der Erleichterung von meiner Seite. Jetzt brauchte ich nur noch in der folgenden Stunde die Episoden meiner Reise von Burma, meinem Geburtsort, nach Bern, in den Heimatkanton Friedrich Dürrenmatts, meines postumen Wohltäters, wenn es einen solchen Ausdruck gibt, zu erzählen.
Was nun im ersten Teil folgt, ist eine ausführliche Fassung meiner Eröffnungsrede vom September 2015.
Teil zwei ist eine entsprechende Ausführung meiner Abschiedsrede vom Dezember 2015.
1. Burma
Ich begegnete Friedrich Dürrenmatt das erste Mal in meiner Teenagerzeit – mit 17 Jahren, um genau zu sein. Damals wohnte ich noch zu Hause, und zu Hause, das war Rangun, in Burma. In jenen dunklen Tagen Mitte der 1960er Jahre, zu Beginn der Militärdiktatur, hatte sich mein Zuhause in so etwas wie eine Sackgasse verwandelt. Dies war nicht – oder nicht nur – eine Redensart, sondern beschrieb auch buchstäblich die Lage unseres Hauses.
Um zur University Avenue 116 B zu gelangen, bog man von einer lauten Durchgangsstraße in eine von Bäumen beschattete Wohnstraße ein, die zu einem See führte. Es handelte sich um den Inya See, den gepflegten Ruhepol der Stadt, und unser Haus befand sich am Ende der Straße, direkt am Wasser.
Aber dies war nicht die einzige Sackgasse, in die ich zu dieser Zeit geraten war, als ich das erste Mal mit Herrn Dürrenmatt in Berührung kam.
Eines Morgens im März 1963, um drei Uhr in der Frühe, kam ein Konvoi, der aus einem Kleintransporter, einem Militärjeep und einer LKW-Ladung uniformierter Männer mit Automatikgewehren bestand, unsere Auffahrt herauf und umzingelte unser Haus. Es muss ein außergewöhnlich leises Manöver gewesen sein, denn die einzige, die davon geweckt wurde, war meine Mutter, die in der Familie den leichtesten Schlaf hatte. Sie weckte dann meinen Vater, der immer ganz fest schlief.
Mein Vater stand auf und hantierte, noch schlaftrunken, am Schloss des großen eisernen Tores vor unserer Veranda herum, um einen jungen Offizier eintreten zu lassen. »Gehen wir, Onkel«, war alles, was dieser sagte. »Onkel« gilt als eine respektvolle Bezeichnung für ältere Herren. Als mein Vater sich umwandte, um sich kurz auf einen Stuhl niederzulassen, sich die Augen zu reiben und zu begreifen, was gerade vor sich ging, fügte der Offizier mit eisiger Höflichkeit hinzu: »Und greifen Sie nicht zum Telefon, bitte.«
Ein paar Minuten später, mein Vater hatte sein Gesicht gewaschen und sich angezogen, erschienen noch weitere uniformierte Schatten, die ihn die Stufen unserer Verandatreppe hinunter und in den wartenden Wagen geleiteten. In diesem VW-Bus, angeführt von dem Jeep und gefolgt von dem LKW mit den bewaffneten Männern, wurde mein Vater …
Und hier waren wir ratlos, was wohl genau mit ihm geschehen war. Hatte man ihn verhaftet? Oder war er zu einer Befragung abgeholt worden? Oder war er von einer Schurkenmiliz entführt worden, um Lösegeld zu erpressen?
Wir, seine Familie, hatten keine Ahnung. Im Gegenteil, was immer wir uns überlegten, konnte weder bestätigt noch mit Gewissheit widerlegt werden. Sicher war nur, dass für Vaters plötzliches Verschwinden weder ein Haftbefehl noch eine Anklage oder eine gerichtliche Verfügung vonnöten gewesen waren, sondern lediglich ein informelles »Gehen wir!« von einem jungen Mann in Khaki und eine nicht ganz so informelle Machtdemonstration durch den begleitenden Konvoi.
Es sollte ein Jahr vergehen, bis uns offiziell mitgeteilt wurde, dass unser Vater von der Militärregierung in »Schutzhaft« genommen worden war. Man hatte ihm gestattet, jede zweite Woche nach Hause zu schreiben. In den Wochen dazwischen konnte er einen Brief von zu Hause erhalten. Kein Schreiben durfte länger als ein Blatt im englischen Papierformat sein.
Vaters erste Nachricht aus dem Gefängnis war, zumindest für mich, eigentümlich enttäuschend. Er hatte das 22 × 33 cm große Blatt in der Mitte gefaltet und jede Hälfte beschrieben, vier Seiten auf Vorder- und Rückseite. Ich hatte noch nie etwas so langes Handschriftliches von ihm gesehen. Längere Mitteilungen meines Vaters waren immer maschinengeschrieben oder gedruckt gewesen: auf den Seiten, die aus seinen beiden Schreibmaschinen herauskamen – der kieselgrauen Smith Corona zu Hause und der kastenförmigen schwarzen Remington im Büro – oder in den Herausgeberkolumnen seiner Zeitung, The Nation. Nachdem ich seine sehr gleichmäßige, halb in Druckbuchstaben, halb in Schreibschrift geschriebene und in ihrer ordentlichen Lesbarkeit kindlich wirkende Schrift bewundert und mich über seine sehr einfache Ausdrucksweise gewundert hatte, gab es etwas, auf das ich mir nicht so recht einen Reim machen konnte.
Es waren seine Äußerungen, seine Worte auf diesen Seiten, keine Frage. Aber was für farblose, leblose, bedeutungslose Worte standen dort, die nichts darüber verrieten, wo und wie er lebte, nichts davon, was er wirklich dachte oder fühlte. Ich hatte noch nicht verstanden, dass seine Briefe nicht nur für unsere Augen geschrieben, sondern in der faden Sprache der Unverbindlichkeit immer auch für die Zensoren bestimmt waren.
Aber offensichtlich waren sie doch nicht unverbindlich genug für die Bürokraten. Manchmal öffneten wir einen Brief, der uns pünktlich am Posttag zugestellt wurde, und sahen, dass der Zensor eine Rasierklinge bei dem einen oder anderen nicht genehmen Wort angesetzt hatte. Worte wie ›Gefängnis‹ oder ›Land‹ waren sauber herausgeschnitten, auf der Seite blieben kleine rechteckige Löcher. Allerdings hätte selbst ein Kind im Kindergartenalter, allein aus dem Sinn des restlichen Satzes, die Lücken ausfüllen können.
Und ich war kein Kind im Kindergartenalter. Ich war 16 Jahre alt, und plötzlich wurde die ganze Sache mit den Wörtern – nicht nur den dynamischen und zugleich merkwürdig blassen Wörtern in den Briefen meines Vaters aus dem Gefängnis, sondern all den Wörtern, die mir überall begegneten – zu einer ernsten Angelegenheit.
Eine Zeitschrift, die damals bei uns zu Hause herumlag, ein britisches Heft namens Encounter, das mein Vater abonniert hatte, landete in meinem Schlafzimmer und sandte obskure Morsezeichen aus meinem Bücherregal. Auf dem Cover jener Ausgabe stand Mots Mots Mots geschrieben. Die schrägen rosa und blauen Schriftzeichen fielen mir schon ins Auge, bevor ich erfuhr, dass diese Buchstaben auf Französisch Wörter Wörter Wörter bedeuteten und sich auf die Autobiografie eines französischen Philosophen namens Jean-Paul Sartre bezogen. Les Mots war der Titel seines Buches, aus dem hier ein Kapitel abgedruckt war. Wörter Wörter Wörter. Sie kamen jetzt aus allen Richtungen zu mir, aufgeladen mit rätselhafter Bedeutung. Da es allgemein bekannt war, dass Telefone abgehört wurden, waren unsere Telefonate codierte Gespräche. Die Unterdrückung verwandelte uns alle in Code-Abhängige: Wir sprachen nicht nur verschlüsselt, wir lasen auch so und gebrauchten eine Sprache, die eher verdunkelte als zu erhellen.
Die Zeitungen – wenn man die beiden offiziellen Regierungsblätter überhaupt so nennen wollte – waren angefüllt mit unverblümten Lügen oder reinem Unsinn von niederschmetternder Kleinlichkeit. Klarheit wurde immer wichtiger – besonders, so schien mir, wenn es um meine Zukunft ging. Denn ich war gerade dabei, aus dem Haus zu gehen, um in Amerika am Mills College zu studieren, als mein Vater verhaftet wurde.
Das Mills war ein College für Frauen in Oakland, Kalifornien, und bekannt für seine Musikabteilung. Pioniere der experimentellen Musik lehrten, studierten oder traten dort auf – oder taten all dies gleichzeitig. Amerika lernte die Werke von Alban Berg, Darius Milhaud, Igor Strawinsky, Béla Bartók und Aaron Copland über das Mills kennen. Benny Goodman spielte mit dem Budapester Streichquartett, Dave Brubeck studierte bei Darius Milhaud, John Cage trat in einem Konzert für Schlaginstrumente auf – und alles unter der Ägide der Musikabteilung des Mills. Jeder, der auf dem Gebiet der Neuen Musik etwas wurde, schaute an irgendeinem Punkt seiner Karriere am Mills vorbei. Karlheinz Stockhausen. Morton Subotnick. Luciano Berio. Dennis Russell Davies. Steve Reich.
Ich zähle diese großen Namen hier auf, als hätte ich damals schon um ihre Bedeutung gewusst. Die einzigen Namen, die mir zu jener Zeit bereits etwas sagten, waren Benny Goodman und Dave Brubeck – und das lag an der Jazzleidenschaft meines ältesten Bruders Hubert. Auf Darius Milhaud, den berühmten Komponisten, machte mich meine Schwester Marlaine aufmerksam, als sie mir von der merkwürdigen Aussprache seines Namens berichtete. Und Marlaine musste es wissen, denn sie hatte ihren Master in englischer Literatur am Mills gemacht. Ich dagegen sollte dort hingehen, um Musik zu studieren, bei so großen Leuten wie Milhaud. (»Miyo, Miyo …« übte ich leise vor mich hin, unfähig, die merkwürdige Schreibweise dieses Namens zu erfassen.)
Aber Wochen vergingen, dann Monate, und Vater tauchte nicht wieder auf. Ein weiterer Staatsstreich war unwahrscheinlich – saßen doch jeder gewählte Politiker und sein Bruder noch immer hinter Gittern. Es war jetzt Zeit, fand meine Mutter, den großen blauen Samsonite-Koffer wegzuräumen, der fertig gepackt, die Verschlüsse zugeklickt, aufrecht in einer Ecke meines Zimmers stand und darauf wartete, mit seinem kleinen Set von Schlüsseln verschlossen zu werden – es war Zeit, das Beste daraus zu machen und sich klarzumachen, wo die Musik spielte.
Wie die Dinge lagen, mit dem Klavier in meinem Zimmer, war es ohnehin unmöglich, nicht mitzubekommen, wo die Musik spielte. Jedes Mal, wenn ich den Deckel des kleinen Yamaha öffnete, verfiel ich ins Grübeln und schäumte vor Wut über die Ungerechtigkeit des Ganzen. Schließlich gab ich klein bei, indem ich den Koffer auspackte und gleichzeitig mit dem Klavierspiel aufhörte, was eine bittere Art von Befreiung mit sich brachte. Ich hatte jetzt die Freiheit, mich in meiner Verzweiflung zu suhlen, meine Faust zu ballen wegen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit – meiner Menschlichkeit.
Mein Zimmer lag am äußeren Ende unserer Veranda und machte den Eindruck, als sei es ein wenig vom Rest des Hauses abgesetzt. Es wurde die Anti-Kammer genannt – so nämlich hatte ich das Wort Antichambre verstanden, als wir einzogen – es war nur mit einem Ausziehsofa unter dem Fenster möbliert, auf dem ich schlief, dem Yamaha, das an der gegenüberliegenden Wand stand, und dem Klavierhocker mit einem Stapel Notenblätter unter seinem Deckel, der bisweilen als Tisch diente. In dieser Anti-Kammer inszenierte ich meine stillen, sinnlosen Proteste.
Mein Bruder Alban schien der einzige zu sein, dem auffiel, dass ich zu spielen aufgehört hatte. »Spiel mir etwas vor!«, rief er manchmal, um zu versuchen, mich aus meiner Schmollecke herauszulocken, während er sich auf meinem Sofa ausstreckte. »Welches Stück war das doch gleich? Das, was so geht: dam-da-da, dam-da-da, daaam-da? Das habe ich dich schon lange nicht mehr spielen hören. Die Hey-den Sonate, nicht wahr?«
»High-den, nicht Hey-den«, korrigierte ich ihn mürrisch. »Es ist eine Highden Sonate.«
»Ja, ja, auf jeden Fall ist es eine Heidenarbeit.« Und er kicherte, wie üblich, über seinen Witz.
Alban, zehn Jahre älter als ich, war in Sachen Ziellosigkeit mein Verbündeter. Ein Künstler und ein Träumer war mein Bruder und gesegnet mit einer unverbesserlichen Zuversicht. Vor allem aber war es Alban, der mich aus dem doppelten Trübsinn von Pubertät und Apathie herauslotste und an die reichen Ufer der deutschen Literatur geleitete: um Goethe, Hölderlin, Heine und, ja, Friedrich Dürrenmatt zu entdecken.

Tatsächlich war es Albans Freundin Christa, die uns zuerst den Weg in die richtige Richtung wies. Christa Jaeger. Das war bevor Christas Vater, ein deutscher Ingenieur, der von Siemens nach Burma geschickt worden war, um an einer hydroelektrischen Anlage zu arbeiten, meinem Bruder das linke Ohr abbiss.
Der 27-jährige Alban hatte mit der 16-jährigen Christa geschlafen, und eines Tages überraschte der Ingenieur sie im Bett, als sie nicht schliefen. Er griff nach der Gardinenstange und riss sie vom Fensterrahmen. Er fand sie dann aber zu lang und unhandlich für seine Zwecke, warf sie zur Seite und entschied sich für die gute alte Kratz- und-Beiß-Methode. Im nächsten Augenblick war ein Stück von Albans linkem Ohr abgebissen und auf den Boden gespuckt, unweit der Stelle, wo auch er selbst landete.
Doch vor der ›blutigen Attacke des deutschen Schäferhundes‹ – das war der Euphemismus, den mein Bruder als Grund für sein verstümmeltes Ohr nannte – brachte Christa ihm einfaches umgangssprachliches Deutsch bei, das er dann an mich weitergab. (»Wusstest du, dass father auf Deutsch Farty heißt? Und wenn du dich erkundigen willst, wie es jemandem geht, dann sagst du: V Gates.«) Später, als ich mich für einen Deutsch-Intensivkurs am Fremdspracheninstitut angemeldet hatte (noch vor dem Vorfall), half mir Christa über einige frühe Stolpersteine hinweg. Sie verpasste meinem ersten Deutschaufsatz den letzten Schliff, indem sie mich mit umgangssprachlichen Ausdrücken versorgte, die, wenn ich mir die Mühe gemacht hätte sie im Wörterbuch nachzuschlagen – wenn sie überhaupt darin zu finden waren – ganz sicher mit dem Zusatz (vulg.) oder (derb) versehen gewesen wären.
Als ich versuchte, Christa zu beschreiben, wie gut diese neue Sprache zu mir passte (ich suchte nach dem deutschen Äquivalent für das englische »wie eine Ente zum Wasser«), beendete sie meinen Satz für mich mit »Wie Arsch auf Eimer?«. Arsch und Scheiß kamen in Christas Vokabular häufig vor.
Das neue Fremdspracheninstitut war eine Initiative der Regierung, was bedeutete, dass ich aus rechtlichen Gründen hätte abgewiesen werden sollen. Als aber Herr Dr. Lechner, der Programmdirektor, von meinem Dilemma hörte, entschloss er sich wacker, ein Auge zuzudrücken. Mein Dilemma bestand darin, dass ich als Tochter eines prominenten politischen Gefangenen nicht nur das Land nicht verlassen, sondern mich auch nicht an einer Universität einschreiben durfte.
Dr. Lechner hatte Verständnis für meine Situation. Er sagte, er sehe keinen Grund, warum ich seinen Intensivkurs nicht besuchen sollte. Als »Gaststudentin« hatte ich leider kein Anrecht auf ein Abschlusszeugnis am Ende des Kurses, aber es gab kein Verbot, das mich daran hindern konnte, einen Platz in seinem Klassenzimmer einzunehmen.