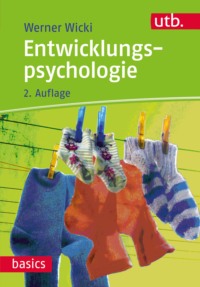Kitabı oku: «Entwicklungspsychologie», sayfa 4
3.3 | Motorik und Feinmotorik
3.3.1 | Grobmotorische Entwicklung
Während sich andere Säuger (z.B. Fohlen) schon wenige Stunden nach der Geburt – wenn auch noch etwas ungelenk – selbst fortbewegen können, bleibt der menschliche Säugling auffällig lange immobil. Das motorische Repertoire des Neugeborenen ist vergleichsweise retardiert. Prechtl (1993) bezeichnete es bis zum 2. Monat als „fötal“. Gleichzeitig ist auch die Muskelkraft noch sehr gering.
vermutete Ursachen
Diese motorische Unreife hat vermutlich evolutionsgeschichtliche Gründe: Das enorme intrauterine Wachstum des Gehirns machte eine Vorverschiebung der Geburt notwendig, da ein größerer Kopfumfang mehr Geburtskomplikationen hervorgerufen hätte. Die meisten motorischen Muster des Neugeborenen sind wenig kontrolliert und kaum zielgerichtet (z.B. Stoßbewegungen).
Reflexe
Bei einigen Bewegungen handelt es sich um komplexere Muster (oft als „Reflexe“ bezeichnet), die durch gezielte Stimulation ausgelöst werden können. Bekannte Reflexe sind: Saugreflex, Suchreflex, Greifreflex, Moro-Schreck-Reflex etc. (Hepper 2007). Viele dieser Muster verlieren sich nach dem 4. Lebensmonat und sind deshalb nicht direkte Vorläufer der entsprechenden Bewegungsabläufe, die später wieder aufgebaut (gelernt) werden. In der psychodiagnostischen Untersuchung von Neugeborenen nach Brazelton werden 20 dieser Reflexe gezielt ausgelöst (Brazelton et al. 1987). Die Reaktionen darauf werden standardisiert beobachtet und ausgewertet.
aufrechter Gang
In Europa und Nordamerika können die meisten Kinder mit ca. 1 Jahr ohne Hilfe aufrecht gehen. Die interindividuellen Unterschiede sind allerdings erheblich: Einige Kinder gehen bereits mit 10 Monaten, andere erst mit 1,5 Jahren, ohne dass dies zu Sorgen Anlass geben müsste. In den ersten Monaten lernen die meisten Säuglinge, zunächst sich in Bauchlage mit den Armen vom Boden abzustützen und dann sich von der Rückenlage auf die Seite zu drehen (Bayley 1993).
Laufen und Treppensteigen
Nach den ersten Gehversuchen mit 1 Jahr verbessert sich das Gehen im Verlauf des 2. Lebensjahres zunehmend, die Kinder werden zusehends schneller, d.h., sie laufen (springen) immer häufiger, erklimmen ohne Hilfe Treppen und beginnen mit Vollendung des 2. Lebensjahres zu hüpfen (Bayley 1993).
3.3.2 | Greifen, Legen, Werfen
Greifreflex
Die Greifentwicklung erfolgt kontinuierlich im ersten Lebensjahr (Thelen et al. 1996). Neugeborene sind mit einem Greifreflex ausgestattet, der durch die Berührung der Handinnenfläche ausgelöst wird; die Handöffnung erfolgt bei Berührung des Handrückens. Zudem bewegt das Neugeborene den Arm (mit geöffneter Hand) in Richtung eines Objektes mit überzufälligem Greiferfolg. Diese Muster verschwinden nach etwa 2 Monaten.
visuelles Verfolgen
Der 1- bis 2-monatige Säugling sieht zwar einen Gegenstand und betrachtet ihn interessiert, aber er greift noch nicht danach.
visuell gesteuertes Greifen
Ab dem 4. Monat kann visuell gesteuertes Greifen beobachtet werden (Krist et al. 2012). Der 4- bis 5-monatige Säugling greift nach einem Gegenstand, sofern sich sowohl die eigene Hand als auch der Gegenstand im Gesichtsfeld befinden. Das Kind vermag gezielt, ein Klötzchen zu ergreifen und bald auch in den Mund zu führen.
Links-Rechts-Koordination
Einige Wochen später kann es das Klötzchen von einer Hand in die andere geben – und noch etwas später – 2 Klötzchen gleichzeitig halten, in jeder Hand eines. Nun kann es auch 2 Klötzchen gegeneinander schlagen.
Pinzettengriff
Das Greifen von Objekten mit dem Pinzettengriff ist ab 8–10 Monaten möglich. Ab ca. 9 Monaten kann ein Kind das Klötzchen bewusst wieder loslassen und so z.B. auf den Boden werfen.
fallen lassen und bauen
Mit Vollendung des 1. Lebensjahres (9.–12. Monat) kann es das Klötzchen bewusst in einen Behälter fallen lassen. Das 12–15 Monate alte Kind stellt 2 Klötzchen zu einem Turm aufeinander.

Abb. 3.6 | Ab dem 4. Monat kann visuell gesteuertes Greifen beobachtet werden.
3.4 | Emotion, Motivation, Temperament und Bindung
3.4.1 | Emotionale Entwicklung
Schon das Neugeborene kann verschiedene Emotionen ausdrücken (Lewis 2007): Es kann schreien, lächeln (anfänglich im Schlaf), zeigt Interesse (gegenüber neuartigen Stimuli), erschrickt und zeigt Ekel (gegenüber ungenießbaren Speisen).
primäre Emotionen
Ab dem 2. Monat ist im Gesicht des Säuglings die Emotion Ärger beobachtbar (wenn eine zielgerichtete Handlung des Säuglings unterbunden wird) und ab dem 3. Monat auch Freude und Trauer. Diese Emotionen bilden zusammen mit den sich erst ab dem 6. Monat entwickelnden Emotionen Furcht (z.B. Furcht vor fremden Personen) und Überraschung die primären Emotionen Interesse, Ekel, Freude, Ärger, Trauer, Furcht und Überraschung (Lewis 2007).
Funktionen der frühen Emotionen
Diese Emotionen erfüllen aber noch nicht die Funktion einer motivdienlichen Handlungsregulation. Vielmehr signalisieren sie den Bezugspersonen unspezifische Zustände, die diese motivdienlich zu beantworten haben (Holodynski 2006). Die meisten Eltern (oder andere primäre Bezugspersonen) reagieren auf den kindlichen Emotionsausdruck mit einer intuitiven „Didaktik“ (Papoušek/Papoušek 1987):
 Sie reagieren angemessen und spiegeln den Emotionsausdruck (Herstellung von Kontingenzen zwischen Ausdruck und Erleben).
Sie reagieren angemessen und spiegeln den Emotionsausdruck (Herstellung von Kontingenzen zwischen Ausdruck und Erleben).
 Sie verwenden prägnante Ausdrucksdisplays in Sprache, Gestik und Mimik (deutliche Aussprache, leicht überzeichnete Mimik etc.).
Sie verwenden prägnante Ausdrucksdisplays in Sprache, Gestik und Mimik (deutliche Aussprache, leicht überzeichnete Mimik etc.).
 Je nach dem aktuellen Erregungszustand regen sie das Kind an oder beruhigen es.
Je nach dem aktuellen Erregungszustand regen sie das Kind an oder beruhigen es.

Abb. 3.7 | Emotionsausdruck: Freude
Diese emotionsbezogenen Handlungen der Bezugspersonen ergänzen den Emotionsausdruck der Neugeborenen zu motivdienlichen Emotionssystemen (Holodynski 2006). Im Verlauf des ersten und zweiten Lebensjahres werden die emotionalen Signale des Kindes spezifischer und zielgerichteter und dadurch für die Bezugspersonen eindeutiger interpretierbar.

Abb. 3.8 | Emotionsausdruck: Weinen
Wahrnehmung der Gefühle anderer Personen
Der Säugling drückt nicht nur Emotionen aus, er nimmt auch die grundlegenden Emotionen der Bezugspersonen – wie Freude, Wut, Ärger – zunehmend differenzierter wahr.
joint attention
Ab dem 6.–9. Monat übernehmen Säuglinge vermehrt die Blickrichtung der Bezugsperson, mit der sie interagieren, blicken also an die gleiche Stelle wie diese. Der gemeinsame Aufmerksamkeitsfokus ist für die sozial-kognitive Entwicklung des Kindes von enormer Bedeutung, weil nun die (seitens der Eltern) gezielte Verständigung über Referenzobjekte möglich wird.
social referencing
Ab dem 9. Monat benutzen Kinder emotionale Signale der Bezugsperson zur eigenen Verhaltenssteuerung. Je nach den Emotionen, welche die Bezugsperson gegenüber neuartigen Reizen oder Umgebungen zeigt, zeigt das Kind Annäherungs- oder Vermeidungsverhalten.
auf das Selbst bezogene Emotionen
Erst gegen Ende des 2. Lebensjahres bildet das Kind ein kategoriales Selbst aus: Es erkennt sich selbst im Spiegel und benennt sich selbst mit dem eigenen Namen. Das Bewusstsein des Selbst ist die Voraussetzung für die Entwicklung verschiedener komplexer Emotionen wie Empathie, Eifersucht, Verlegenheit, Stolz, Scham und Schuld (Lewis 2007). Während sich Empathie und die (nicht evaluative) Verlegenheit und die Eifersucht ab 1.5 Jahren entwickeln, folgen die (z.B. bezogen auf die Ursache eines Missgeschicks) evaluative Verlegenheit sowie Stolz, Scham und Schuld erst ab 3 Jahren (Lewis 2007).
ausdrucksvermittelte Empathie
Mit 1.5 Jahren, etwa gleichzeitig mit der Fähigkeit, sich selbst im Spiegel zu erkennen, setzt die Entwicklung der Empathie ein. Als Mechanismus der ausdrucksvermittelten Empathie postuliert Bischof-Köhler (1989, 2011) ein Zusammenspiel der (schon im Neugeborenenalter funktionsfähigen) Gefühlsansteckung mit der sogenannten „Ich-Andere-Differenzierung“. Letztere ist eine Errungenschaft des sich mit 1.5 Jahren herausbildenden Selbstkonzepts, das die Repräsentation des Selbst und des Anderen auf der Vorstellungsebene ermöglicht.
situationsvermittelte Empathie
Bei der situationsvermittelten Empathie kommt Gefühlsansteckung als emotionaler Auslöse-Mechanismus nicht in Frage. Die emotionale Bedeutung einer Situation wird nach Bischof-Köhler (1989) über die Mechanismen der simultanen Identifikation und der damit verbundenen Perspektiveninduktion vermittelt. Diese Mechanismen machen es möglich, „das Selbst und den Anderen als wesensverwandt und daher zu einer Schicksalseinheit verbunden zu sehen. Was dem Anderen widerfährt erlebt man dann, als wäre man selbst betroffen. Man fühlt sich in seine Lage versetzt und reagiert emotional auf seine Situation“ (Bischof-Köhler 1989, 60).
neuropsychologische Befunde zur Empathie
Die neurowissenschaftliche Forschung hat gezeigt, dass empathische Reaktionen zwar weitgehend auf unbewusst und schnell ablaufenden Prozessen beruhen, die durch emotionale Hinweise (z.B. ein Bild einer verletzten Person) ausgelöst werden. Gleichzeitig hat diese Forschung aber auf die Rolle von impliziten Bewertungsprozessen hingewiesen, die die empathische Reaktion deutlich modulieren können (de Vignemont/Singer 2006).
Diese Bewertungen können sich z.B. auf die Person beziehen, deren Emotion eine empathische Reaktion auslösen sollte. Hat man z.B. erlebt, dass einen diese Person unmittelbar vorher unfair behandelt hat, dann bringt man weniger Mitgefühl auf, wenn diese Person unter Kopfschmerzen leidet. Aufgrund der nachgewiesenen Wirkung parallel ablaufender Bewertungsprozesse (de Vignemont/Singer 2006) ist die Annahme plausibel, dass die Entwicklung der Empathie im Verlauf der Kindheit durch die weitere sozial-kognitive Entwicklung mitgeformt wird (vgl. Kapitel 4.3).
3.4.2 | Temperament
Eltern wissen aus Beobachtung und Erfahrung, dass sich Kinder von Anfang an unterscheiden: Es gibt aktive und ruhige Neugeborene und Kleinkinder, solche die häufig und anhaltend schreien und nur schwer zu beruhigen sind und wieder andere, die selten schreien und leicht zu beruhigen sind. Kinder unterscheiden sich in ihren motorischen Aktivitäten und in ihren Reaktionen auf unbekannte Situationen voneinander und so weiter.
Galen
Das alles sind längst bekannte Fakten, wie dieses Zitat von Galen zeigt:
„Die Grundlage meiner ganzen Argumentation ist das Wissen von Unterschieden, die bei kleinen Kindern beobachtet werden können und uns die Eigenschaften der Seele enthüllen. Einige [Kinder] sind sehr träge, andere heftig; einige unersättliche Feinschmecker, andere gerade das Gegenteil; sie können schamlos sein oder schüchtern und zeigen viele andere analoge Unterschiede.“ (Galen, ca. 150 n. Chr., zit. nach Zentner 1993)
Hippokrates
Der Versuch, die Unterschiede zwischen den Menschen zu ordnen und zu erklären, hat eine lange Tradition: Hippokrates (460 v. Chr.) knüpfte an altindische und babylonische Überlegungen an und ging davon aus, dass die Dominanz bestimmter Körpersäfte zur Ausbildung des Temperaments führe.
Theophrast (319 v. Chr.) und Galen verbanden diese Annahme mit den vier bis heute populären Temperamenttypen des Sanguinikers, Melancholikers, Cholerikers und Phlegmatikers (Allport 1970). Je nach Verhältnis zwischen den Körpersäften resultiere mehr oder weniger deutlich einer der vier Typen (temperare = stimmen, abstimmen).
empirischer Zugang
Verbesserte Methoden der empirischen Psychologie ließen jedoch bald erkennen, dass solche weitgehend intuitiv konstruierten Typologien im Allgemeinen kaum systematisch mit dem tatsächlichen Erleben und Verhalten zusammenhängen und auch kaum Vorhersagen auf zukünftiges Verhalten erlauben (Mangel an Prädiktabilität).
multidimensionaler Ansatz
Die differentielle Psychologie ging in der Folge – im Gegensatz zu den Typologien – von einem multidimensionalen Ansatz aus und postulierte Persönlichkeitsdimensionen, die weitgehend unabhängig voneinander sind. Analog dazu ging auch die sich ab den 1950er-Jahren entfaltende moderne Temperamentsforschung von einem multidimensionalen Konzept aus. Nachfolgend werden die Grundannahmen und Ergebnisse der modernen psychologischen Temperamentsforschung skizziert.
Grundannahmen
Temperamentsunterschiede beziehen sich nach Bates (1989) auf:
 Unterschiede im beobachtbaren Verhalten,
Unterschiede im beobachtbaren Verhalten,
 biologische, insbesondere neurophysiologische Unterschiede,
biologische, insbesondere neurophysiologische Unterschiede,
 angeborene, insbesondere hereditär (erblich) bedingte Unterschiede.
angeborene, insbesondere hereditär (erblich) bedingte Unterschiede.
Definition
Bates (1989) definierte das Temperament so: „[It] consists of biologically rooted individual differences in behavior tendencies that are present early in life and are relatively stable across various kinds of situations and over the course of time“ (Bates 1989, 4).
interindividuelle Verhaltensunterschiede
Der Temperamentsbegriff bezieht sich also auf beobachtbare interindividuelle Verhaltensunterschiede (Thomas et al. 1968), insbesondere auf Unterschiede in der Intensität des Emotions- und Erregungsausdruckes (z.B. Schreien), in der motorischen Aktivität (z.B. Strampeln im Bettchen) und auf Unterschiede im Schlaf-Wach-Rhythmus, die über verschiedene Situationen und über längere Zeit stabil bleiben.
Diese Verhaltensunterschiede basieren nach Ansicht der meisten Forscher auf biologischen Unterschieden (Bates 1989), zeigen sich schon in der frühen Kindheit (Goldsmith et al. 1987) und sind weitgehend genetisch bedingt (Buss/Plomin 1984; Thompson 1990; Emde et al. 1992; Goldsmith 1989; Saudino et al. 1995; Schmitz et al. 1996).
Studie
In einer der wichtigsten empirischen Längsschnittstudien über das Temperament von Kindern, der New York Longitudinal Study (NYLS) von Alexander Thomas und Stella Chess (1977) wurde das Temperament nicht direkt beobachtet, sondern mittels persönlicher Befragung der Mütter erfasst.
Diese Studie begann 1956 mit 141 Kindern aus 85 Familien, später wurden weitere Untersuchungsgruppen aufgenommen (Frühgeburten, Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien, Kinder mit geistiger Behinderung). Die Interviews mit den Müttern erfolgten in den ersten 2 Jahren nach der Geburt alle 3 Monate und danach bis zum 7. Lebensjahr in größeren Abständen (zuerst in halbjährlichen, später in jährlichen Abständen).
Später wurden nochmals zu 2 Zeitpunkten Interviews durchgeführt, einmal als die Kinder im Jugendalter waren und nochmals im frühen Erwachsenenalter. Interviewpartner waren jetzt die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen selbst.
Thomas und Chess (1977) definierten das Temperament als einen Verhaltensstil: Es interessierte die Art und Weise, wie sich das Kind verhält und wie es handelt, und nicht weshalb oder wie gut es gewisse Dinge tun kann.
Dimensionen bei Thomas und Chess
Sie operationalisierten das Konstrukt durch 9 Temperamentsdimensionen:
Kasten
Temperamentsdimensionen nach Thomas und Chess:
(1) Annäherung vs. Rückzug gegenüber neuen Erfahrungen (approach/withdrawal)
(2) Anpassung an Veränderungen (adaptibility)
(3) positive vs. negative Stimmungen (mood)
(4) Intensität emotionaler Reaktionen (intensity)
(5) Rhythmizität biologischer Funktionen (rhythmicity)
(6) Beharrlichkeit gegenüber umweltbedingten Widerständen (persistence)
(7) Ablenkbarkeit/Beruhigbarkeit (distractibility)
(8) Aktivitätsniveau (activity)
(9) Stimulationsschwelle für die Auslösung einer Reaktion (threshold)
Kritik
Die sich im Anschluss an NYLS entfaltende empirische Temperamentsforschung erfasste diese Verhaltensdimensionen meist mittels Elternfragebogen. Die Dimensionen erwiesen sich allerdings als zu wenig unabhängig voneinander und über die Zeit nur als moderat stabil.
schwieriges Temperament
Ein übergeordneter Faktor schwieriges Temperament (bei Thomas und Chess die Dimensionen 1–5) wurde zwar oft gefunden, enthielt jedoch in der Regel nur einzelne, aber nicht alle 5 postulierten Dimensionen (Bates 1989). Zum „schwierigen Temperament“ scheint v.a. der häufige Ausdruck negativer Affekte (Schreien) – weniger jedoch die Rhythmizität zu gehören. Thomas und Chess klassifizierten etwa bei 10% der Kinder ein „schwieriges“ und bei 40% der Kinder ein „einfaches“ Temperament.
Weiterentwicklungen
Da sich die postulierten Dimensionen nur bedingt bewährt haben, ist es nicht erstaunlich, dass das Konzept weiterentwickelt wurde.
Rothbart und Derryberry (1981) gingen beispielweise aufgrund ihrer Forschung von 6 Dimensionen aus (→ Tab. 3.1), Buss und Plomin (1984) nur noch von 3 Dimensionen. Insgesamt wird deutlich, dass je nach Autorengruppe klar unterschiedliche Dimensionen vorgelegt wurden.
negative Emotionalität
Die Dimension der negativen Emotionalität (Buss/Plomin 1984) bezieht sich auf das Ausmaß der sich im Verhalten oder im Emotionsausdruck äußernden Erregung auf Ereignisse. Eine ausgeprägte Tendenz zur Erregung basiert auf der Dominanz des sympathischen Teils des vegetativen Nervensystems. Welche der negativen Affekte besonders ausgeprägt sind (Furcht, Ärger), ist einerseits von Erfahrungen, andererseits von weiteren Temperamentsausprägungen abhängig (z.B. von hoher Aktivität, die eher zu Ärger führt).
Eng verwandt mit dem Konzept der Emotionalität ist das Konzept des „schwierigen“ Temperaments (vgl. Bates 1989; Thomas/Chess 1977).
Aktivität
Das Konzept der Aktivität bezieht sich auf das Tempo und die Energie, mit dem bzw. der das Kleinkind z.B. seine Umgebung exploriert oder beim Spielen agiert. Sehr aktive Kinder fordern die Kontrolle der Eltern stärker heraus, wodurch Konflikte in der Eltern-Kind-Interaktion wahrscheinlicher werden, dies allerdings in Abhängigkeit vom Temperament, den Ressourcen, Einstellungen etc. der Eltern. Die Richtung des Einflusses ist also wechselseitig. Hohe Aktivität muss somit kein Problem sein, sondern kann im Gegenteil zum Erwerb sozialer Kompetenzen und Privilegien führen.
Tab. 3.1 | Vergleich der Temperamentsdimensionen von Rothbart / Derryberry und Buss / Plomin
| Rothbart und Derryberry (1981) | Buss und Plomin (1984) |
| (1) Aktivitätsniveau (grobmotorisch) | (1) Aktivität |
| (2) Lächeln und Lachen (positiver Affekt)(3) Furcht (Vermeidung neuer Situationen)(4) Frustrationstoleranz | (2) Negative Emotionalität |
| (5) Adaptation an neue Reize (Beruhigbarkeit)(6) Orientierungsdauer/Durchhaltevermögen | (3) Soziabilität / Geselligkeit |
Soziabilität
Soziabilität bezieht sich auf das Ausmaß der Präferenz für das Zusammensein mit anderen Personen, besonders mit Personen, zu denen bisher keine Beziehung bestand. Ein Kind mit hohen Werten auf dieser Dimension sucht häufig den Kontakt zu verschiedensten Personen, ist nicht gerne alleine und reagiert auf die Kontaktaufnahme anderer Personen freundlich. Auch hier sind wechselseitige Beziehungen zum familiären Hintergrund denkbar. Problematisch ist zum Beispiel eine hohe Soziabilität des Kindes, die auf eine geringe Kontaktbereitschaft der Eltern stößt.
Erfassungsinstrumente
Die Instrumente zur Erfassung des Temperamentes können hier nicht im Detail besprochen werden. Am häufigsten kamen bisher Fragebögen für die Eltern zur Anwendung (vgl. Übersicht in Bates 1989), seltener persönliche Interviews mit den Eltern oder anderen Kontaktpersonen der Kinder, z.B. den Lehrern. Noch seltener erfolgten Beobachtungen bei den Kindern zu Hause oder im Labor.
Kritik
Die Erfassung des Temperaments per Fragebogen wurde wiederholt kritisiert (Rothbart/Bates 2006). Die Angaben der Mütter in Bezug auf das schwierige Temperament des Kindes hängen nicht nur mit ihren Beobachtungen, sondern auch mit ihren Persönlichkeitseigenschaften und Erwartungen, gemessen bereits vor der Geburt des Kindes, zusammen (Vaughn et al. 1987).
In einigen wenigen Studien kamen sowohl Fragebögen als auch Laborbeobachtungen zum Einsatz. Matheny et al. (1987) fanden mittlere Korrelationen zwischen der im Labor und per Fragebogen erhobenen Lenkbarkeit (tractability).
Stabilität vs. Veränderung
Ein kritisches Merkmal von Temperamentsunterschieden ist deren relative Stabilität über die Zeit. Als genereller Befund gilt: Je jünger die Kinder, desto geringer ist die Stabilität. Dies gilt insbesondere dann, wenn Beobachtungsmaße und nicht Fragebogenmaße eingesetzt werden (vgl. z.B. Saudino/Eaton 1995).
Die noch geringe Stabilität im Verhalten Neugeborener sollte aus mehreren Gründen nicht erstaunen: In den ersten beiden Lebensmonaten reifen verschiedene Hirnstrukturen erst voll aus, insbesondere nimmt die Zahl der neuralen Verbindungen im Kortex stark zu (z.B. im visuellen Kortex, vgl. Banks/Salapatek 1983).
Für die Irritabilität, beobachtet in den ersten 4 Lebenstagen, fand man allerdings eine gewisse Stabilität über die ersten 2 Jahre (Riese 1987). Irritierbare Kinder waren mit 2 Jahren häufiger emotional negativ, weniger aufmerksam und weniger sozial orientiert.
Unterschiede zwischen Neugeborenen
In den ersten Lebensmonaten können – z.B. mittels Brazelton-Test (Brazelton et al. 1987) – teilweise beträchtliche interindividuelle Unterschiede festgestellt werden. Das ist relevant, weil Besonderheiten im Neugeborenenverhalten, beispielsweise eine besonders ausgeprägte Irritierbarkeit, das Fürsorgeverhalten der Mutter nachweislich beeinflussen.
Irritierbarkeit
Im Falle der hohen Irritierbarkeit ist dieser Einfluss eindeutig negativ (Van den Boom/Hoeksma 1994): Mütter stark irritierbarer Kinder beachten deren positive Signale weniger und stimulieren weniger effektiv als die anderen Mütter. Interessanterweise bleiben diese Gruppen-Unterschiede länger erhalten als die Gruppenunterschiede bezüglich der Irritabilität der Kinder.
Stabilität nach 2 Jahren
Ab 2, deutlicher ab 3 Jahren weisen Temperamentsunterschiede beachtliche normative Stabilität auf (Caspi/Silva 1995; Scarpa et al. 1995).
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.