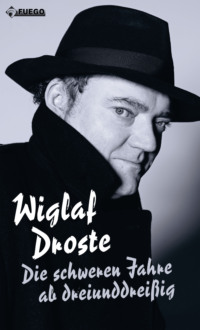Kitabı oku: «Die schweren Jahre ab dreiunddreißig», sayfa 2
Schimpfen und Schänden
Vom Niedergang der Beleidigungskultur
BERLIN: EINSKOMMASECHS ODER einskommaacht Millionen Gründe, den Verstand – soweit vorhanden – zu verlieren, durchzutitschen, auszurasten, boing, crashbang. Dazu das Alles-große-Klasse-Gelabere, das wir schon zum Würgen auswendig können, von den Thatchers, Reagans, Kohls und ihren Schmalspurepigonen, den Diepgens, Wohlrabes und anderen Flachkräften des öffentlichen Dahinvegetierens; dazu die aus fahrbaren Metallcontainern wild abgekippten Fleischmassen, Kannibalenfutter mit Stadtplan in der Hand, und wenn die Gruppe nur mindestens Dutzendstärke hat, ist alles wunderbar und geritzt; dazu das Klimakteriumsklima, Leichenwetter hätte Marlowe gesagt, irgendwas knallt zu heftig in die Köpfe runter, und dann badet plötzlich einer in anderer Leute Blut.
Friedliebendster Stimmung hockt man am späten Abend im Cafe, schlürft und plappert und schwatzt, da kommt auf einmal einer ohne Ventile rein, Wollmütze, Sonnenbrille, Sauerkrautbart, de Niros Taxi-Driver-Kram, nimmt die Brille ab und stiert. Und schweigt. Und stiert. Minutenlang, ohne jeden Ausdruck zwischen den Ohren. Bis es einem zu blöde wird und man wegkuckt, aus den Augenwinkeln aber noch rüberlinst, ja, er glotzt noch, der Junge hat Ausdauer. Und plötzlich reißt er dieBrille über die Augen, springt vom Hocker und wetzt nach draußen auf die Straße. Ssst, weg isser.
Der nächste Tag, ein anderer Stadtteil, schlendern, nixtun, in einen Stuhl gleiten, Seele baumeln lassen. Auch unser Überdruck-Mann ist wieder da, ohne Mützchen und Brille heute, zweihundert Meter noch entfernt, aber man hört ihn brüllen, »Ihr Arschlöcher! Ihr Schweine!«, ganz ungezielt-gezielt an alle geht das, die Arme rudern in der Luft, die Beine schlenkern und die Fäuste kloppen ins Leere.
Er kommt näher und krakeelt und tobt und teufelt, »Drecksäue! Ihr widerlichen Schweine!«, sein Überdruss-Repertoire ist begrenzt, woher soll’s auch kommen, es gibt ja keine Kultur des Schimpfens, bloß das wohlfeile unterdrückte Geseimel, die öde Vernünftelei und maximal einen verlogenen, nie so gemeinten Ansatz angeblicher »Streitkultur«, so spannend wie ein Tässchen Tee mit dreißig alten Schnepfen.
In geringem Abstand passiert der Nachwuchsbrüllo das italienische Cafe, »Ihr braucht gar nicht zu glotzen, ihr feisten Säcke!«, obwohl niemand kuckt oder höchstens nur ein bisschen, »Soll ich da mal hinkommen? Ich komm da jetzt mal hin!«, spurtet er blitzschnell aufs Lokal zu, bremst einen halben Meter vorm Nebentisch und geht zur Einzelbeleidigung über, »Du Macker! Du Scheißtyp! Du Wichser!«, insultiert er einen gänzlich überraschten Gast mittleren Alters, der ihn erstarrt-entgeistert ansieht und nicht weiß, wie ihm geschieht; der andere zwängt sein Gesicht in das des Gegenübers und kaut ihm fast ein Ohr ab, »Du mieses Schwein!«, nein, die Wahl seiner Mittel ist wirklich extrem begrenzt. Fluchend und schattentretend stürzt er weiter, und als er schon ein paar hundert Meter weitergezockelt ist, hört man noch sein Gezeter und Gemaule.
Traurig seufzend blickt man ihm nach, dem Amateur, dem Anfänger; zwar atmet er den rechten Geist, allein, es fehlt an Unterweisung. Unsere kleine Kulturaffenstadt schläft den großen Schlaf, und die Hohe Kunst der tödlichen Beleidigung verstirbt.
Zweitausend Jahre Kultur umsonst, schüttelt der italienische Wirt den Kopf hinter der Gebetsmühle auf Beinen her, und er weiß gar nicht, wie recht er hat.
1988
Nur mal so reinriechen
Anonyme Geschlechtsverkehrer berichten
Eine Betroffenenreportage
SIE LEBEN MITTEN UNTER UNS und doch am Rande der Gesellschaft: Geschlechtsverkehrer.
Ihre tückische Krankheit wird in Liedern bagatellisiert, ihre Sucht mit lockeren Sprüchen und Witzchen verharmlost. Doch Millionen Menschen in diesem Land sind schon heute betroffen, und täglich erhöht sich ihre Zahl.
Als M. mich vor wenigen Stunden anrief und um ein Gespräch bat, wusste ich noch nicht einmal von der Existenz der »Anonymen Geschlechtsverkehrer«. Jetzt stehe ich gespannt und beklommen
Transpirierend und beklommen
ist er vor die Tür gekommen
Ach, sein Herz das klopft so sehr
doch am Ende klopft auch er
(Wilhelm Busch)
vor der Tür einer Kreuzberger Hinterhauswohnung. Ein bärtiger Mittdreißiger öffnet, schüttelt mir herzlich die Hand und stellt sich mit »Du, ich bin der M.« vor.
In einem großen Raum ist ein gutes Dutzend Leute versammelt: »Anonyme Geschlechtsverkehrer«, ihre Angehörigen und Betreuer. Auf den Tischen stehen Knabberschälchen mit bunten Psychopharmaka. Menschen aller Altersgruppen und sozialen Schichten sind hier versammelt, Menschen, deren Wege sich nie gekreuzt hätten, verbände sie nicht die eine Sucht: Geschlechtsverkehr. Oder, wie B. sagt, »dieses gottverdammte Ficken«. B. ist Angehörige.
»Ich habe jahrelang danebengelegen und von nichts gewusst. Weil ich von nichts wissen wollte!« gesteht sie mit bitterer Stimme und legt ihren Arm um J.s Schulter. J., ein zerrüttet wirkender Brillenträger, ist ihr Ehemann. Sechs Jahre waren die beiden verheiratet, bevor B. seine Sucht bemerkte.
»Es war die Hölle.« J. spricht stockend und schwerfällig. »Am Ende habe ich es überall getan, in den Blumen, im Büroschrank, auf dem Weg zur Arbeit. Ich wollte es vor B. geheimhalten und alleine damit fertigwerden, aber es war stärker als ich. Als ich schließlich beim nüchternen Morgenverkehr war, wusste ich: Jetzt geht es auf Leben und Tod. Wenn B. nicht gewesen wäre ...«
Bei »Bürger bekennen: wir haben gefickt« sei er gewesen, berichtet K., aber dort sei man nur scharf auf Prominente gewesen. Ich erfahre von einem katholischen Arbeitskreis »Verkehr – Fluch oder Segen«, einem marxistischen Hochschulseminar »Der Geschlechtsverkehr als durchsichtiges Täuschungsmanöver der Bourgeoisie« und einer DKP-Liste »Einheitsfront Weg mit dem Ficken!« Überall aber habe man nur die Nöte und Bedürfnisse der Betroffenen ideologisch missbraucht.
So haben sie sich schließlich zu praxisnah orientierten Organisationen und Selbsthilfegruppen zusammengeschlossen. D., früher selbst Betroffener und heute ehrenamtlicher Helfer der Gruppe »Hand im Schoß«: »Wir können oft gar nicht viel tun. Zunächst zählt nur da sein, zuhören und aufwischen.« Ein Weinkrampf unterbricht ihn. Nur Satzfetzen sind zwischen den Schluchzern zu verstehen. »... alles ganz harmlos angefangen … nur mal so reinriechen ...«. Es ist erschütternd.
Tiefberührt verabschiede ich mich. Ja, ich werde berichten, ich werde darüber schreiben, ich verspreche es. Viele Hände muss ich schütteln bei diesem vorläufigen Abschied. Auf der Straße fällt mir die schummrige Beleuchtung in vielen Fenstern auf – es sind Schlafzimmerfenster. Mich fröstelt. Irgendwo dort draußen wartet eine Frau vielleicht auch auf mich.
1989
Tazionalsozialismus
Die Fortsetzung des Holocaust mit liberal- humanistischen Mitteln
THOMAS KAPIELSKI IST NICHT ganz metapherndicht. »Gaskammervoll« nennt er in der taz vom 17.10.88 den »Dschungel«, natürlich gibt es einen Aufschrei der Empörung, »Ungeheuerlichkeit«, »Verharmlosung der NS-Verbrechen«, »Verhöhnung der Opfer« heißt es, aber da, und das ist ein berechtigter Vorwurf, will Kapielski nicht gewusst haben, was er getan hat. Wenn man ein Tabu bricht, um eine Diskussion in Gang zu bringen, muss man diese hinterher auch führen.
Kapielski hat in eine Eiterbeule hineingestochen, und jetzt brodelt es. Die Reflexe wollen ans Licht, pawlowsch die meisten. Sprache ist verräterisch: »Dass der Mord an den Juden kein Anlass für ein Wortspiel sein darf, steht nicht in Frage«, beginnt Klaus Hartung am 5.11. seinen Text »Wir sind nicht frei«; natürlich meint er nicht »Anlass«, sondern »Gegenstand« eines Wortspiels. Ein entscheidender Unterschied, zumal gerade Hartung Sorgfalt und Genauigkeit fordert und anderen »grenzenlose Verluderung« der Sprache vorwirft – der Halbalphabet als Sprachrichter in einer Debatte, in der wie so oft die Träne den Gedanken ersetzen muss und die Empörung das Argument.
Das Fürsichgepachtethaben der Moral soll aber nicht nur die sprachliche Labbrigkeit, die der geistigen entspringt, kaschieren helfen; hier zeigt sich zuallererst die Deformation derer, die vor zwanzig Jahren antraten, die Bundesrepublik Deutschland als direkten NS-Nachfolgestaat zu demaskieren und radikal zu verändern, und die dann mit demselben Staat ihren Frieden gemacht haben. Aus zornigen jungen Menschen wurden saturierte mitlaufende staatstragende Elemente, aus ihrer Anklage gegen ihre Nazi-Eltern wurde folgerichtig Hetze gegen alle, die es mit der Veränderung ernst meinen und sich nicht so billig und willig versöhnen lassen: wer etwa dem Teufel der Militanz nicht abschwört, gerät augenblicklich in den Verdacht »faschistischer Methoden« oder ihrer Rechtfertigung; Autonome werden als »neue SA« tituliert.
Die Opfer des Nationalsozialismus spielen im Eiertanz der x-mal Gebrochenen eine wichtige Rolle; kämpfte man einst gegen einen »Rechtsstaat«, in dem nazistische Herrschaftsmethoden nur leicht abgedämpft weitergeführt werden, in dem das Kapital aus praktischen Erwägungen von Faschismus auf »Demokratie« umgerüstet hat, so ist jetzt von Versöhnung die Rede, von Wiedergutmachung. Beides kann es nicht geben. Wie kann ein ermordeter Jude, Kommunist, Homosexueller sich versöhnen? Nichts kann ungeschehen gemacht werden. Verharmlost wird nicht von extrem rechter, sondern von liberaler und konservativer Seite, allen voran Richard von Weizsäcker mit seinen rituellen Sonntagsreden, die suggerieren, der Nationalsozialismus sei eine bedauerliche Entgleisung der Geschichte und nicht eine bei Bedarf jederzeit wiederholbare, perfekte Variante der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen; die breiigen Betroffenheitsvokabelmischungen eines Weizsäcker abzunicken, fällt niemand schwer, beruhigt aber ungemein und vermittelt das gute Gefühl, das Richtige zu denken, Hauptsache, es zieht keinerlei Konsequenz nach sich.
Besonders perfide ist dabei der Pachtvertrag mit den NS-Opfern, den mancher ehemalige Linke bzw. sich links Fühlender so gerne abgeschlossen hätte: jeder jüdische Mensch wird auf die Rolle des Opfers festgeschrieben, wird zum Haken, an den man sein Kreuz, den Schuldkomplex, hängen kann: vom ewigen Juden zum ewigen Opfer, ein Paria, ein Stigma auf Beinen, das man mit gesenktem Haupt zum seelischen Mülleimer degradiert, verzeih mir, verzeih mir: Tazionalsozialismus oder: die Fortsetzung des Holocaust mit liberal-humanistischen Mitteln.
Niemand von uns hat das Recht, in Ruhe gelassen zu werden mit Bildern von in Gaskammern qualvoll verreckenden Menschen; ein Kapielski, der diese Bilder mit einem dumpfen Vergleich wachruft, verharmlost und verniedlicht weniger als all die, die sich jetzt die Orden des Guten, Wahren und Schönen an die Brust heften. Dass die Debatte von Seiten ihrer Betreiber nur vorgeschoben ist, steht dabei noch auf einem ganz anderen Blatt. Die Rechtsstaats- und Revanchismus-Clique um K. Hartung, M.T. Mehr und V. Gaserow hat sich mit der Fraktion zur Rettung des sauberen Journalismus (»Nachrichtensicherheit«), einer berufsbetroffenen Frauenredakteurin und dem taz-Patriarchen Arno Widmann zur Koalition der SelbstgeRechten verbündet; nach Vorwürfen wie Unseriosität, Pornographie usw. fuhr man kollektiv das dickste Geschütz auf, und all die, die man zuvor schon nur mit gramverzogenem Mundwinkel ertragen mochte, wurden ruckzuck zu »Antisemiten« erklärt.
Wenn Mehrheiten Geschichte schreiben, kommt immer Geschichtsfälschung dabei heraus. Die taz-intern-Seite vom 4.11. ist ein Paradebeispiel für Verdrehung und Lüge. Zwar ist richtig, dass die beiden Redakteurinnen Sabine Vogel und Regine Walter-Lehmann sich trotzig bzw. steindumm verteidigt haben, der dramatische Schmierenauftritt V. Gaserows (»Ich will mit diesen Leuten nicht mehr arbeiten, heul schluchz buuuhuuuhuuu...«) bleibt aber ebenso unerwähnt wie differenziertere Stellungnahmen oder die Kopf-ab-Atmosphäre, in der aus Kolleginnen blitzschnell Delinquentinnen wurden. Sprache als Instrument der Selbstentlarvung: »Prozess« meint eben nicht das Procedere, sondern den kurzen Prozess, der im Brustton der Selbstgefälligkeit zum medialen Schauprozess ausgeweitet wird.
»Geschichtslosigkeit« wurde den beiden Redakteurinnen vorgeworfen; nach der »Gaskammervoll»-Versammlung aber rief taz-»Chefin« Georgia Tornow Regine Walter-Lehmann an und erklärte: »Wenn das alles vorbei ist, gehen wir beide mal essen.«
Überhaupt wimmelt es von Geschichtslosigkeiten in der taz: dass Hartung 1986 ihm unliebsame nachrotierende Grünen-Abgeordnete als »Parasiten der öffentlichen Hand« bezeichnet, wen kümmert’s? Dass Hartung Kritiker regelmäßig als »Denunzianten« bezeichnet? Auch egal, Hauptsache der Durchmarsch der taz-Rechten verläuft reibungslos, Sprachregelung inklusive. Wenn man statt von »Endlösung« von »Entsorgung« spricht, ist das die Endlösung eben nicht nur der Dudenfrage; wenn die Vokabel nur aseptisch ist, darf der Begriff so dreckig sein wie er will, so der Sprachkodex einer Zeitung, die außer dem täglichen Stillhalte- und Kapitulationsangebot an die Verhältnisse nichts mehr vorzuweisen hat.
Würden sich Hartung, Widmann & Co. an den für sich reklamierten moralischen Kategorien messen, sie müssten sich fristlos selbst entlassen. Widmann etwa kostet es allenfalls ein müdes Lächeln, zur Abrechnung mit seiner K-Gruppen-Vergangenheit mal eben lässig über 20 Millionen tote Russen hinwegzugehen; jetzt spielt sich der Bigott zum Chefankläger auf und nennt seinen Kollegen Mathias Bröckers »das Kriminellste vom Kriminellen«. Wer die Macht will, schafft sich eine doppelte Moral an, Menschenrechte ja, aber nur für rechte Menschen. Dass der taz-interne Machtkampf auf dem Rücken der NS-Opfer ausgetragen wird, zeigt, wo es hingeht mit der »neuen taz«: eine Widerwärtigkeit, die ihresgleichen sucht, aber so leicht nicht finden wird.
1988
Laut Stammeln und Nuscheln
Grönemeyer kann nicht tanzen
HERBERT WAR HIER. IN BERLIN. Tempodrom. Total ausverkauft. Aber billig. Feiner Zug. Könnte mehr nehmen. Ist populär genug. Herbert hackt Sätze. Nuschelt. Klingt lustig. Auch irgendwie kaputt.
LP heißt »Sprünge«. Was meint er? Große Sprünge? Bochum-Hollywood? Sprung in der Schüssel? Weiß nicht. Kann nichts sagen. Angst. Deutschland. Kindheit: Vater Pils. Mutter Putzen. Alles total kaputt.
Herbert schmachtet. Balladen: »Gib mir den Schmerz zurück, ich brauch deine Liebe nicht.« Teenies toben. Tränen. Trauer. Wut.
Amerika: Entsetzlich. Thema zwei. Unberechenbar. Überheblich. Noch schlimmer als Deutschland.
Herbert ist klug. Mehr im Kopf als Publikum. Publikum ballt Faust. Ruft: »Buh«. Spendet Applaus.
Band ist gut. Wuchtig. Schlagzeuglastig. Schwer. Trocken. Bisschen schwülstig. Herbert lacht. Schwitzt. Winkt. Freut sich. Gibt, was er hat. Hat den Jaul, nicht den Soul. Klingt leicht abgestochen. Aber voll da.
Tanzen. Herbert kann nicht tanzen. Kein Rhythmus. Kein Körper. Sieht komisch aus. Krank. Hospitalistisch. Autistisch. Herbert hebt Zeigefinger. Ständig. Zeigt ins Publikum. Warum? Weiß nicht. Angst. Kann nichts mehr sagen. Aus.
1989
Gürtellinie, Dudenfrage
WENN MAN, HÄNDE AUF DEM RÜCKEN, unsere schöne Kulturstadt abschreitet und inspiziert, kann es einem passieren, dass ein Mitmensch ohne geeignete Ventile die Straße entlanggerast kommt, armerudernd, beineschlenkernd und die Fäuste ins Leere kloppend, Ihr Schweine! Ihr Schweine! kreischend, schattentretend und zeternd, wahllos und ungezielt verblüffte Passanten anblökend, eine Gebetsmühle auf Beinen ohne hinreichendes Überdrussrepertoire.
Woher soll es auch kommen? Die Hohe Kunst der tödlichen Beleidigung wird nicht gelehrt, und die Angebervokabel Streitkultur meint bloß das wohlfeile Kaffeekränzchengeschwätz des medialen Gewurschtels. Man trägt wieder Gürtellinie, am liebsten als Halskrause, ist von jeder Bagatelle erschüttert, findet jedwede Lebensäußerung unerträglich oder besser noch zynisch und menschenverachtend und ist grundsätzlich betroffen.
Und zwar sturz. In Trauerarbeitslagern treffen sich neue Weinerlich- und alte Mitscherlichkeit zum Händeschütteln mit Kanzler und Krawczykeria, geeint im Von-allem-und-jedem-Beleidigtsein steht man am Tränenbottich.
Wohlig erschauernd dagegen liest man im jeweiligen Gürtellinienblatt, was einen schon zu Lebzeiten in die Klassizität überführt. Die eigene popelige Existenz muss zur Jahrhundertchance gebläht werden, eine Nummer kleiner besteht permanenter Handlungsbedarf. Mit Imponier- und Spreizwörtern von Essential bis Profil werden Bedeutung, Größe und Würde herbeigelabert, und bei Zwischenrufen wird Totensonntag angeordnet.
Die Endlösung der Dudenfrage schreitet hurtig voran; bis es aber soweit ist, wird noch kräftig Öl auf die Mühlen gegossen, und Wasser ins Feuer.
1989
Hoch die Mauer!
13.8.89: Berlins nützlichstes Bauwerk wird 28 Eine notwendige Gratulation
DIE ÄUSSEREN VORGÄNGE SIND BEKANNT. Alljährlich am 13. August, eingeladen und herbeigekarrt von der Gerhard Löwenthal-Gesellschaft für Menschenrechte, versammeln sich rechte Menschen am Checkpoint Charlie, klettern auf einen Aussichtsturm, zeigen mit dem Finger nach Osten und weinen sich die bzw. den weißen Westen nass. Auch am 13. August 1989, als die Sonntagsreden passenderweise an einem Sonntag gehalten wurden, kulminierte das turnusmäßig abgesonderte Gezeter von Berufsvertriebenen, dissidierten Dichtern, Jungunionisten aller Parteien, Ostfront- und Jubelberlinern, von Alt- und Neo-Nationalisten in diesem Wutgeheule:
»Hier schießen Deutsche auf Deutsche!«
Die ostentative Empörung dieses Satzes richtet sich dabei keineswegs gegen das »Schießen« als solches, sondern allein gegen die ethnische Verwandtschaft von Subjekt und Objekt: »Deutsche auf Deutsche!« und meint: anstatt gemeinsam, wie oft und gründlich eingeübt, mit (wieder)vereinten Kräften auf den schäbigen Rest der Welt, auf Russen, Polen, Tschechen, Briten, Franzosen, Türken und und und.
Nein, wenn überhaupt geschossen werden muss, dann auf Deutsche, bzw. wenn von einem Deutschen noch jemals geschossen werden darf, dann nur auf seinesgleichen. In der Nationalen Frage, diesem Kalten-Krieger-Kaffee, der immer wieder und derzeit wieder einmal verstärkt aufgeheizt wird, in der Deutschen Frage gibt es zum umgekehrten Rassismus keine Alternative: Lieber möge sich »das deutsche Volk« in seiner Gesamtheit von dieser Erde herunterbefördern, als dass auch nur noch ein Angehöriger einer anderen Nation von einem Deutschen um sein Leben gebracht wird; lieber jeden Tag Schüsse an der deutsch-deutschen Grenze als noch ein wg. Ladendiebstahls erwürgter Asylbewerber in Schwaben oder noch ein einfach so erstochener Türke in Westberlin.
Die Deutschen, also die, die sich sog. Stolz einbilden, Deutsche zu sein, gehören in Schach gehalten, notfalls mit Mauer und Stacheldraht. Lässt man sie von der Leine, tritt immer wieder dasselbe zutage: der Restverstand in den Grenzen von 1937. Der von Weizsäcker salonfähig gemachte Nationalismus wird dankbar aufgenommen auch von sich links empfindenden Menschen, die mal verklausuliert, mal offen nationale Selbstbestimmung fordern, von einem Paneuropäismus unter deutscher Führung träumen und ihre Expansionsgelüste bis zur letzten Ural-Tankstelle auf der Reichsautobahn schweifen lassen. Es gibt wenig Abstoßenderes als die Vorstellung einer Wiedervereinigung: noch mehr Deutsche, und alle auf einem Haufen. »Am Chauvinismus ist nicht so sehr die Abneigung gegen die fremden Nationen als die Liebe zur eigenen unsympathisch«, schreibt Karl Kraus; man kann Franzosen, Italiener, Briten, ja sogar Deutsche schätzen (ich habe nichts gegen Deutsche – einige meiner besten Freunde sind Deutsche), aber ein »Volk«, ein »Volksganzes«, einen »Volkskörper« niemals. Die Vierteilung Deutschlands 1945 war ein Schritt in die richtige Richtung; er hätte konsequent fortgeführt werden sollen statt schrittweise zurückgenommen.
Die Mauer behütet nicht nur die Welt davor, an einem ungebremsten deutschen Wesen zu verwesen, sie schützt auch Honeckers Cordhütchen-Sozialismus vor dem Kneifzangengriff des Kapitals, und umgekehrt bewahrt sie die BRD und Westberlin vor Horden naturtrüber, säuerlich sächselnder DDRler mit Hang zu Billig-Antikommunismus und REP-Wählen – dergleichen gibt es hier schon im Übermaß. Mögen andere Nationen um nichts besser sein – diese ist die unsere; es gilt, zuallererst die eigene Vaterländerei zu hassen und zu verachten. Hierbei ist die Mauer wenn nicht edel, so doch hilfreich und gut.
47 Tage vor ihrem Bau bin ich geboren, und gerne möchte ich mit ihr alt werden. Halten wir die Mauer hoch
– sie kann gar nicht hoch genug sein.
1989