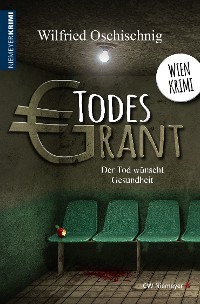Kitabı oku: «TodesGrant», sayfa 2
Sinnlos. Die ‚Cobra‘ versprühte weiterhin ihr Gift. Fußtritte und Faustschläge, als wäre Gradoneg ihr neuestes Trainingsgerät für die nächsten ‚Olympischen Spiele der Spezialeinheiten‘. Alle hatten sie ihre Helme auf und waren selbst darunter vermummt, niemand, und schon gar nicht ein Schwerverletzter, würde sie je beschreiben und überführen können. Und genauso traten sie zu.
Erst als zwei Sanitäter mit einer kleinen Trage in die Wohnung stürzten, zischten die Schlangen zur Seite.
„Wo ist die Katze?“, keuchte einer der Sanitäter völlig außer Atem in die Wohnung. „Und das nächste Mal ruft nicht in Salzburg an, wenn’s in Wien ein verletztes Tier gibt. Wär das bitte möglich, ja? Die Salzburger kümmern sich um die Salzburger und wir uns um die Wiener. Oder hebt zumindest das Telefon ab. Wir telefonieren da mit den Kollegen im Kreis, während das Tier leidet. Also, wo ist jetzt die Katze?“
„Welche Katze …?“, wollte ein verblüffter Cobra-Beamter vom Sanitäter wissen.
„Na, die Katze … Ihr habt uns doch wegen einer Katze gerufen. Irgendwas von einer Heizung und einer verdrehten Pfote ...“
„Ihr seid von der Tierrettung …?“, konnte es der Cobra-Beamte nicht glauben, lief wahrscheinlich unter seiner Schutzmaske vor Zorn rot an. „Das gibt es doch nicht! Die Tierrettung!“
„Hinten, im Kinderzimmer … auf dem Boden“, flüsterte Gradoneg, „Ich… ich hab Sie gerufen und … und der Whitey ist ein Kater, bitte helfen Sie ihm.“ Für diese wertvolle Auskunft gab es einen umso härteren Tritt vom Cobra-Beamten, der noch immer baff die Tierretter musterte:
„Ihr seid von der Salzburger Tierrettung und wir warten hier seit einer halben Stunde auf die Wiener Rettung!“
„Wir kommen eh aus Wien, verdammt noch einmal! Und mich interessiert jetzt das Tier und sonst nichts“, gab der Tiersanitäter seinem Kollegen ein Zeichen und lief mit diesem in die Wohnung, rief noch: „Kümmert euch inzwischen um euren Verletzten. Der schaut eh nicht so schlimm aus – und die Wiener Rettung wird auch bald da sein, meistens tauchen sie nur ein paar Minuten nach uns auf.“
Fast schon verständlich, dass sich die ‚Cobras‘ jetzt erst recht vor Gradoneg erhoben.
„Du frisst Menschen und quälst auch noch Viecher!“, traten sie abermals auf ihn ein.
Und schlimm, aber wahr: Je mehr man ihm auf den Brustkorb drosch, desto rhythmischer schlug sein Herz; je mehr man ihm die Nieren malträtierte, desto beweglicher wurde er. Eine höchst zweifelhafte Behandlungsmethode, verwerflich und für kein medizinisches Lehrbuch geeignet, doch bei Gradoneg wirkte sie Wunder – er wurde aus seiner Schockstarre erlöst. Und als sie ihn an den Haaren hochzogen und die Handschellen anlegten, blieb er sogar stehen. Mit weichen Knien zwar, aber die schlotterten ihm vor Angst, und nicht weil die Kreuzbänder oder der Meniskus gerissen waren.
Zwischendurch hetzten die beiden Tierretter wiederum ins Vorzimmer. Whitey lag bewusstlos auf der kleinen Trage, starr und leblos, das verdrehte Bein bandagiert.
„Du elendiger Teufel!“, spuckte einer der Tierretter Gradoneg ins Gesicht und warf ihm ein Futterpäckchen an den Kopf. „Du fütterst mir nie wieder einen sterbenden Kater mit einem abgelaufenen Hirschen. Zuerst reißt du ihm das Bein ab und dann vergiftest du ihn auch noch!“ Dann trugen sie Whitey fort. „Sag ich doch immer: Der Mensch ist das einzig schreckliche Vieh, alles andere an der Natur ist harmlos. Sperrt diesen Wahnsinnigen bloß lebenslänglich ein, alleine schon für den Kater …“, hallte es im Stiegenhaus.
Knapp drei Minuten später kamen tatsächlich ein Notarzt und drei Sanitäter der Wiener Rettung. Genau genommen waren es vier Minuten, sie hatten sich mit dem Aufzug um ein Stockwerk verfahren. Das machte der Notarzt mit einer raschen Diagnose wieder wett: Gradoneg würde unter seinen Schürfwunden weiterleben, am Kopf wäre höchstens eine Beule zu erwarten, nicht viel größer als ein belangloses Wimmerl. Also, rein äußerlich war Gradoneg pumperlgsund. Ein Hysteriker und Simulant vielleicht, aber kein Fall für eine Unfallklinik. Wenn die Cobra-Leute schon mit ihm in ein Krankenhaus wollten, dann würde der Notarzt einen Abstecher ins AKH empfehlen – nur wegen des neuen Küchenchefs in der Kantine. Dort würde es fast so gut wie in einem guten Wirtshaus schmecken. Ja, vom Essen her wäre das AKH sinnvoll. Ansonsten gäbe es für die paar harmlosen Kratzer bestimmt auf jeder Polizeistation genug Pflaster.
„Weshalb habt ihr den überhaupt kassiert?“, wollte der Notarzt von einem Cobra-Beamten wissen. „Hat das etwas mit der Katze zu tun, die sie gerade aus dem Haus gebracht haben?“
„Schlimmer, Kannibalismus.“
„Was, ein Menschenfresser?!“
„Ja. Hat seiner Katze ein menschliches Gehirn verfüttert und sie dann …“
„Sind Sie verrückt“, durchzuckte es Gradoneg, „ich bin kein Kannibale und dem Whitey hab ich auch nichts getan! Das ist doch alles ein verdammter Irrtum!“
„Du halt bloß deine Goschn, sonst frisst du nämlich meine Faust! Das ist dann dein letzter menschlicher Körperteil!“, brüllte ihn der Cobra-Beamte an. „Erzähl das dem Haftrichter, aber nicht mir!“
„Ich will sofort mit meiner Frau sprechen!“, muckte Gradoneg nochmals auf, sah aber, wie ihm ein geballter Noppenhandschuh gefährlich nahe kam.
Ein absurdes Bild: Hinten am Rücken steckten seine Hände in Handschellen, vorne das Handy in der Hosentasche. Wäre es eine Karikatur in einer Zeitung gewesen, hätte er wahrscheinlich mit einem Schmunzler daran gedacht, seinem Josef mit dieser Methode die Handysucht abzugewöhnen.
Der Notarzt schüttelte den Kopf, musterte Gradoneg von oben bis unten.
„Mein erster Menschenfresser … Gut, dass ich bald in Pension gehe.“
„Das … das ist doch völlig absurd“, schrie Gradoneg, „Das könnt ihr doch nicht mit mir machen! Ich hab niemandem etwas getan!“
Dann schubsten sie ihn ins Stiegenhaus und führten ihn ab.
Gradoneg und Whitey verließen jedenfalls beinahe zeitgleich die Wohnung.
Er in Handschellen. Der Kater auf einer Trage der Österreichischen Tierrettung.
An die zwanzig Cobra-Beamte standen ihnen im Stiegenhaus Spalier.
Beide fuhren sie mit Blaulicht und heulenden Sirenen davon.
Einer Richtung Gefängnis, der andere womöglich Richtung ‚Einschläfern‘ oder ‚Amputation‘.
Es war die größte Blaulicht-Eskorte in der Geschichte Währings.
Beide wussten nicht, ob sie jemals zurückkehren würden.
Beide wirkten verloren.
Sehr verloren.
Zwei
Ganz Währing ein Blaulichtmeer und Sirenengetöse. Einundzwanzig Einsatzwägen schlängelten sich durch die Kreuzgasse zur Martinstraße vor. Einundzwanzig!
Tonnenweise Panzerglas rollte durch den Bezirk, zig Gewächshäuser der Wiener Gärtnereien hätte man damit bauen können. Dass es überhaupt bei der Polizei derart viele Sicherheitswägen gab, hätte sich Gradoneg nie gedacht. Fehlte nur noch ein Hubschrauber, der diesen Schwerverbrecher-Transport begleitete. Niemand in Währing würde Gradonegs Verhaftung je vergessen. Und wie die Währinger ihre Villen weitervererbten, würden sie noch ihren Enkeln von diesem seltsamen Matthias Frerk Gradoneg, dem letzten ‚Menschenfresser‘, erzählen; von einem Tag im Herbst, als das Blau des Himmels plötzlich auf die Straßen fiel und sie sich alle die Ohren zuhalten mussten.
Selbstverständlich glaubte Gradoneg nach wie vor an die Gerechtigkeit, so hilflos und entwürdigt er sich auch in diesem gepanzerten Polizeitross fühlte. Österreich war gewiss keine blutige Diktatur, die gerade ein wiederauferstandener Idi Amin übernommen hatte. Und das, was er in seinem ersten Schock aus den Dialogen der Cobra-Beamten aufgeschnappt hatte, war ja völlig absurd und würde keine Minute der Österreichischen Verfassung standhalten. Unrecht war Unrecht, Verfassung war Verfassung. Eher könnten sie ihn als Anführer einer verschwörerischen Marsinvasion festnehmen denn als Menschenfresser. Außer dem einen Wurstblatt in einem Gabelbissen und hin und wieder einer Leberkäsesemmel aß er quasi kein Fleisch mehr. Huhn, Fisch und Lamm rührte er prinzipiell nicht an, selbst beim Wiener Schnitzel ging es ihm mehr um die Panier. Einfach lächerlich, „er“ ein Menschfresser! Sein jährlicher Fleischkonsum entsprach kaum der Hälfte seines eigenen Körpergewichts. Was ja bei den österreichischen Männern meist umgekehrt der Fall ist. Jeder Fettwanst hält doch hierzulande eine Schweinemast in seinem Magen.
Absolut lächerlich! Er war fast Vegetarier und nun wollte man ihm ein Kannibalismus-Delikt auftischen. Da konnte man doch gleich die „Vegane Gesellschaft Österreich“ ins Gefängnis werfen. Blöder ging es nicht. Schade um jeden Tropfen Benzin in den Tanks der einundzwanzig Einsatzwägen. Eine größere Frechheit auf Kosten der Steuerzahler hatte es noch nie gegeben. Selbst ein EU-finanzierter Skilift in Dänemark machte da mehr Sinn. Nicht den geringsten Hinweis würde die Spurensicherung in seiner Wohnung finden. Höchstens einen abgeschnittenen Zehennagel, der ihm auf den Boden gefallen war. Vielleicht lag auch unten im Kellerabteil noch eine tote Maus, aber ansonsten hatte er keine Leichen anzubieten. Die einzige Leiche war ja er selbst – eine grausam misshandelte Justizleiche.
Ganz sicher: Gradoneg bräuchte nur vor einem Richter den Mund aufzumachen, und die Sache wäre erledigt. Jedem denkenden Menschen würde seine Unschuld sofort einleuchten. Die Cobra-Beamten machten ja nur ihre Arbeit, stupid und unreflektiert, wie es eben im öffentlichen Dienst der Fall ist. Straßenkehrer fegen ebenfalls nach vorgegebenen Dienstplänen. Und steht dort irrtümlich einmal „Donau“ drauf, dann stecken sie eben ihre Besen ins Wasser. Und genau das taten gerade die Cobras – sie liefen mit falschen Koordinaten los und kehrten die falsche Straße.
Dennoch spürte Gradoneg instinktiv, dass in diesem Blaulicht eine unheilvolle, schwarze Wolke mitschwebte und die Federn der üblen Gerüchte gerade in alle Himmelsrichtungen verteilt wurden. Und irgendetwas von diesen üblen Gerüchten würde ewig an ihm haften.
Immer bedrängter und hoffnungsloser fühlte er sich so auch hinten im Auto, einem Survivor R. Eingezwängt zwischen zwei Polizisten, die Arme mit Handschellen am Rücken fixiert und den Sicherheitsgurt beinah schon um den Hals. Terroristen sollten hier eigentlich Platz nehmen, Serienmörder und Amokläufer, einige Politiker und Aktienspekulanten, aber doch nicht er. Ein unbescholtener Bürger aus Währing, ein Bilderbuchvater und österreichischer Steuerzahler. Selbst den Papst hätte man in diesen Stahlkessel stecken können – aber um Gottes willen nicht Matthias Frerk Gradoneg!
Er rutschte im Survivor R nervös hin und her.
„Den Haftbefehl …“, fiel ihm endlich ein stichhaltiges Argument ein. „Sie haben mir weder einen Haftbefehl vorgelesen noch meine Personalien erhoben.“
„Alles längst geschehen“, hörte sich die Stimme des Cobra-Beamten neben ihm wie ein langer Gähner an. „Hättest besser aufgepasst.“
„Ich war doch bewusstlos!“, protestierte Gradoneg.
„Gusch!“
Keine Frage, die ‚Cobra‘ war eine Eliteeinheit, und niemand ließ sich hier von irgendwelchen juristischen Formalitäten aus der Ruhe bringen.
Gradoneg räusperte sich mehrmals und suchte in seiner trockenen Kehle nach einer angemessenen Stimme. Einen dunklen, männlichen Tonfall, der diesen hartgesottenen Männern gewachsen war und sich in deren Ohren nicht gleich wie ein Mückenfurz anhörte.
„Also, meine Herren, ich schlage Folgendes vor: Wir bremsen uns jetzt alle ein und vergessen diesen Wahnsinn, ja? Sparen uns den Weg zu irgendeiner Polizeistation oder zu einem Gericht. Kommt ja sowieso nichts dabei raus als ein Missverständnis, oder? Passiert ist passiert, und mein Anwalt wird Ihnen schon nicht die Uniform ausziehen. Bei meiner Frau wäre ich mir da allerdings nicht so sicher … Egal … Von mir aus können wir noch rüber ins AKH fahren und die Kantine mit dem neuen Küchenchef testen. Ich schmeiß eine Runde, aber dann ist dieser Spuk …“
Schon schnellte eine Hand an seine Gurgel und schlug die Finger in seinen Adamsapfel. Der Cobra-Mann drückte zu, langsam, als hätte er alle Zeit dieser Welt, seine Beute zu erlegen und ihr beim Leiden zuzusehen. Seine Augen glühten wie aufgedrehte Herdplatten, und Gradoneg ging die Luft wie bei einem kaputten Fahrradreifen aus.
„Dir gönn ich das ‚Graue Haus‘!“, ließ der Typ endlich von der Gurgel ab.
Verständlich, dass Gradoneg kein Wort mehr herausbrachte und sein Mut zwischen den Fingern des Beamten endgültig zerrieben worden war.
Das Graue Haus?! ..., schnappte er verzweifelt nach Luft und versuchte gleichzeitig seine Angst runterzuschlucken. Mit allem hatte er gerechnet, nur nicht mit dem „Grauen Haus“.
Er wusste sehr gut, was das ‚Graue Haus‘ war.
‚Graues Haus‘ sagen die Wiener zur ‚Justizanstalt in der Josefstadt‘ im 8. Bezirk.
‚Grau‘, weil dies die Farbe der Häftlingsuniformen war, die dort im letzten Jahrhundert getragen wurden. Und noch ein viel schlimmerer Farbton hinterließ in diesem Gefängnis eine bestialische Blutspur: Über 1.200 Menschen waren dort von Nazischergen mit einem Schafott im Keller hingerichtet worden. Es war historisch vielmehr ein „braunes, grauenhaftes Haus“, diese Justizanstalt in der Josefstadt.
Bei Gradoneg perlte sich der Angstschweiß auf der Stirn. Doch nicht in die Josefstadt!
Lieber hätte er sich gleich zu Hemmas Kater Whitey auf die Trage der Tierrettung gelegt und ein verdrehtes Sprunggelenk gegen sein jetziges Schicksal eingetauscht. Besser eine Tierklinik als die Justizanstalt in der Josefstadt.
Der Angstschweiß tropfte ihm von den Schläfen, und alle Zuversicht fiel von ihm ab. Nicht nur sein Ruf war zerstört, jetzt sollte er auch noch in eine Zelle mit den schlimmsten Verbrechern Wiens geworfen werden. Tatsächlichen Verbrechern! Frauenmördern, Pädophilen, Amokläufern und Dschihadisten! Bestenfalls konnte er Drogendealern begegnen.
Alles verloren!
Wie hatte er nur die letzten beiden Jahre um ein besseres Leben gekämpft und geschuftet – und nun sollte seine Zukunft in einer Gefängniszelle unter Schwerverbrechern verbluten?! Sein Leben, seine Ehe, die Kinder, sein Beruf … alles sollte plötzlich den Bach, ja die Donau runtergehen?! Jetzt, wo er mehr war als ein Wurm mit einer belanglosen Schleimspur. Beinahe schon ein richtiger Währinger war er, angesehen und wohlbestallt. Der Job passte, Ursula passte sowieso, die neu renovierte Wohnung passte, die Kinder passten, und sogar er schien seiner Frau zu passen. Dachte er jedenfalls.
Alleine ein kurzer Blick auf die aktuelle Familienchronik der Gradonegs zeigt, was so alles mit dieser Hafteinlieferung auf dem Spiel stand und gefährdet wurde:
Endlich, endlich, endlich … hatte sich das Füllhorn des bürgerlichen Glücks über sie ergossen. Denn die Gradonegs hatten geerbt und – wie gesagt – mit dem Sparstrumpf einer verstorbenen Tante die Wohnung picobello renoviert. Als sich beinahe zeitgleich der Alkoholiker in der Nachbarwohnung die Pulsadern aufschnitt, wurde ihr Glück auf tragische Weise noch perfekter. Haben Sie ein bisschen Geduld mit mir …, hatte Gradonegs Nachbar manchmal gelallt …, bald kann ich meine Gicht nimmer wegsaufen und dann mach ich Ihnen eine große Freude, versprochen. Und wie dieser Nachbar Wort hielt: Kaum hatten die bosnischen Arbeiter ihren VW-Bus vorm Haus geparkt, schon lag der Nachbar mit aufgeschnittenen Pulsadern in der Badewanne. Sogar die Hausverwaltung hatte er zuvor angerufen – „die nette Familie nebenan mit dem süßen Kater sollte seine Wohnung bekommen.“
Sozusagen zwei Tote und zwei Wohnungen auf einen Streich.
Zwei Kinderzimmer! Zwei Toiletten für die Gradonegs! Ein begehbarer Schrank!
Fast schon ein bürgerliches Refugium mit einem ökologischen Anstrich à la Ursula: Wände aus gepresstem Bio-Stroh, Tonverputz und Erdfarben; echtes Parkett und portugiesische Fliesen, Zirbenbetten für die Kinder, eine Mies-van-der-Rohe-Sofaimitation fürs Wohnzimmer. Wie in einem frisch lackierten Wald roch es bei den Gradonegs – und die Brise des Glücks wehte für sie weiter: Ursula hatte sich an ein eigenes Wollgeschäft gewagt, unten in der Währinger Staudgasse. Umgarnte dort ihre Kundinnen mit exklusiver Wolle aus den besten Manufakturen Europas. Strickte jeden Tag an einer neuen, erfolgreichen Geschäftsidee und bot sogar Hauben und Mützen aus Schafwolle von Wiener Streichelzoos an. „Haupt-Sache Wien“ nannte sie diese Kreationen, und Gradoneg bekam den ersten Prototypen davon.
Und die Kinder, Hemma und Josef?
Auch bei denen gab es nichts zu meckern. Hemma lernte im ersten Volksschuljahr die Welt zu entziffern. Josef schlug sich bravourös durch die zweite Klasse Gymnasium, sowohl im Unterricht als auch mit seinen Klassenkameraden. Und Gradoneg selbst stand seiner Frau und den Kindern um nichts nach: Er war kein billiger, schmieriger Anzeigenkeiler mehr, sondern ein fest angestelltes Redaktionsmitglied in einem aufstrebenden Verlag für ökologische Sachthemen. Sein einziger und bester Freund, Hannes Roschinic, hatte ihm diesen Job besorgt. „Pass einmal auf“, meinte Roschinic eines Tages zu Gradoneg, „die Freiheit ist nichts für dich. Frei sein ist für manche Menschen gefährlich … Sieht man ja an den ehemaligen Ostblockländern. Das geht meistens schief. Du brauchst Strukturen, unbedingt, sonst kennst du dich in der Welt nicht mehr aus, wie die im Ostblock. Also, ich hab da jemanden für dich … den Thomas Kneisler. Hab dich schon bei ihm angekündigt. Der Thomas Kneisler ist zwar menschlich das Letzte, aber deine Rettung. Bestimmt, glaub mir. Ist ein ehemaliger Pornoproduzent … aber wirklich nichts Schlimmes, nur so schmierige Hefteln und ein paar dreckige Filme. Diese Sachen sind aber längst Geschichte. Mittlerweile macht er nur noch auf Öko … so harmlose Magazine mit Bio-Sachen zum Nachkochen für Schickimickis und Gutmenschen. Ehrlich, vom Thomas ist aus seiner Zuhälterzeit kaum noch was übrig … bloß seine finanzielle Gier und seine Pizza-Sucht. Der ist nämlich gleich nach seiner Geburt und der Muttermilch auf Pizza umgestiegen. Und jetzt frisst er sich mit Bio-Pizzen zu Tode. Aber vertrau mir, außer den Pizzen und seiner Geldsucht ist er in Ordnung. So eine Art ‚Porno-Saulus‘, der zum ‚Bio-Paulus‘ konvertiert ist. Geh unbedingt zu dem hin. Ich hab alles geregelt. Mach das, der Thomas ist deine Rettung.“
Und das tat Gradoneg. Am nächsten Tag fixierte er einen Termin mit diesem Thomas Kneisler. Ursula bastelte ihm einen Lebenslauf am Computer. Mehr als ein paar mickrige Zeilen hatte sein beruflicher Werdegang nicht vorzuweisen. Nur das Foto stimmte einigermaßen mit einem Neunundvierzigjährigen überein, und selbst darauf waren zu viele Falten zu sehen.
Hannes Roschinics seltsame Vorschusslorbeeren für diesen Typen stimmten. Im Büro türmten sich die Pizza-Schachteln bis zur Decke, und Thomas Kneisler war derb und vulgär, doch kein Unsympathler. Ein dicker Glatzkopf, dem der Hüftspeck über die Hosentaschen hing und der sein abgetragenes Sakko wohl seit einer Ewigkeit nicht zuknöpfen konnte.
Das Vorstellungsgespräch war am frühen Vormittag, Kneisler saß bereits am Schreibtisch über seiner ersten Pizza. Mindestens bei jedem zweiten Satz tropfte ihm irgendeine Sauce aus dem Mund, die er mit seinen Fingern von den Lippen wischte, um damit dann seine Stirn und den kahlen Schädel einzuölen.
Kneisler kam gleich zur Sache:
„Der Roschinic hat dir bestimmt Hundert Lügen über mich erzählt, kann ich mir bei diesem Arschloch gar nicht anders vorstellen. Also, ich bin der Thomas ...“, fuhr sich Kneisler über die Lippen und reichte Gradoneg die Hand. „Wir sind doch per ‚Du‘, oder? So von Medienmensch zu Medienmensch“, ließ er Gradoneg erst gar nicht zu Wort kommen. „Aber sag ja nicht ‚Tommy‘ zu mir … ich bin nämlich keine Mayonnaise oder ein Modeschöpfer. ‚Thomas‘ reicht, von mir aus auch nur ‚Kneisler‘, sogar ‚alter Sack‘ oder ‚verwichstes Arschloch‘ ist mir lieber als ‚Tommy‘.“
Er lehnte sich zurück, kaute genüsslich, legte seine eingeölte Stirn in nachdenkliche Falten.
„Na gut, worum geht’s da in meinem Laden … Ich sag’s einmal frei heraus: ‚Um die besten Titten auf dem Teller.‘ Kapierst du: Alles was wir fressen, sind ‚Titten auf einem Teller‘, und die Frage ist nur, bei welchen Titten, also Fressalien die Leute so richtig zugreifen?“
Er sah Gradoneg in die Augen, erwartete aber keine Antwort; stattdessen klatschte er wie ein begeistertes Kind in die Hände: „Bingo! Das sind die Bio-Lebensmittel! Bei Bio greifen die Geldsäcke zu, und alle machen es denen nach. Wie beim Golfen … Von den Bankmanagern bis zu den grünen Schwuchteln, alle stopfen sich das rein. Ist doch logisch: Jeder will gesund sein und sich dabei verwöhnen. Koste es, was es wolle. Dort liegt das Geld. Beim Fressen … und nicht mehr bei den Schwänzen und gespreizten Beinen. Kapierst du. Diese Ökofuzzis kaufen sich einen Tesla und fast schon eine so teure Küche. Und damit sie dort ihre gesunden Freunderl beeindrucken können, brauchen sie die besten Rezepte mit den teuersten Zutaten. Und genau das servieren wir ihnen mit unseren Magazinen: Rezepte und Bio. So ein pipifeines Fressen bringt nämlich auch pipifeines Geld. Wirst schon sehen, inserieren alle brav bei uns. Du brauchst nur bei den Firmen anzurufen und kannst ihnen gleich die Rechnungen schicken. Ist viel Geld für nichts, wie in der Politik.“
Thomas Kneisler hatte seine letzte Pizza-Schnitte verdrückt. Er rülpste, ölte seine Glatze zum wiederholten Male mit den fettigen Fingern ein und erhob sich gemächlich aus seinem Bürostuhl: „Gut, wir sehen uns dann morgen so gegen neun, ja? Kann auch zehn oder später sein, aber dann legen wir los. Ich muss jetzt zu einem Termin. Plane gerade ein Sondermagazin über Kapaun-Spezialitäten. Weißt du überhaupt, was ein ‚Kapaun‘ ist? Klingt so fein, ist aber in Wirklichkeit bloß ein kastrierter Gockel. Einfach super … Die schneiden einem Gockel die Eier ab und verlangen das doppelte Geld dafür. Auf so eine Idee musst du einmal kommen: Eier ab, und in der Kasse klingelt es. Dabei dürften die das mit den Eiern gar nicht, hab ich recherchiert. Ist vom Österreichischen Tierschutzgesetz her verboten. Aber was machen die mit den Gockeln? Sie transportieren die Viecher nach Slowenien und lassen ihnen eben dort die Eier absäbeln. Nur so viel zur Schlepperei an den Staatsgrenzen. Unsere Polizei findet ja nicht einmal einen kastrierten Gockel.
Ach ja, weil wir gerade beim Geld sind … noch kurz zu deinem Gehalt: Ich zahl prinzipiell immer mehr, als sich das jemand erhofft. Wird dir genauso gehen. Du arbeitest einmal einen Monat, zeigst mir, was du so drauf hast, und ich überweis dir was. Entweder du fällst mir zufrieden um den Hals, oder du schaust mich schief an. Ja?!“
Und Gradoneg fiel Thomas Kneisler einen Monat später sehr zufrieden um den Hals. Er und das Konto vollzogen geradezu einen Freudensprung. Seine Augen glänzten wie Kneislers Glatze, er liebte diesen Job. Irgendwie mochte er diesen „Porno-Saulus und Bio-Paulus“, der so deftig aß, wie er sprach. Und sogar Gradonegs Sohn Josef holte den ‚Bio-Papa‘ immer öfter und stolzer vom Büro ab. Wollte sogar unbedingt in Kneislers Redaktion sein schulisches Berufspraktikum machen. Was Gradoneg nicht schmeckte. Denn wer wünschte sich schon einen Sohn, der wie ein Pornoproduzent daherredete?
Ansonsten waren jedoch Thomas Kneisler und Gradoneg ein perfektes Gespann. Ihre Ideen sprießten wie die Pizzaschachteln, ein Magazin nach dem anderen warfen sie auf den Markt und begossen es hinterher mit Demeter-Wein.
Kneisler war ein Goldesel, auf gut Wienerisch ein ,Blitzgneißer‘.
Und gerade landeten die beiden ihren größten Coup: Eine ganze fünfköpfige Familie stellten sie von einer konventionellen Ernährung auf eine biologische Schlemmerkur um. Kneisler hatte diese Idee aus einem schwedischen Magazin gestohlen, war wie besessen davon und voll Tatendrang. „Kapierst du, einfach genial, diese skandinavischen Wickies … Die sind dort auf einer Uni draufgekommen, dass alle, die sich mit konventionellen Lebensmitteln vollstopfen, dann das chemische Zeugs von den Feldern und Pflanzen in sich drinnen haben. Verstehst du: Oben stopfen wir beim Fressen die Chemie rein und unten rinnt sie wieder raus. Lauter giftige Spritzmittel, die wir auspinkeln. Sogar in der Muttermilch ist was davon drinnen. Unsere Babys sind von Geburt an Spritzmittel-Junkies. Super, was? Aber nun kommt erst das Beste: Zum Glück kann man diese chemischen Rückstände im Urin messen. Gute Labors schaffen das. Und was die Schweden können, können wir schon längst: Wir schnappen uns auch ein paar Spritzmittel-Fresser, lassen sie in ein Röhrchen pinkeln, und ab damit ins Labor. Und in der Zwischenzeit füttern wir dieselben Personen ein paar Wochen lang mit Bio und lassen ihren Urin wieder im Labor testen. Verstehst du, was ich meine?“
Kneisler schlug begeistert mit der Faust auf den Bürotisch.
„Peng! Plötzlich sind alle giftigen Spritzmittel weg, und die ganze Familie ist glücklich. Das ist die perfekte Story, kapierst du, richtig zum Abspritzen! Bei dieser Geschichte inserieren alle Bio-Firmen. Wir krallen uns sofort eine Familie mit zwei, drei fetten Kindern und machen das. Möglichst sozial benachteiligte Fettsäcke aus einem Gemeindebau, dann springen noch mehr Inserenten auf. Mitleid zahlt sich aus.“
Und so war es, das Geschäft mit den Inseraten lief wie geschmiert. Via Facebook hatten Kneisler und Gradoneg eine Floridsdorfer Familie aufgetrieben, im hintersten Winkel eines heruntergekommenen Gemeindebaus. Absolut perfekte Probanden: Die Eltern arbeitslos, die Kinder brachten jede Menge Kilos auf die Waage, und alle ihre Urinröhrchen liefen vor chemisch-synthetischen Spritzmitteln über.
„Dass diese Menschen bei den Werten überhaupt noch leben“, schüttelte der Laborant auf der ‚Universität für Bodenkultur Wien‘ entgeistert den Kopf. „Ich habe ihre Urinproben drei Mal analysiert. Die könnten mit ihrem Urin den Rasen im Praterstadion düngen. Wusste gar nicht, dass es noch so viel Glyphosat in Österreich gibt. Also, das kann nicht gut gehen, nein … Bin schon gespannt, welchen Krebs die eines Tages haben.“
Dieser Laborant, ein gewisser Dr. Friedrich Randelsberger, war Gradonegs Geniestreich. Ein wissenschaftlicher Kapazunder, eine „Koryphäe“, von der berühmten Universität für Bodenkultur, der BOKU. Hundertmal hatte ihn Gradoneg telefonisch bekniet, zweimal zum Essen eingeladen und schließlich mit einer Kiste Bio-Wein und einem gut bestückten Kuvert für dieses wichtige Projekt an Bord geholt.
Ein seriöser Wissenschaftler, eine namhafte Universität und Kunden, die sich um den besten Inseratenplatz rauften! Ja, was wollte der Mensch mehr, was wollte Gradoneg mehr?
Selbst mit seinem Grant auf Währing schloss er in den letzten Monaten Frieden. Denn mit der Brieftasche schwoll ebenfalls sein Selbstbewusstsein an. Nicht alle Währinger waren so hochnäsig wie ihr Rathausturm, und nicht alle liefen als Biedermeier-Zombies durch die Straßen, kapierte Gradoneg allmählich. Man musste nur Geld haben – und Währing sah anders aus. Seine Ursula hatte recht: Währing war ein wunderschönes Kurstädtchen. Und könnte man Währing ausgraben und aufs Land verpflanzen, würden alle anderen österreichischen Städte vor Neid erblassen. Das Kärntner Velden würde sich beleidigt im Wörthersee ertränken und Kitzbühel würde sich wütend über die Hahnenkamm-Abfahrt in den Tod stürzen.
Und dies alles sollte er nun gewaltsam verlieren?!
Die Frau und die Kinder, den Beruf und die Ehre, das Zuhause und die Heimat?!
Alles, alles sich nehmen lassen … so wie sie es jetzt gerade in der Justizanstalt Josefstadt mit seinen Habseligkeiten taten?
Wie mit einem dreckigen Schwerverbrecher waren sie mit ihm dort vorgefahren und filzten ihn: Die Brieftasche mit der Bankomatkarte, dem Bargeld, der eCard und dem Identitätsausweis; das Handy mit dem zersprungenen Display, die Schlüssel und den Hosengürtel. Den Ehering zogen sie ihm ebenfalls vom Finger. Jede Tasche drehten sie ihm hundertmal um und leerten sie bis auf den letzten Stofffussel. Und mindestens so oft tasteten sie seinen Körper ab. Die Arme, die Achseln, den Brustkorb, die Hüften, die Oberschenkel und die Waden …. bis sie endlich begriffen, dass er längst nackt war, und ihn abführten.