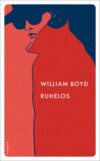Kitabı oku: «Ruhelos», sayfa 3
Wieder reagierte ihr Vater mit einem übertriebenen, fast parodistischen Gesichtsausdruck: Diesmal war es Verblüffung, ein so komplettes Unverständnis, dass ihm schwindlig wurde. Er setzte sich hin, wie um es unter Beweis zu stellen.
»Eva«, sagte er mit ernster, getragener Stimme. »Überleg doch mal: Du musst es tun. Aber nicht wegen des Geldes oder wegen des Passes oder damit du in England leben kannst. Es ist doch ganz einfach: Du musst es für Kolja tun – für deinen Bruder.« Er zeigte auf Koljas Foto. »Kolja ist tot«, sagte er, und es klang einfältig, fast idiotisch – als hätte er die Tatsache seines Todes eben erst zur Kenntnis genommen. »Ermordet. Was bleibt dir da anderes übrig?«
»Gut, ich werde darüber nachdenken«, erwiderte sie kühl, um sich nicht von seinen Gefühlen überrumpeln zu lassen, und ging hinaus. Aber ungeachtet dessen, was die rationale Seite ihres Verstandes sagte – alles abwägen, nichts übereilen, es ist dein Leben, um das es hier geht –, wusste sie, dass ihr Vater schon alles Wesentliche gesagt hatte. Es ging weder um Geld noch um den Pass, noch um ihre Sicherheit. Kolja war tot. Kolja war ermordet worden. Sie musste es für Kolja tun. So einfach war das.
Sie sah Romer zwei Tage später auf der anderen Straßenseite stehen, als sie zum Essen ging, unter der Markise der Épicerie wie an jenem ersten Tag. Diesmal wartete er, dass sie auf ihn zuging, und als sie die Straße überquerte, spürte sie einen starken Widerstand – als wäre sie abergläubisch und soeben mit einem bösen Omen konfrontiert worden. Ein absurder Gedanke kam in ihr hoch: Fühlen sich Menschen so, wenn sie in eine Ehe einwilligen?
Sie tauschten einen Händedruck, und Romer führte sie in das Café. Nachdem er bestellt hatte, überreichte ihr Romer einen gelbbraunen Umschlag. Er enthielt einen Pass, fünfzig Pfund in bar und eine Fahrkarte von Paris, Gare du Nord, nach Edinburgh, Waverley Station.
»Und wenn ich Nein sage?«
»Dann geben Sie mir alles zurück. Niemand wird Sie zwingen.«
»Aber Sie hatten den Pass schon fertig.«
Romer zeigte beim Lächeln die Zähne. Vielleicht ist das Lächeln diesmal echt, dachte sie.
»Sie ahnen ja nicht, wie leicht es ist, einen Pass zu fälschen. Nein, ich dachte mir …« Er zog die Stirn kraus. »Ich kenne Sie nicht so, wie ich Kolja kannte, aber ich dachte mir, seinetwegen und weil Sie mich an ihn erinnern, gäbe es eine Chance, dass Sie bei uns mitmachen.«
Eva musste fast lachen beim Gedanken an das Gespräch, diese Mischung aus Aufrichtigkeit und abgrundtiefer Verlogenheit, und beugte sich zum Fenster, als der Zug unter Dampf in Edinburgh einfuhr. Sie verrenkte den Hals, um die Burg auf dem Felsen zu sehen – fast schwarz, wie aus Kohle auf einen Kohlefelsen gebaut, ragte sie über ihr auf, während der Zug langsamer wurde und in den Bahnhof einfuhr. Jetzt erschienen Streifen von Blau zwischen den dahinjagenden Wolken, es wurde heiterer, der Himmel war nicht mehr weiß und neutral – vielleicht wirkten deshalb die Burg und der Felsen so schwarz.
Sie stieg mit ihrem Koffer aus dem Zug (»nur einen Koffer«, hatte Romer insistiert) und lief den Bahnsteig entlang. Er hatte ihr lediglich gesagt, dass sie abgeholt würde. Ihr Blick streifte Familien und Pärchen, die sich begrüßten und umarmten, höflich lehnte sie die Dienste eines Gepäckträgers ab und betrat die große Bahnhofshalle.
»Miss Dalton?«
Sie drehte sich um – und staunte, wie schnell sie sich an ihren neuen Namen gewöhnt hatte, denn Miss Eve Dalton war sie erst seit zwei Tagen. Vor ihr stand ein etwas feister Mann mit zu engem grauem Anzug und zu engem Kragen.
»Ich bin Staff Sergeant Law«, sagte der Mann. »Bitte folgen Sie mir.« Er bot ihr nicht an, den Koffer zu tragen.
2 Ludger Kleist
»Yes, Mrs Amberson thought, it was my doing nothing that made the difference.«
Hugues blickte noch verstörter drein als gewöhnlich, beinahe entsetzt. Die englische Grammatik machte ihm sowieso zu schaffen – er ächzte, stöhnte, murmelte Französisches –, aber heute trieb ich ihn zur Verzweiflung.
»My doing nothing – was?«, sagte er hilflos.
»My doing nothing – nichts. Das ist ein Gerundium.« Ich versuchte, munter und motiviert auszusehen, beschloss dann aber, zehn Minuten früher Schluss zu machen. Im Kopf spürte ich den Druck erzwungener Konzentration – ich hatte mich mit wahrem Feuereifer in die Arbeit gestürzt, nur um meinen Verstand zu beanspruchen –, aber nun war es vorbei mit meiner Geduld. »Das Gerundium und das Gerundiv nehmen wir uns morgen vor«, sagte ich, klappte das Buch zu (Life with the Ambersons, Vol. III), und da ich sah, wie sehr ich ihn verunsichert hatte, fügte ich begütigend hinzu: »C’est très compliqué.«
»Ah, bon.«
Nicht nur Hugues, auch ich hatte die Amberson-Familie und ihre anstrengenden Ausflüge durch die englische Grammatik gründlich satt. Und doch war ich an die Ambersons und ihren schrecklichen Lebenswandel gefesselt wie ein Lohndiener, denn der nächste Schüler war schon im Anmarsch – also noch zwei Stunden in ihrer Gesellschaft.
Hugues zog seine Jacke über – sie war olivgrün und schwarz kariert und vermutlich aus Kaschmirwolle. Offenbar sollte es eine Jacke sein, wie sie von typischen Engländern getragen wurde, wenn sie nach ihren Hunden schauten, ihren Gutsinspektor aufsuchten, Tee mit ihrer alten Tante tranken, aber ich musste zugeben, dass mir ein Landsmann mit so edler und gut geschnittener Kleidung noch nicht über den Weg gelaufen war.
Hugues Corbillard stand in meinem kleinen, engen Arbeitszimmer, noch immer mit verstörtem Gesicht, und strich über seinen blonden Schnurrbart – sicher denkt er über das Gerundium und das Gerundiv nach, dachte ich. Er war eine junge, aufstrebende Führungskraft bei P’TIT PRIX, einer französischen Discounterkette, und seine Chefs hatten ihn dazu verdonnert, sein Englisch aufzubessern, damit P’TIT PRIX neue Märkte erschließen konnte. Ich mochte ihn – eigentlich mochte ich die meisten meiner Schüler –, aber Hugues war von einer seltenen Faulheit. Oft sprach er die ganze Stunde hindurch Französisch, während ich Englisch mit ihm redete, aber heute hatte ich ihn über die Eskaladierwand gejagt. Normalerweise redeten wir über alles, nur nicht über englische Grammatik, um uns die Ambersons und ihre Abenteuer zu ersparen – ihre Reisen, ihre kleinen Katastrophen (tropfende Wasserhähne, Windpocken, gebrochene Gliedmaßen), Verwandtenbesuche, Weihnachtsfeiertage, Schulprüfungen und so weiter –, und immer öfter landete unsere Unterhaltung bei der außergewöhnlichen Hitze dieses Sommers, bei den Qualen, die Hugues in seinem stickigen Bed & Breakfast auszuhalten hatte, bei seiner Empörung, dass ihm abends um sechs, während die Sonne auf den versengten und ausgedörrten Garten niederbrannte, eine reguläre Mahlzeit in drei Gängen zugemutet wurde. Wenn ich Gewissensbisse bekam und Hugues ermahnte, Englisch zu sprechen, erwiderte er mit schüchternem Lächeln und im Wissen, dass er gegen die strengen Vertragsbestimmungen verstieß, es sei schließlich alles Konversation, n’est-ce pas?, und diene daher der Verständigung, oder? Ich widersprach nicht, schließlich bekam ich sieben Pfund dafür, dass ich eine Stunde mit ihm plauderte – und wenn er zufrieden war, war ich’s auch.
Ich führte ihn durch die Wohnung zur hinteren Treppe. Wir befanden uns im ersten Stock, und im Garten sah ich Mr Scott, meinen Vermieter und Zahnarzt, bei seinen skurrilen Lockerungsübungen – er wedelte mit den Armen und stampfte mit seinen großen Füßen, bevor er sich in der Praxis unter mir einen neuen Patienten vorknöpfte.
Hugues verabschiedete sich, ich setzte mich in die Küche, bei offener Tür, und wartete auf die nächste Schülerin von Oxford English Plus. Das war ihre erste Stunde, und außer ihrem Namen – Bérangère Wu –, ihrem Status – Anfänger/Fortgeschritten – und ihrem Stundenplan – vier Wochen lang zwei Stunden täglich – wusste ich wenig über sie. Gut verdientes Geld. Dann hörte ich Stimmen im Garten und trat hinaus auf die schmiedeeiserne Treppe und sah, wie Mr Scott auf eine kleine Frau im Pelzmantel einredete, wobei er wiederholt auf den Ausgang zeigte.
»Mr Scott«, rief ich, »ich glaube, die Dame will zu mir.«
Die Frau – eine junge Frau, eine junge orientalische Frau – erklomm die Treppe zu meiner Küche. Sie trug trotz der Sommerhitze ihren langen, teuer aussehenden gelbbraunen Pelzmantel lose über der Schulter, und soweit ich es auf die Schnelle beurteilen konnte, sahen auch ihre anderen Sachen – die Satinbluse, die Camel-Hose, der schwere Schmuck – sehr teuer aus.
»Hallo, ich bin Ruth«, sagte ich. Wir gaben uns die Hand.
»Bérangère«, erwiderte sie und blickte sich in der Küche um wie eine Herzoginwitwe zu Besuch bei ihren armen Pächtern. Sie folgte mir ins Arbeitszimmer, wo ich ihr den Mantel abnahm und sie Platz nehmen ließ. Den Mantel hängte ich an den Türhaken, er war beinahe schwerelos.
»Ein wunderschöner Mantel«, sagte ich. »Und so leicht. Woraus ist er denn?«
»Das ist ein Fuchs aus Asien. Er wird rasiert.«
»Ein rasierter asiatischer Fuchs.«
»Ja … Ich spreche Englisch nicht so gut«, sagte sie.
Ich griff nach Living with the Ambersons, Vol. I. »Dann fangen wir doch einfach am Anfang an.«
Ich glaube, ich mag Bérangère, dachte ich, als ich die Straße hinablief, um Jochen von der Schule abzuholen. Während der zwei Stunden Unterricht (in denen wir die Familie Amberson kennenlernten – Keith und Brenda, ihre Kinder Dan und Sara sowie den Hund Rasputin) hatten wir beide vier Zigaretten geraucht (alles ihre) und zwei Tassen Tee getrunken. Ihr Vater sei Vietnamese, sagte sie, ihre Mutter Französin. Sie, Bérangère, arbeite in einem Pelzgeschäft in Monte Carlo – FOURRURES MONTE CARLO –, und wenn sie ihr Englisch verbessere, werde sie zur Geschäftsführerin befördert. Sie war unglaublich zierlich, von der Statur einer Neunjährigen, dachte ich, eine dieser Kindfrauen, in deren Gegenwart ich mir vorkam wie eine derbe Bauernmaid oder eine Ostblock-Athletin. Alles an ihr wirkte gehegt und gepflegt: ihr Haar, ihre Nägel, ihre Brauen, ihre Zähne – und ich war mir sicher, dass sie diese penible Sorgfalt auch den Regionen ihres Körpers zuteilwerden ließ, die für mich unsichtbar blieben: ihren Zehennägeln, ihrer Unterwäsche – ihrem Schamhaar, wie ich mir denken konnte. Neben ihr kam ich mir räudig und ausgesprochen schmuddelig vor, aber hinter dieser manikürten Perfektion verbarg sich, so viel spürte ich, eine andere Bérangère. Beim Abschied fragte sie mich, wo man in Oxford Männer treffen könne.
Ich war die erste Mutter vor dem Eingang zur Vorschule Grindle’s in der Rawlinson Road. Nach dem zweistündigen Nikotinexzess mit Bérangère gierte ich nach einer weiteren Zigarette, aber vor der Schule wollte ich es mir doch lieber verkneifen, und um mich abzulenken, dachte ich an meine Mutter.
Meine Mutter Sally Gilmartin, geborene Fairchild. Nein, meine Mutter Eva Delektorskaja, halb Russin, halb Engländerin, ein Flüchtling der Revolution von 1917. Das ungläubige Lachen schnürte mir die Kehle zu, und ich merkte, dass ich heftig den Kopf schüttelte. Bleib ernst, bleib vernünftig, ermahnte ich mich. Die plötzliche Eröffnung meiner Mutter war in mein Leben hereingeplatzt wie eine Bombe, sodass ich sie anfangs als Märchen abtat und die Wahrheit nur langsam, in kleinen Schüben an mich heranließ. Es war einfach zu viel, um mit einem Mal verkraftet zu werden, und der Vergleich mit der Bombe war ausnahmsweise einmal passend. Ich kam mir vor wie ein Haus, das durch einen Beinahe-Treffer erschüttert wurde: eine dicke Staubwolke, abgeplatzte Kacheln, zerborstene Scheiben. Das Haus stand noch, aber es war angeknackst, aus den Fugen geraten und hatte seine Stabilität verloren. Anfangs hätte ich am liebsten an eine Art Wahngebäude geglaubt, eine beginnende Altersdemenz bei meiner Mutter, aber mir war schnell klar, dass es sich dabei um ein ziemlich kaputtes Wunschdenken meinerseits handelte. Meine andere Gehirnhälfte sagte: Nein, stell dich den Tatsachen. Alles, was du über deine Mutter zu wissen glaubtest, war eine raffiniert gebastelte Legende. Ich fühlte mich plötzlich allein, hilflos, im Dunkeln zurückgelassen. Was macht man in einer solchen Lage?
Ich kramte alles zusammen, was ich über die Vergangenheit meiner Mutter wusste. Sie war in Bristol geboren, so die Legende, als Tochter eines Holzhändlers, der in den zwanziger Jahren nach Japan gegangen war. Dort wurde sie von einer Hauslehrerin unterrichtet und arbeitete, wieder in England, als Sekretärin bis zum Tod ihrer Eltern kurz vor dem Krieg. Ich erinnerte mich, dass sie von ihrem geliebten Bruder Alisdair erzählt hatte, der 1942 bei Tobruk umgekommen war … Dann die Hochzeit mit meinem Vater, Sean Gilmartin, während des Krieges in Dublin. Ende der Vierziger gingen sie nach England zurück, nach Banbury, Oxfordshire, wo Sean bald eine gut gehende Anwaltspraxis besaß. Die Geburt der Tochter Ruth folgte 1949. So weit alles ziemlich normal und durchschnittlich – nur die Jahre in Japan geben der Sache einen fremdländisch-exotischen Touch. Ich konnte mich sogar an ein altes Foto von Alisdair erinnern, Onkel Alisdair, das eine Weile auf dem Tischchen im Wohnzimmer gestanden hatte. Und an ausgewanderte Cousins und andere Verwandte in Südafrika und Neuseeland, über die gelegentlich geredet wurde. Wir kriegten sie nie zu sehen, manchmal kam eine Weihnachtskarte. Die in alle Welt ausgeschwärmten Gilmartins dagegen versorgten uns mit mehr Verwandtschaft, als ich verkraften konnte (mein Vater hatte zwei Brüder und zwei Schwestern, es gab gut ein Dutzend Cousins und Cousinen). Nicht die geringsten Besonderheiten also, eine Familiengeschichte wie jede andere, nur der Krieg und seine Folgen hatten ihre Einschnitte in den ansonsten völlig unauffälligen Biografien hinterlassen. Sally Gilmartin war undurchsichtig wie dieser Torpfosten, dachte ich. Ich legte die Hand auf den warmen Sandstein, und mir wurde klar, wie wenig wir in Wahrheit über unsere Eltern wissen, wie vage und unbestimmt sie ihre Biografie beschreiben, fast wie Heiligengeschichten – alles nur Legende und Anekdote –, bis wir uns die Mühe machen, tiefer zu graben. Und nun diese neue Geschichte, die alles änderte. Beim Gedanken an all die Enthüllungen, die mir noch bevorstanden, spürte ich ein Würgen im Hals – als wäre das, was ich schon wusste, nicht erschreckend genug. Etwas im Tonfall meiner Mutter sagte mir, dass sie mir alles erzählen wollte, bis ins kleinste, intimste Detail. Vielleicht hatte die Eva Delektorskaja, die ich nie kennengelernt hatte, nun beschlossen, dass ich absolut alles über sie erfahren sollte.
Inzwischen waren noch andere Mütter gekommen. Ich lehnte mich an den Torpfosten und rieb die Schultern am rauen Sandstein. Eva Delektorskaja, meine Mutter … Was sollte ich davon glauben?
»Sie haben beide eine Eins«, flüsterte mir Veronica Briggstock ins Ohr und riss mich aus meinen Grübeleien. Ich drehte mich um und gab ihr aus irgendeinem Grund einen Wangenkuss – normalerweise umarmten wir uns nicht mal, weil wir uns fast täglich sahen. Veronica – auf keinen Fall Vron, auf keinen Fall Nic – war Krankenschwester in der John-Radcliffe-Klinik und geschieden von Ian, einem Labortechniker am Chemischen Institut der Uni. Ihre Tochter Avril war Jochens beste Freundin.
Wir standen beieinander und tauschten die Neuigkeiten des Tages aus. Ich erzählte von Bérangère und ihrem eindrucksvollen Mantel, während wir darauf warteten, dass unsere Kinder aus der Schule kamen. Die Single-Mütter vor der Schule schienen sich unbewusst – oder auch bewusst – zueinander hingezogen zu fühlen: Obwohl sie die verheirateten Mütter und die gelegentlich auftauchenden täppischen Väter mit vollendeter Höflichkeit behandelten, blieben sie offenbar am liebsten unter sich. Sie konnten ihre speziellen Probleme austauschen, ohne lange Erklärungen, und es gab keinen Grund, unser Single-Dasein zu verleugnen – wir hatten alle unsere Geschichten zu erzählen.
Wie um das zu illustrieren, zog Veronica heftig über Ian her, der sich, seit er eine neue Freundin hatte, immer öfter vor den vereinbarten Wochenenden mit Avril drücken wollte. Als die ersten Kinder herauskamen, unterbrach sie sich, und mich befiel sofort die irrationale Angst, die ich immer bekam, wenn ich unter den vertrauten Gesichtern nach Jochen suchte. Irgendeine atavistische Mutterangst, vermutlich – das Höhlenweibchen hält Ausschau nach seiner Brut. Dann sah ich ihn – sein ernstes, spitzes Gesicht, seine Augen, die nach mir suchten –, und die Angst war so schnell weg, wie sie gekommen war. Ich überlegte, was ich zum Abendessen machen sollte und welche Sendung wir sehen könnten. Alles war wieder im Lot.
Zu viert trotteten wir die Banbury Street hinauf nach Hause. Es war später Nachmittag, und die Hitze drückte uns körperlich nieder, als hätte sie um diese Zeit eine besondere Schwerkraft. Veronica meinte, seit ihrem Tunesienurlaub sei ihr nicht mehr so heiß gewesen. Vor uns liefen Avril und Jochen, Hand in Hand, in ein Gespräch vertieft.
»Was reden die beiden so viel?«, fragte Veronica. »Die haben doch noch gar nichts erlebt.«
»Als hätten sie die Sprache eben erst entdeckt«, sagte ich. »Du weißt schon: Wenn ein Kind erst mal Seilspringen gelernt hat, hört es überhaupt nicht mehr auf zu springen.«
»Ja, also reden können sie wirklich …« Sie lächelte. »Hätte ich doch einen kleinen Jungen! Einen großen, starken Mann, der sich um mich kümmert.«
»Wollen wir tauschen?«, sagte ich unüberlegt, aus irgendeinem dummen Grund, und fühlte mich plötzlich schuldig, als hätte ich Jochen irgendwie verraten. Er hätte das nicht witzig gefunden und mich angeschaut mit seinem strengen, finsteren, gekränkten Blick.
Wir hatten unsere Straßenecke erreicht. Ich bog links in die Moreton Road, zu unserem Zahnarzt, Veronica und Avril mussten weiter bis nach Summertown, wo sie über dem italienischen Restaurant La dolce vita wohnten – ihr gefiel diese tägliche Ironie, meinte sie, das ewige leere Versprechen. Als wir noch dastanden und vage Pläne für einen Bootsausflug am Wochenende schmiedeten, brachte ich plötzlich das Gespräch auf meine Mutter Sally/Eva. Wenigstens mit einem Menschen musste ich darüber reden, bevor ich meine Mutter wiedersah, dachte ich mir, vielleicht half mir das, die neuen Tatsachen leichter zu verkraften – und meiner Mutter gegenüberzutreten. Es würde kein Geheimnis zwischen Mutter und Tochter bleiben, wenn auch Veronica Bescheid wusste – ich brauchte eine außerfamiliäre Stütze, um nicht den Halt zu verlieren.
»Mein Gott«, sagte Veronica. »Eine Russin?«
»Ihr richtiger Name ist Eva Delektorskaja, sagt sie.«
»Und geht es ihr gut? Oder vergisst sie Namen, Daten, Sachen?«
»Nein, ihr Verstand ist messerscharf.«
»Geht sie oft weg und kommt zurück, weil sie nicht mehr weiß, wohin sie wollte?«
»Nein«, sagte ich, »ich glaube, man muss davon ausgehen, dass alles in Ordnung mit ihr ist«, und erzählte weiter. »Dann macht sie noch etwas, es ist fast eine Art Manie. Sie glaubt, dass sie beobachtet wird. Vielleicht auch eine Art Paranoia … Sie ist misstrauisch gegen Sachen, gegen Menschen. Ach, und dann hat sie einen Rollstuhl – angeblich, weil sie sich den Rücken verletzt hat. Aber das stimmt nicht, sie ist fit wie ein Turnschuh. Sie denkt, dass irgendwas im Gange ist, irgendwelche dunklen Machenschaften, die sich gegen sie richten, und deshalb hat sie beschlossen, mir alles zu sagen, die ganze Wahrheit.«
»War sie beim Arzt?«
»O ja. Der Arzt hat das mit dem Rücken geglaubt und ihr den Rollstuhl besorgt.« Ich überlegte kurz und erzählte ihr auch noch den Rest. »Sie sagt, sie wurde 1939 vom britischen Geheimdienst rekrutiert.«
Veronica musste lächeln, doch dann zeigte sie Betroffenheit. »Aber abgesehen davon scheint sie völlig normal?«
»Definier mir doch ›normal‹«, erwiderte ich.
Wir trennten uns, und ich lief mit Jochen durch die Moreton Road. Mr Scott, der Zahnarzt, der gerade in seinen neuen Triumph Dolomite stieg, stieg wieder aus und machte eine Show daraus, Jochen Pfefferminz anzubieten – das machte er immer, wenn er Jochen sah, und er war immer mit allen möglichen Sorten und Arten von Pfefferminz ausgerüstet. Als er rückwärts rausgefahren war, gingen wir am Haus vorbei nach hinten zu unserem »Stufengang«, wie Jochen die Eisentreppe nannte, die uns einen eigenen Zugang zu unserer Wohnung im ersten Stock ermöglichte. Der Nachteil war nur, dass alle durch die Küche mussten, aber das war besser, als durch die Praxis mit ihren penetranten Gerüchen zu gehen – Mundwasser, Zahnpasta und Teppichreiniger.
Wir aßen Käsetoast und Baked Beans zum Abendbrot und sahen einen Film über ein kleines, rundes orangerotes U-Boot, das den Meeresboden erforschte. Ich brachte Jochen ins Bett, ging ins Arbeitszimmer und suchte den Hefter mit meiner halbfertigen Doktorarbeit: »Revolution in Deutschland, 1918–1923«. Ich schlug das letzte Kapitel auf – »Der Fünffrontenkrieg Gustavs von Kahr« –, versuchte mich zu konzentrieren und überflog ein paar Absätze. Seit Monaten hatte ich nichts mehr dafür getan, und es war, als würde ich einen fremden Text lesen. Zum Glück hatte ich den faulsten Doktorvater von ganz Oxford – ein ganzes Semester konnte ohne einen einzigen Termin vergehen –, und ich unterrichtete Englisch als Fremdsprache, kümmerte mich um meinen Sohn, besuchte meine Mutter und tat sonst nichts, wie es schien. Ich war in der Lehrerfalle gefangen, ein allzu gängiges Schicksal für so manchen Oxford-Absolventen. Ich verdiente sieben Pfund steuerfrei pro Stunde, und wenn ich wollte, konnte ich acht Stunden am Tag unterrichten, zweiundfünfzig Wochen im Jahr, und selbst wenn ich die Zeit abzog, die ich mit Jochen verbrachte, würde ich in diesem Jahr über achttausend Pfund netto verdienen. Die letzte Stelle, um die ich mich vergeblich beworben hatte, eine Geschichtsdozentur an der University of East Anglia, bot (brutto) nur annähernd die Hälfte von dem, was ich mit dem Unterrichten für Oxford English Plus verdiente. Eigentlich konnte ich mich über meinen Reichtum freuen: keine Mietschulden, ein ziemlich neuer Wagen, Schulgebühren bezahlt, Kreditkarte im grünen Bereich, ein bisschen Geld auf der Bank – aber stattdessen überfielen mich plötzlich das Selbstmitleid und die Wut. Wut auf Karl-Heinz, Wut, weil ich nach Oxford zurückmusste, Wut, weil ich ausländischen Studenten für schnelles Geld Englisch beibringen musste, Wut (und entsprechende Schuldgefühle), weil mein kleiner Sohn mir meine Freiheiten beschnitt, Wut auf meine Mutter, die plötzlich mit dieser abenteuerlichen Geschichte über ihre Vergangenheit herausrückte … So war das alles nicht geplant gewesen, das war nicht das Leben, das ich mir ausgesucht hatte. Ich war siebenundzwanzig Jahre alt. Was war passiert?
Ich rief meine Mutter an. Eine merkwürdig tiefe Stimme meldete sich.
»Ja.«
»Mummy? Sal? – Ich bin’s.«
»Alles in Ordnung?«
»Ja.«
»Dann ruf mich gleich zurück.«
Ich tat es. Das Telefon klingelte viermal, bevor sie abnahm.
»Du kannst nächsten Samstag kommen«, sagte sie, »und mir ist es recht, wenn du Jochen hierlässt. Er kann hier übernachten, wenn du möchtest. Tut mir leid wegen letztem Wochenende.«
»Was ist das für ein Klicken?«
»Das bin ich. Ich klopfe mit dem Bleistift an den Hörer.«
»Und was soll das?«
»Ein Trick. Um Leute zu irritieren. Verzeih, ich höre schon auf.« Sie zögerte kurz. »Hast du gelesen, was ich dir gegeben habe?«
»Ja. Ich hätte schon früher angerufen, aber ich musste es erst mal verdauen. Ein kleiner Schock, wie du dir denken kannst.«
»Ja, natürlich.« Sie schwieg einen Moment. »Aber ich wollte, dass du’s erfährst. Es war der richtige Zeitpunkt.«
»Ist das alles wahr?«
»Natürlich. Jedes Wort.«
»Das heißt also, dass ich Halbrussin bin.«
»Ich fürchte, ja, Liebling. Aber eigentlich nur Viertelrussin. Meine Mutter, deine Großmutter, war Engländerin, erinnerst du dich?«
»Wir müssen darüber reden.«
»Da kommt noch mehr auf dich zu. Viel mehr. Du wirst alles verstehen, wenn du den Rest erfährst.«
Dann wechselte sie das Thema und fragte nach Jochen, wie sein Tag gelaufen war, ob er etwas Ulkiges gesagt hatte, und während ich von ihm erzählte, braute sich etwas in meinem Bauch zusammen, als müsste ich dringend aufs Klo – es war die plötzliche Angst vor dem, was mir bevorstand, und die kleine, nagende Furcht, dass ich es nicht verkraften würde. Es komme noch mehr auf mich zu, hatte sie gesagt, viel mehr – was war dieses »Alles«, das ich am Ende verstehen würde? Wir redeten noch Belangloses, verabredeten uns für den nächsten Samstag, und ich legte auf. Ich drehte mir einen Joint, rauchte ihn sorgfältig auf, ging ins Bett und schlief acht Stunden lang, ohne zu träumen.
Als ich am nächsten Morgen von Grindle’s zurückkam, saß Hamid auf der obersten Stufe unserer Treppe. Er trug eine kurze schwarze Lederjacke, die neu war und nicht zu ihm passte, wie ich fand, er wirkte in ihr kastenförmig und bullig. Hamid Kazemi, Anfang dreißig, Bartträger, war ein stämmiger iranischer Ingenieur mit den breiten Schultern eines Gewichthebers. Und er war mein dienstältester Schüler.
Er hielt mir die Küchentür auf, wies mich mit seiner gewohnt höflich-akkuraten Geste hinein, machte mir ein Kompliment wegen meines guten Aussehens (mit denselben Worten wie vierundzwanzig Stunden zuvor) und folgte mir durch die Wohnung ins Arbeitszimmer.
»Sie haben nichts zu meiner Jacke gesagt«, sagte er auf seine direkte Art. »Gefällt sie Ihnen nicht?«
»Sie gefällt mir ganz gut«, erwiderte ich, »aber mit dieser Sonnenbrille und den schwarzen Jeans sehen Sie aus wie ein SAVAK-Agent.«
Er versuchte zu verbergen, dass er den Vergleich alles andere als lustig fand – und ich sah ein, dass der Scherz für einen Iraner vielleicht ein bisschen geschmacklos war, also entschuldigte ich mich. Hamid hasste den Schah von Persien, und das mit ganz besonderer Leidenschaft, wie mir jetzt einfiel. Er zog die Jacke aus und hängte sie sorgfältig über die Stuhllehne. Ich roch das neue Leder und dachte an Geschirrkammern und Sattelpolitur – ein Geruch, der mich an meine fernen Mädchenjahre erinnerte.
»Ich habe den Bescheid über meine Versetzung erhalten«, sagte er. »Ich werde nach Indonesien gehen.«
»Ich gehe nach Indonesien. Ist das gut? Freuen Sie sich?«
»Ich gehe … Ich wollte Lateinamerika, sogar Afrika …« Er zuckte die Schultern.
»Für mich klingt Indonesien ganz aufregend«, sagte ich und griff nach den Ambersons.
Hamid arbeitete bei Dusendorf, einer internationalen Ölgesellschaft. Die Hälfte aller Schüler bei Oxford English Plus kamen von Dusendorf und lernten Englisch, die Sprache der Erdölindustrie, damit sie an allen Ölquellen der Welt eingesetzt werden konnten. Ich unterrichtete Hamid nun schon seit drei Monaten. Er war als voll ausgebildeter Ingenieur für Petrochemie aus dem Iran gekommen, aber praktisch ohne Fremdsprachenkenntnisse. Doch acht Stunden täglicher Einzelunterricht, aufgeteilt auf vier Lehrer, hatten ihn, wie es die Broschüre von Oxford English Plus vollmundig versprach, in kürzester Zeit zum kompletten Zweisprachler gemacht.
»Wann reisen Sie ab?«, fragte ich.
»In einem Monat.«
»Mein Gott!« Der Ausruf war echt und unbeabsichtigt. Hamid war so sehr zum Teil meines Alltags geworden, von Montag bis Freitag, dass ich mir nicht vorstellen konnte, plötzlich ohne ihn dazustehen. Und weil ich seine erste Lehrerin gewesen war, weil ich ihm die erste Englischstunde gegeben hatte, war ich immer in dem Glauben geblieben, dass er sein flüssiges Englisch allein mir zu verdanken habe.
Ich stand auf und holte einen Kleiderbügel vom Türhaken, um seine Jacke aufzuhängen.
»Auf dem Stuhl verliert sie die Form«, sagte ich, um den kleinen Gefühlsaufruhr zu kaschieren, den die Nachricht von seiner baldigen Versetzung in mir ausgelöst hatte.
Als ich ihm die Jacke abnahm, schaute ich aus dem Fenster und sah unten auf dem kiesbestreuten Vorplatz neben Mr Scotts Dolomite einen Mann stehen. Einen schlanken jungen Mann mit Jeans und Jeansjacke, mit dunklem, schulterlangem Haar. Er sah mich hinabblicken und hob die Daumen – mit breitem Grinsen.
»Wer ist das?«, fragte Hamid, der meine Überraschung und meinen Schock bemerkte.
»Er heißt Ludger Kleist.«
»Warum schauen Sie ihn so an?«
»Weil ich dachte, er sei tot.«