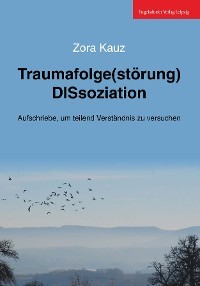Kitabı oku: «Traumafolge(störung) DISsoziation», sayfa 2
1.2 Unser Nervensystem im Trauma
Die erste Gefahren-Abwehr-Stufe, die bei Bedrohung betreten wird, ist fightflight (kämpfen oder flüchten), für das wir alle ausgelegt sind. Das ist ein aktives Tun, welches aber ohne Überlegung, sondern automatisiert im Bruchteil einer Sekunde von sich geht und uns aus einer Situation retten kann. Allerdings können wir, wenn wir zwar aus Geschwindigkeitsersparnis die Rationalität umgehen, auch umgekehrt nicht überlegt handeln, sondern nur impulsiv. Dabei stellt unser Körper uns für den Überlebenskampf oder eben die Flucht eine enorme Energie zur Verfügung. Dann kann es sein, dass z. B. ein Unfall, dessen Folgen ein Mensch durch die „Alarm-Energie“ und reflexartiges Handeln verhindern kann, immer noch sehr belastend ist, aber da daraus gelernt wurde, wie und vor allem dass solch eine Situation gut überstanden werden kann, schenkt das Gehirn sogar ein Hochgefühl durch körpereigene Glücksgefühle. Essentiell ist hierbei, dass diese Reaktion stattfinden konnte und der Körper die restliche Energie wieder „runter fahren“ darf, nachdem er sie sinnvoll gebraucht hat. Dass also nicht im Alarmzustand haften geblieben wird. Wenn wir aber mit aktivem Tun nichts ändern können, wir also hilflos sind, um dem Tod zu entgehen, dann kommt es zu dem weiteren Überlebensreflex bzw. dem nächsten Mechanismus in der Überlebens-Kettenreaktion: Freeze and Fragment (einfrieren und fragmentieren): Wir erstarren im Schockzustand, sind handlungsunfähig und gelähmt, wobei wir innerlich zunächst noch in einem sehr hohen Erregungszustand sind, da alle Energie für einen möglichen Kampf oder die Flucht bereits bereitgestellt wurde. Wir sind also wie erfroren, meist auch tatsächlich kalt, atmen sehr flach, aber schnell, sind innerlich für alles bereit. Die durch die Todesangst übermäßig produzierten Stresshormone blockieren die normale Integration dessen, was wir wahrnehmen. Wir sind also nicht bei vollem Bewusstsein, wenn wir Bewusstsein als integrativen Prozess betrachten. Die Informationen, die sonst eine beschreibbare Erinnerung bilden, zerbrechen in Einzelteile und bleiben ohne Beschriftung im limbischen System als akute Empfindung hängen, weil, vereinfacht geschrieben, der Austausch zwischen Amygdala und Hippocampus blockiert ist. So erreichen die einzelnen Wahrnehmungsaspekte keine passenden Orte in der Großhirnrinde, wo sie als Erinnerung erkennbar wären. Wenn die Bedrohung weiter da ist, schaltet sich der Parasympathikus zunehmend ein und wir fallen gänzlich in die Selbstaufgabe und Unterwerfung – submit. Wir werden unfähig, uns zu bewegen, weil die Angst uns lähmt, wobei manche ohnmächtig werden. Es gibt diesen Punkt, da schaltet der Körper ab. Dann ist alles tot. Dann ist da nur noch Kälte. Sonst nichts. Ich kann nichts mehr spüren, aber auch nichts bewegen. Abgesehen vom Ausgeliefertsein, durch die Lähmung, ist es aber kein schlimmer Zustand. Dieses Erleben ist für mich etwas, das in der standardisierten Aufreihung von „fight-flight-freeze“ vergessen wird. Darum schreiben wir auch immer von fight-flight-freeze-submit (siehe Grafik unten). Weil es etwas gibt, dass viel kälter ist, als das freeze. Es mag von außen sehr ähnlich aussehen; wir sind unbewegt und eher kalt und ggf. mit starrendem Blick. Aber das Erleben ist ein gänzlich anderes. Im freeze ist noch Todesangst da. Da ist es noch schrecklich angespannt und das Nervensystem in der Bereitschaft in flight umzuschalten, falls möglich. Das ist ein extrem leidvolles Erleben der Todesangst. Die Lähmung „danach“, ist nicht leidvoll. Es ist der vermutlich traurigste Zustand, den ich kenne, aber nicht im Moment selbst, sondern nur, wenn ich ihn danach beschreibe. Traurig, weil hier alles schon aufgegeben ist. Auch die letzte Hoffnung auf Bindung zur Welt, zum Leben, zu uns selbst, ist vergangen. Dieser Zustand ist total okay, denn wenn wir dann sterben, dann ist es wenigstens vorbei. Dann hört der Schmerz auf. Dann geht die Kälte weg. Dann ist es endlich vorbei. Der Tod ist in seinem Kommen akzeptiert, mit jedem Ausatmen ist es mehr okay, dass wir gerade Sterben. Danach ist es schlimm. Es ist ertränkend traurig. Es ist wie richtiges Trauern, um das Sterben. Ich bin mir noch nicht sicher, ob Trauern um das, was verstorben ist/scheint oder darum, dass das Sterben aufhörte und wir zurück auf die Erde gekracht sind. Traurig ist es auf jeden Fall. Aber in diesen relativ ganzheitlichen Lähmungszuständen ist der Angst-Terror nicht da. Leider ist dieses „Ja, es ist ok jetzt zu sterben.“ nicht kognitiv durch Mantras willentlich herzustellen. Also für mich zumindest nicht. Wenn, dann kommt das vom Körper bzw. von ganz tief innen.
Die sogenannte tonische Immobilität, also eine Unfähigkeit, sich zu bewegen, wirkt nicht unbedingt traumatisch. Sie begründet das Trauma aber, wenn sie mit Angst und Hilflosigkeit oder Bedrohung verknüpft ist. So ist auch die Lähmung an sich nicht traumatisierend, da sie aber mit der Todesangst verbunden ist, bleiben wir in dem Wissen, dass wir Angst nicht überleben können. Und schon das Herzrasen lässt uns später instinktiv dissoziieren, weil das die Technik ist, mit der wir es doch überlebt haben. Dissoziation ist ein Phänomen, welches vitale Funktionen hat, auch wenn es später nicht mehr so scheint, doch würde es ohne diese Wichtigkeit nicht biologisch garantiert werden.
Ein Trauma ist also nicht einfach etwas Schlimmes, was uns zustößt, oder eine chronische Abfolge von schrecklichen Erlebnissen. Es ist etwas, das grundlegend unsere neuronalen und biologischen Abläufe in Stresssituationen und körperlichen Empfindungen bzw. deren Verarbeitungsprozesse und Erinnerungsspeicherung beeinflusst und verändert. Von außen kann nicht entschieden werden, ob etwas traumatisch ist oder nicht, jedoch findet der Begriff alltäglich veränderte Verwendung, weil jeder Schrecken und aller Stress als Trauma bezeichnet wird. Auch nicht all das, was traumatisch wirkt, ist unbedingt traumatisierend, weil es ggf. abgefangen werden kann, weil es danach kein „allein bleiben“ gibt oder weil es zwar zu Bedrohung und Angst, aber nicht zu Todesangst kommt. So vermittelt die inflationäre Verwendung des Begriffs ein falsches Bild, weil dadurch Dinge kleingeredet bzw. fehlerhaft verglichen werden. Ob Trauma oder nicht, Leid lässt sich nicht objektiv vergleichen. Ohnehin ist jedes Trauma individuell, auch wenn Verletzungen verschiedener Menschen in derselben Situation entstanden. Chronische Traumatisierungen in der Kindheit formen die Ent- oder auch Ver-wicklung unseres Gehirns. Gedanken, Gefühle, Verhalten, Empfindungen, Wahrnehmungen werden nicht verknüpft gespeichert, Informationen anders organisiert. Die Traumata malten verzerrte Weltbilder und wir haben viele verschiedene davon auf einmal in uns, weil wir, als einzelne „Anteile“, voneinander getrennt und jede_r für sich, uns an unser jeweiliges Weltverständnis anpassten. So zerstört oder verhindert es auch unser Selbstbewusstsein, im wörtlichen Sinn, denn es gibt lange kein Bewusstsein darüber, wer wir sein könnten. Es wird gesagt, dass Zeit für alle Wunden Heilung bringt. Doch Traumata sind Verwundungen, die die Zeit von allein nicht heilt.
Wir glauben, Nichts zu sein. Die tote Kälte lebt in uns, weil wir nicht (von allein) in einen Normalzustand kommen und uns innerlich verstorben scheinen.
Nichts – und wenn doch etwas, dann schwach und erbärmlich, denn als es um unser Überleben ging, konnten wir uns kein Stückchen bewegen, kein kleines bisschen, es war uns nicht möglich, weil wir von der Angst gelähmt waren. Wir müssen also mit einer Grundstabilität an dieses Gefühl der Lähmung ganz langsam, Schritt für Schritt herantreten, um nicht von den verknüpften Gefühlen überfordert zu werden und zu dissoziieren. Deshalb funktioniert auch das: „Mach das doch einfach“ oder „Jetzt stell dich nicht so an“ nicht. Wir stellen uns nicht einfach an, und zu schnelle oder heftige, besonders unerwartete Konfrontationen führen, wenn wir nicht bereit sind, zur erprobten Dissoziation oder zu einer Retraumatisierung. Das Tempo ist nicht von außen zu steuern. Leider, denn es braucht so unfassbar viel Ausdauer, „all das“ langsam, stückweise auszubuddeln, aber anders wäre es nur wieder überwältigend. Zum Glück, denn es soll ja um das Erfahren eigener Handlungsfähigkeit und Entscheidungsfreiheit gehen.
„Boah, bist du ein Tier.“ – Diese Aussage kann wohl bedeuten, dass eine sportliche Leistung erbracht wurde. So sagen manche Menschen statt: „Hast du aber eine Ausdauer“, oder: „Du bist ja richtig stark“, eben: „Boah, bist du ein Tier.“
Und das sind wir alle. Ein bisschen zumindest. Oder ziemlich sogar (wenn wir all die schönen entwicklungsgeschichtlich neuen Hirnareale mal weglassen). Unser peripheres Nervensystem ist nämlich sehr tierisch. So auch zentral der Hirnstamm (in der Psychotraumatologie oft als Reptilien-Hirn bezeichnet), etwas in dem Organ, weswegen wir glauben, so ganz anders, „die Krone der Schöpfung“ zu sein. (Ich glaub ja nicht, dass wir damit zu krönen sind.) Menschen haben sich nur so weit von instinktiven Wurzeln entfernt, dass sie diese nicht nur nicht spüren, sondern oft sogar verleugnen. Aber wir sind nun mal Säugetiere.
Unser Nervensystem wird einerseits nach Form und Struktur gegliedert: Es gibt das zentrale Nervensystem; Gehirn und Rückenmark. Und das periphere Nervensystem, das ist quasi der ganze Rest, alles was sonst an Nerven im ganzen Körper verteilt ist und uns glücklicherweise „nervt“.
Funktionell wird es ebenfalls in zwei große Kategorien unterteilt: einerseits das somatisch/animalisch/willkürliche Nervensystem, für, wie der Name verrät, willkürliche Muskelkontraktionen oder bewusstes Wahrnehmen, und das autonome/vegetative/unwillkürliche Nervensystem, welches wir nicht willentlich bzw. nur indirekt beeinflussen können.
Letzteres wird wiederum in drei Bereiche unterschieden, von denen uns hier zwei besonders interessieren: das sympathische und das parasympathische Nervensystem. Der Sympathikus ist der aktivierende Teil, der Parasympathikus hemmend. Jeweils geht es ohne das andere nicht. Aktivierung ohne Bremse ist nicht lange funktionell und Bremse ohne Aktivierung ist wenig lebendig. Der Begriff Autonomes Nervensystem, geprägt vom britischen Physiologen J. Langley, hat schon Sinn. Wir können nämlich nicht mitentscheiden, ob unser Sympathikus die reaktive fight-flight-Energie aufbringt oder nicht. Das ist auch ganz gut so, weil wir im Falle des Falles dafür zu viel Zeit bräuchten. Gefahr bedeutet physiologische Reaktion und unüberlegtes Kampf- oder Fluchtverhalten.
Der größte Nerv des Parasympathikus ist auch noch einmal aufgeteilt. (Damit sind wir hier jetzt auf der letzten Differenzierungs-Stufe angelangt.) Das ist der Vagusnerv. Er ist der einzige der zwölf Hirnnerven, die zumeist dem Hirnstamm entspringen, welcher über den Hals hinaus in die inneren Organe des Körpers verläuft und in seiner Größe mit der Wirbelsäule zu vergleichen ist. Ist also ein sehr großes, ziemlich bedeutendes Ding. Charles Darwin hat schon Ende des 19. Jahrhunderts, lange vor der Zeit der psychosomatischen Medizin, die wechselwirkende Verbindung vom Körper zum Gehirn erkannt. Er schrieb vom heutigen Vagus als „pneumo-gastric nerve“. Der Vagus besteht aus dem ventralen (vorderen) Vagus System, das sind Fasern des Nervs mit einer Biomembran als Sensibilitäts- und Beschleunigungs-Isolierung, und dem dorsalen (hinteren) Vagusnerv, welcher primitiver ist und ohne Markscheide. Das Dorosal Vagal System besaßen schon primitive knochenlose Fischen vor 500 Millionen Jahren. Es sorgt laut Stephen Porges für den „shutdown“, für Immobilität in der Unterwerfung, für Dissoziation. Nach Porges’ Aufarbeitung reagieren Menschen bei Angst auf Bedrohung zunächst mit einer hochentwickelteren Säugetier-Taktik. Wir nutzten das Ventral Vagal System, welches für soziale Einbeziehung und die Kommunikation von Emotionen (viel über Mimik) zuständig ist. Dieser Teil des Nervs ist relativ neu (ca. 80 Millionen Jahre alt) und kommt nur in Säugetieren vor. Wir suchen mit dem Social engagement system (SES) des Ventral Vagal Systems nach Kontakt und Schutz oder Besänftigung durch andere. Was auch erklärt, warum schon die Präsenz eines wohlwollenden Mitmenschens und Erdung durch akustische oder taktile Signale das Alarmsystem herunterfahren und in einen ruhigeren Zustand bringen kann. Wenn das nicht klappt oder niemand da ist, der Schutz bieten kann, schaltet sich der Sympathikus ein. Der Sympathikus stellt die Kampf- oder Fluchtenergie in unseren Gliedern bereit. Sind wir ernsthaft bedroht, brauchen wir alle Kraft, die möglich ist, um kämpfen oder fliehen zu können. Wenn auch das unmöglich ist, frieren wir ein, denn tote Beute ist für die meisten Raubtiere uninteressant. Doch zunächst sind wir innerlich hocherregt, im potentiellen Flutchtmodus. Wir sind zwar unbeweglich, aber auf der Suche nach Möglichkeiten, der Situation zu entkommen, und somit extrem wachsam. Wenn wir wirklich oder jedenfalls für unsere Wahrnehmung keine Möglichkeit mehr zur Flucht haben und die Todesangst weiter besteht, wird das Dorsal Vagal System ausgelöst. Dieses wird ausschließlich bei Todesangst aktiviert. Wir verlieren alle Energie, unser Organismus schaltet auf stand-by, oder, im schlimmsten Fall, ganz aus; Es gibt das Phänomen des Voodoo-Todes. Hier führt die Todesangst zum Tod, obwohl keine lebensbedrohlichen Verletzungen vorliegen, weil der primitive Teil des Vagusnervs den Organismus bis zum Herzstillstand und oder Atemdepression herunterfährt. Bei Tieren wurde dies beobachtet und aufgezeichnet, von erwachsenen Menschen ist es selten beschrieben, aber nicht unbekannt, bei Säuglingen im Bezug auf Vernachlässigung wurde es aufgewiesen; sie können neben dem „klassischen“ Freeze-Voodoo-Tod auch durch fehlende Pflege, Fürsorge und Bindung „verhungern“, da sie noch nicht in der Lage sind, ihre physiologischen Sub-Systeme zu koordinieren, Affekte selbst zu regulieren.
Wir tragen die Überlebens-Kettenreaktion in uns, weil Traumata an sich vorkommen, weil lebensbedrohliche Situationen und Todesangst in unserer gesamten Evolution vorkamen und logischerweise von einem Leben mit Tod am Ende nicht wegzudenken sind. Wir brauchen diese Funktion, um zu überleben. Es ist total genial, dass sich unser Organismus so schützen kann vor Situationen, die wir nicht überleben würden, wenn wir unsere neuen komplexen Hirnareale dafür benützten. Es sollte allerdings keine Dauerlösung sein. Denn auch wenn Lebensgefahr zum Leben dazugehört, so ist chronisch traumatisierende Gewalt nichts, was einfach so zum Leben dazugehören sollte. Überlebens-Mechanismen sind nicht dafür ausgelegt chronisch genutzt zu werden. Denn dann sitzen wir in der Therapie und bemerken, dass wir unserem Hirn 420 Millionen Jahre Evolutionsnachhilfe geben müssen (500 Mio. minus 80 Mio.), weil wir mit dissoziativen Störungen im primitiven Fischstatus festhängen, weil wir dauerhaft abspalten.

Es fühlt sich zumindest manchmal nach so viel Arbeit an. 420 Millionen Jahre.
Wenn wir z. B. zu Beginn der Stunde in der Psychotherapie-Praxis umkippen, weil das Nervensystem sagt: Anders kommen wir hier nicht raus. Wobei die Gefahr nur ein Trigger war und das Umkippen keine den Umständen angepasste Taktik ist, um sich einer Gefahrensituation zu entziehen. Wir brauchen also Nachhilfe und müssen mit vielem tatsächlich von vorne anfangen. Wir brauchen das Erregungsniveau unseres Nervensystems in einem funktionellen Mittelfeld, denn nur dann kann unser Gehirn Orientierung und Integration koordinieren. Funktionelles Mittelfeld heißt, dass wir nicht in lähmender Todesangst und Untererregung feststecken und uns auch in keiner impulsiven Übererregung befinden. Erst dann können wir den neueren Teil des Vagus aktivieren und damit irgendwann die Abkapselung verändern und uns als Teil dieser Welt empfinden. Weil wir erst dann sozialen Kontakt herstellen können, ohne von der Scham isoliert und der Erfrierung abgehalten zu werden.
Etwa 80 Prozent der Fasern des Vagus, die Körper und Gehirn verbinden, sind sensorisch, also vom Körper zum Hirn kommunizierend. Die anderen 20 Prozent motorisch und kommunizieren vom Hirn zum Körper. Im Verhältnis 8:2 steht also, was der Vagus dem Hirn vom Körper erzählt, was er so empfindet, zu dem, was er dem Körper vom Gehirn erzählt, was der machen soll. Jetzt sag mir eine_r: „Das ist nur in deinem Kopf.“ Nein. Traumatisierungen sind sehr körperlich verankert. Auch all das, was unser Kopf abspalten konnte. Das erklärt, warum Traumata nicht ausschließlich mittels „Drüber-reden“ oder kognitiver Analyse zu „heilen“ sind, weil wir nichts analysieren können, wofür wir keine Worte oder Gedanken haben. Wir müssen grundlegend lernen, Empfindungen wahrzunehmen, diese auszuhalten und unserem Körper zuzuhören. Unser Kopf herrscht nicht über unseren Körper, vielmehr forschen und untersuchen unsere Gedanken unsere Empfindungen, sind somit oft ihre unbewussten Folgen, nicht Auslöser.
Der primitive Teil des Vagusnervs stellt auch eine kommunikative Verbindung zwischen den meisten unserer inneren Organe und dem Gehirn dar. Wir erleben Gefahr somit nicht nur von außen; Lähmungen, Übelkeit, Anspannung, Schmerzen können auch von innen Angst auslösen. Angespannte, rennbereite Beine und eine harte Mimik können dem Hirn z. B. Fluchtbereitschaft signalisieren, wodurch wir dann denken, dass es auch eine externe Gefahr geben muss. Prinzipiell ist der Fakt, dass unser Körper schneller auf Bedrohung reagiert als unser Kopf, natürlich sinnvoll. Um Reize richtig wahrnehmen zu können und zu sortieren und an ihren richtigen Speicherplatz zu verwiesen, ist in akuter Gefahr einfach keine Zeit. Es ist also eigentlich ziemlich gut, dass wir völlig „hirnlos“ (bzw. nach Anweisungen des Hirnstamms) reagieren können. Und wie Anspannung Gefahr signalisieren kann, genauso können entspannte Muskeln und tiefe Bauchatmung Sicherheit oder gar Wohlbehagen ans Hirn melden. Leider funktioniert das selten sofort, weil bestimmte Anteile ja genau dafür ausgebildet sind und diese Automatismen nicht einfach verschwinden, nur weil irgendwer sagt, dass die Gefahr vorbei ist. Wir müssen das üben und trainieren und üben und trainieren und dann noch ein bisschen üben, weil unser Gehirn nun mal dazugelernt hat und uns nicht einfach glaubt, sondern Erfahrungen braucht, um sich um-vernetzen zu können. Tatsächlich bilden sich Nervenfortsätze und Verbindungen aus, wodurch Kurzschluss-Lösungen neuroanatomisch stärker vertreten sind. Erdung bedeutet dann auch keine Heilung, aber sie führt dazu, Schritte dahin zu ermöglichen. Da durch den chronischen Überschuss an Stresshormonen die Aktivität des Hippocampus gehemmt wird, bauen sich dort auf Dauer Neuronen ab. Allerdings kann er auch wieder wachsen, wenn der chronische Stress weniger geworden ist. Wir wissen inzwischen, dass auch im Gehirn Nervenzellen nachwachsen und der hippocampale Neuronenwachstum ist am breitesten nachgewiesen. Außerdem können bestimmte Synapsen im Hippocampus bereits durch das Erkunden von fremden Orten verstärkt werden. Das bedeutet, der Mut, Neues zu wagen oder/und zu reisen, ist, neben anderen Ebenen, auch für unsere neuronale Regeneration unterstützend.
1.3 Okay. – Und jetzt?
Wir sind uns selbst das fremdeste Wesen, welches ich mir nur vorstellen konnte/kann. Ganz einfach, weil ich mir über „das Selbst“ nicht im Geringsten bewusst sein konnte und das, was jetzt stückchenweise ins Bewusstsein tröpfelt, alles andere als einfach annehmbar, bekannt oder vertraut ist. Der Körper gehört(e) nicht zu uns. Aber alles ist fremd, wenn wir uns selbst nicht kennen, weil wir dann gar nicht wissen, was uns eigentlich bekannt ist. Manche Art der Musterbildung und Koppelungen ist von Persönlichkeitssystemen auf äußere Systeme übertragbar, so wie manche Netzwerkeigenschaften des Gehirns auf soziale Netzwerke übertragbar sind: Wenn wir unsere eigene Unsicherheit annehmen können, unsere (zumindest großen, stark beeinflussenden) Themen kennen, dann können wir dem Unwissen mit Zutrauen begegnen. Dann können wir uns dem, was möglich ist, zutrauen, weil wir wissen, dass Handlungsspielräume unmöglich vor ihrer Entfaltung und Entdeckung zu bemessen sind. Nur wenn wir uns selbst als subjektives, mit Würde geborenes Wesen anerkennen (das ist ein ganz sachlicher Fakt), dann können wir anderen auch so begegnen.
Wenn wir uns im Mitgefühl üben, dann geht uns alles Leid etwas an, dann gibt es kein Leben, welches weniger wert ist als ein anderes. Dann müssen wir nicht kategorisieren und uns gegenseitig Etiketten aufdrucken, weil wir einfach zusammenlebende Wesen sein können. Und wenn du dich als Mensch siehst (wir müssen das noch üben, aber die Intention ist da), dann werden Fremde auf einmal auch nur noch Menschen. Auch nur welche mit einem Hirnstamm und Krone außen herum. Auch nur welche, die Grundbedürfnisse haben und sich, als Rudeltiere, nach Gemeinschaft in irgendeiner Art und Weise sehnen. Wenn wir Integration zulassen und unterstützen, dann bemerken wir, dass die Todesgrenzen und nicht „die Fremden“ das Problem sind. Wenn wir respektvolle Toleranz und würdevolles Begegnen wirklich ernst nehmen, wird deutlich, dass die Abspaltung und der auf konditionierte oder vorgegebene Haltungen basierende Hass das Problem ist, nicht die Existenz von Unterschieden. Wenn es um Leben und Tod geht und weder Kampf noch Flucht möglich ist, sind wir alle nur primitive knochenlose Fische ohne irgendeinen schützenden Sonderstatus. Ja, mit ein bisschen limbischem System und Cortex außen herum, aber die sind in dem Moment zweitrangig.
Konkrete Zusammenhänge und Mechanismen bzw. die genauen molekularen Wege der Epigenetik und deren Einfluss auf psychische Krankheiten sind noch nicht ausreichend belegt, da die Krankheiten zu komplex und die Forschung in diesem Bereich zu jung ist, jedoch gibt es im Kleinen Fortschritte und Erkenntnisse, auch wenn noch viele Unsicherheiten, Fragezeichen und Streitpunkte, auch das Folgende betreffend, bestehen.
Frühe und heftige Umwelteinflüsse können zu epigenetischen Veränderungen führen, unsere Stressreaktionen werden geprägt. Grenzverletzungen in der Kindheit können ein Gen hemmen, seine Aktivität herabsetzen, das für die Produktion eines Faktors verantwortlich ist, welcher hilft, Cortisol zu neutralisieren. Umgekehrt bedeutet dies, dass genetische Dispositionen kein unumkehrbares Schicksal sind, weil die Gene für psychische Erkrankungen, mal sehr gewichtig, mal weniger, jedoch immer nur ein Faktor sind. So sind im Gegensatz zur Erbinformation selbst deren epigenetische Prozesse, dadurch Aktivierung bzw. Ablesbarkeit mit Dynamik verbunden, also beeinfluss- und veränderbar. Wohl ist eine Gravur der Epigenome nie wieder so gut/leicht zu setzten wie während der Schwangerschaft, in den ersten drei Lebensjahren und teilweise auch noch mal im Umbaualter der Pubertät, trotzdem ist unser Organismus nicht statisch, da ist immer Bewegung, Lernen, Regeneration, Evolution. Doch auch wenn vieles davon immer und ganz ohne unser Wissen stattfindet, ist große Bewegung, entfaltende Entwicklung, horizontweitendes Lernen und heilsame Flexibilität nichts, was einfach so von allein passiert. Das mag uns (emotional) sehr fern scheinen, doch ist es für uns – und hoffentlich für viele – auch hoffnungsvoll, denn es bedeutet, dass vieles möglich ist. Es bedeutet, dass wir, wohl nicht grenzenlos und einiges betreffend bestimmten, schwer einschränkenden Erfahrungen leider unterlegen, aber in vielen Bereichen mehr Möglichkeiten zur Entwicklung haben, als wir vielleicht glauben können. Manche Gegebenheiten, primär früh und oder heftig prägende Erfahrungen, setzten hier eben leider Grenzen, weil frühe, tiefe Spuren nicht zu löschen sind. Immer schwieriger wird es bei chronischen und gezielt gesetzten Prägungen, aber was innerhalb der Grenzen möglich ist, ist meist mehr, als wir es wagen würden, uns vorzustellen. Und wenn wir uns trauen (wollen/können), diese Grenzen kennenzulernen, dann können wir auch unseren Möglichkeitsraum entdecken und uns in darin ein Leben wachsen lassen. Wir brauchen Menschen, die uns ermutigen (nicht überreden!), neue Erfahrungen zu machen, und uns offen einladen, Begeisterung und Interesse zu entwickeln, denn dann können neuroplastische Botenstoffe für eine nachhaltigere Koppelung und dadurch Verinnerlichung des Neu-gelernten sorgen. Ich glaube, dass bei den meisten psychischen und oder auch neurologischen Krankheiten, ebenso wie bei Ausgrenzung, Diskriminierung und anderer Gewalt, das Wissen um Neurodiversität und -plastizität sehr hilfreich ist, um sich davon wegbewegen oder andere Lösungen finden zu können. Sich dessen gewahr zu sein, dass andere anders wahrnehmen und anders von der Umwelt beeinflusst werden, hilft manchmal, Unverständnis und impulsive Abwertung zu hinterfragen oder ganz ruhen zu lassen. Bei psychischen Krankheiten kommt es zu Störungen bestimmter Kommunikationssysteme und oft auch dadurch zu einer Hemmung der Neuroplastizität, bzw. ist es so, dass funktionelle Verbindungen weniger oder instabiler modulübergreifend vernetzt sind, natürlich in verschiedenen Bereichen bzw. verschiedene Kommunikationswege schwerer oder geringer betreffend. Das Wachstum neuer Nervenzellen, das im Gehirn ständig passiert, sowie das Entstehen neuer Synapsen und eine Veränderung der Myelin-Beschleunigungs-Isolierung sind neuronale Regeneration. Und damit auch psychobiologisch heilsam, weil z. B. neue Wege der Stressbewältigung erlernt/angewandt, schneller (auch langfristig adaptive) Lösungen gefunden und Zufriedenheit und Aufmerksamkeit gesteigert werden können. Ferner ist unser Neurotransmitter-Haushalt mehr im Gleichgewicht, wodurch wiederum die Hemmungen der Plastizität sinken. Wenn wir das wirklich wollen und es eben innerhalb unserer Möglichkeits-Grenzen liegt, können wir die Plastizität unseres Gehirns aktiv nutzen, um festgefahrenen Muster verändern (oder schädigend konditionierte zumindest hemmen) und – im Rahmen mancher Gegebenheiten – Krankheiten1 mildern oder heilen zu können. Alles, was neuronale Plastizität stimuliert, macht flexibel, ist heilsam.
1 Gemeint ist bspw. die akute PTBS-Symptomatik oder eine Komorbidität bzw. Erkrankungen im Allgemeinen, nicht Traumatisierungen und unsere dissoziative Identitätsstruktur als solche.