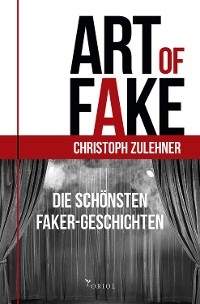Kitabı oku: «Art of Fake.», sayfa 4
ERFOLGREICHER FAKE HEISST NICHT ERFOLG AUF DAUER
Die hochbetagte Elsa Schiaparelli soll jeden Abend in ihrem Pariser Appartement voll geschminkt und im Tigerpyjama vor dem Fernseher gesessen haben. Doch bei ihrem Ableben im November 1973 kannte schon fast niemand mehr den Namen der einst so berühmten Italienerin. Im Gegensatz zu Chanel, dem Markennamen ihrer früheren Erzrivalin. Ganz zu schweigen von den Modeschöpfern, die seit dem Zweiten Weltkrieg mit ihrer „Haute Couture“ (wie die tonangebende Schneiderkunst nun hieß) Furore gemacht hatten: Christian Dior, Yves Saint Laurent und Pierre Cardin vor allem – interessanterweise ausschließlich Männer, so wie auch Stars der nächsten Generation: Armani, Versace, Lagerfeld. Dabei hatten einst zwei Frauen die Welt der Mode für die oberen Zehntausend allein beherrscht: eben Coco Chanel und Elsa Schiaparelli. Sicher, der Zweite Weltkrieg und die deutsche Besatzung weiter Teile Frankreichs, einschließlich Paris, beendeten die „Années Folles“ endgültig. Doch der Krieg, nicht ohne Grund „der große Gleichmacher“ genannt, warf immerhin alle gleich weit zurück. Und wurde abgelöst von einer Nachkriegszeit, in der dann alle wieder mehr oder weniger bei null anfangen mussten.
Kurz nachdem Paris am 14. Juni 1940 gefallen und von der Wehrmacht besetzt worden war, reiste Schiaparelli nach New York und verbrachte dort – abgesehen von ein paar Monaten an der Seine im Jahr 1941 – die Zeit bis Kriegsende. Als sie zurückkehrte, hatte Christian Dior bereits seinen „New Look“ auf den Laufsteg gebracht, der sich von allem abgrenzte, was die Mode der Vorkriegszeit ausgemacht hatte. Im Jahr 1954 feierte Coco Chanel die Wiedereröffnung ihres Modehauses. Chanel sollte es gelingen, das Etikett des Gestrigen abzustreifen und ihre Mode als klassisch und zeitlos zu präsentieren. Elsa Schiaparelli fand keine stimmige Marktpositionierung mehr. Im Dezember desselben Jahres musste sie die Tore ihres Hauses endgültig schließen. Zu seinen besten Zeiten hatte es allein in Paris mehr als 4.000 Mitarbeiter beschäftigt. Nun war Schluss.
Über die Ursachen für dieses Aus lässt sich nur spekulieren. Zwei Gedanken drängen sich mir jedoch geradezu auf. Der erste: Ein gelungener Fake ist noch lange keine Garantie für dauerhaften Erfolg. Und der zweite: Wer seine Persönlichkeit zur Marke macht, der muss irgendwann lernen, über seinen Schatten zu springen. Elsa Schiaparelli hatte sich mit geschickter Selbstinszenierung und kalkulierter Provokation selbst in den Olymp der Mode katapultiert. Dabei hatte sie durchaus etwas zu bieten. Über ihre Bedeutung in der Geschichte der Mode gibt es keine zwei Meinungen. Mittlerweile haben einige der berühmtesten Museen der Welt ihrem Schaffen umfangreiche Retrospektiven gewidmet.
Doch Schiaparelli hat selbst einmal gesagt: „Sobald ein Kleid geboren ist, ist es auch schon Teil der Vergangenheit.“ Mode ist per Definition ephemeral – sie entsteht für den Augenblick und ist im nächsten Moment vergangen. Das heißt für Modeschöpfer: Es muss immer weitergehen, der Fluss der Ideen darf nie abreißen. Und bei allen von genialen Individuen gegründeten Marken in sämtlichen Branchen entsteht Konstanz eigentlich nur, wenn man irgendwann ein Team bildet. Um den Erfolg zu sichern, muss man bereit sein, ihn zu teilen; man muss delegieren, Dinge abgeben, viele andere einbinden. Gut möglich, dass einer Exzentrikerin und Egozentrikerin wie Elsa Schiaparelli dieser Schritt nie gelungen ist.
So machte es sich schließlich eine viel jüngere Generation zur Aufgabe, die Marke Schiaparelli am Leben zu erhalten. Im Jahr 2006 erwarb der italienische Unternehmer Diego Della Valle die Rechte. Sechs Jahre später begann Della Valle, der bereits die Marken Tod’s, Hogan und Fay aufgebaut hatte, mit dem Relaunch. 2015 wurde Bertrand Guyon zum Design Director ernannt, ein Mann Anfang 50 mit Halbglatze, gepflegtem Vollbart und zurückhaltendem Auftreten. Er arbeitet im selben Haus, in dem sich einst das Modehaus Schiaparelli befand. Und zwar in einem Studio, in dem „Shocking Pink“ und ähnlich indiskrete Farben um die Wette leuchten wie auf einem Rummelplatz. Seine Modenschauen inszeniert er gern in den prunkvollen Gängen der Opéra Garnier, die dafür in grellrosa Licht getaucht werden. Ob all dieses Rosarot wirklich reicht, um die Legende aufleben zu lassen, bleibt abzuwarten. Schockiert von der Signaturfarbe der Schiaparelli dürfte heute jedenfalls niemand mehr sein.


4 | DER AUTOVERKÄUFER
Wie viele Existenzgründer scheute auch ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit das Risiko. Schließlich verfolgt Gründer eine Horrorstatistik in den ohnehin schlechten Schlaf, nach der zwei Drittel der Neugründungen nach drei Jahren wieder vom Markt verschwunden sein sollen. Ich lebte also bescheiden und hielt meine Kosten so gering wie möglich. Ein eigenes Büro sparte ich mir und arbeitete lieber von zu Hause aus. Mein erster Geschäftswagen war ein Kia: nicht schön, nicht repräsentativ, nicht einmal komfortabel auf langen Strecken, dafür aber günstig sowohl in der Anschaffung als auch im Unterhalt. Außerdem seitens des Herstellers mit ebenso umfassenden wie beruhigenden Garantieversprechen gesegnet. Deutsche Hersteller hatten solche Garantien nicht nötig, da ihnen die geneigte Kundschaft die Autos ohnehin aus den Händen riss. Die Fahrer eines Audi, BMW, Mercedes oder Volkswagen nahmen – und nehmen bis heute – sogar halbjährige Lieferfristen stoisch und ohne zu murren in Kauf.
Beim Koreaner kaufte man dagegen direkt vom Hof des Händlers. Dorthin hatten einen neben den erwähnten Garantien meist noch satte Rabatte oder nahezu zinsfreie Finanzierungsangebote gelockt. In der Ausstattung unterschieden sich die Modelle auf dem Hof ohnehin kaum. Die Lackfarben waren alle ähnlich fad. Kurzum: Wer mit Autos emotional eher wenig anfangen konnte und günstig mobil sein wollte, ohne ein großes Risiko einzugehen, der war hier genau richtig. Bei mir war das jedoch anders. Ich bin eigentlich ein ziemlicher Autofan, der zudem deutsche Ingenieurskunst in höchstem Maße zu schätzen weiß. Der „Reiskocher“ war eher eine Notlösung. Bei Kundenbesuchen wollte ich denn auch am liebsten nicht beim Ein- oder Aussteigen gesehen werden. Krankenhäuser als meine primären Beratungskunden waren insofern günstig, als ich mein Auto dort unauffällig auf den meist gut gefüllten Patienten- und Besucherparkplätzen abstellen konnte.
Mit meiner Selbstständigkeit war ich von Anbeginn erfolgreich. Doch dauerte es eine Weile, bis ich das selbst wirklich glauben konnte. Und es verstrich dann nochmals einige Zeit, bis ich Vertrauen in den dauerhaften Erfolg hatte und entsprechende Entscheidungen traf. Endlich war es dann aber so weit: Ich sah mich als erfolgreichen Selbstständigen und wollte das auch nach außen darstellen. Sie mögen mich nun als konventionell und angepasst schelten oder mir altmodisches Prestigedenken vorwerfen, doch zum Unternehmertum gehörte für mich unbedingt ein deutsches Qualitätsfahrzeug als Geschäftswagen. Also plante ich einen Besuch in einem Autohaus für Volkswagen und Audi in meiner Heimatstadt. Für Selbstständige sind solche Termine außer der Reihe meist schwierig im Kalender unterzubringen. Während einer Woche in den Sommerferien benötigten meine Projekte dann ausnahmsweise einmal etwas weniger Aufmerksamkeit. Also betrat ich eines Tages um die Mittagszeit – nicht frei von Stolz und mit einer gewissen Vorfreude, jedoch ohne vorab vereinbarten Termin – besagtes Autohaus.
Ein Auto ist für die meisten Konsumenten der teuerste Gebrauchsgegenstand, den sie anschaffen. Bedient zu werden, ist dennoch kaum irgendwo im Handel so sehr Glücksache wie bei einem Autohändler. Schauen Sie sich nur einmal die Kundenbewertungen auf Google zu beliebigen Autohändlern in Ihrer Umgebung an. Da wimmelt es nur so von Ein-Sterne-Rezensionen mit Kommentaren wie: „Wir wollten einen Neuwagen bestellen, aber niemand hat uns beachtet. Deshalb sind wir wieder gegangen.“ Wenn Sie eine Parfümerie betreten, werden Sie vom Verkaufspersonal geradezu bestürmt. Wenn Sie dagegen in ein Autohaus kommen, können Sie nie sicher sein, ob jemand Notiz von Ihnen nimmt. Dabei sind 100 Euro für ein Parfüm ja nichts gegen die 100.000 Euro für ein Auto, denen Sie sich heute schon in der oberen Mittelklasse zügig nähern, sofern Sie bei Motorisierung und Ausstattung aus dem Vollen schöpfen. So gesehen hatte ich mir das richtige Autohaus ausgesucht: Keine halbe Minute betrachtete ich interessiert eines der ausgestellten Fahrzeuge, da machte sich bereits ein junger Mann auf den Weg zu mir.
HÖFLICH, SOUVERÄN, ENTSPANNT, FAKER
Nachdem der junge Mann mich ausgesprochen höflich begrüßt hatte, fragte er: „Kann ich etwas für Sie tun?“ Ich kam direkt zum Punkt und erklärte ihm, dass ich mir einen neuen Geschäftswagen kaufen wollte und das Modell, vor dem wir gerade standen, schon einmal grundsätzlich infrage kam. Erst jetzt, als ich den jungen Mann aus der Nähe sah, fiel mir auf, wie jung er wirklich war. Sehr jung. Vom Gesicht her wirkte er wie ein Schulbub. Doch wie er auftrat und mich nach meinen Wünschen fragte, schien er hier tatsächlich einer der Verkäufer zu sein. Er trug lediglich nicht den für Autoverkäufer typischen dunklen Anzug mit Krawatte, sondern Smart Casual: dunkle Jeans, akkurates Hemd, Pullover mit V-Ausschnitt. Auf einem silbernen Namensschild mit VW- und Audi-Logo, das er angesteckt hatte, stand in schwarzen Lettern: „Herr Stangl“. Kein Zweifel, der Herr Stangl war dazu da, mir alles über die Autos dieses Händlers und mögliche Konditionen zu erklären. Er würde meine Fragen beantworten und mich im Idealfall zur Unterschrift unter einen Kaufvertrag bewegen.
Vor meinem Besuch im Autohaus hatte ich mir bereits eigene Gedanken gemacht: Das neue Auto sollte alltagstauglich sein, ein komfortabler Reisewagen und auch vom Design her ansprechend. Daneben gab es die speziellen steuerlichen Regelungen für Firmenwagen zu bedenken. Ich hatte gehört, dass sich bestimmte Fahrzeuge für Selbstständige rechneten, während andere leicht zur Kostenfalle werden konnten. Herr Stangl gab mir das Gefühl, meine Bedürfnisse auf Anhieb zu verstehen. Ich fühlte mich abgeholt. Zwar merkte ich schnell, dass seine Leidenschaft mehr der Technik galt als den Preisen und den Prozenten. Doch erstens sah ich ihm das nach. Und zweitens hatte ich bei den Fahrzeugen, die in die engere Wahl kamen, noch durchaus Fragen zu technischen Details: Ab welcher Motorleistung war man kein Verkehrshindernis mehr? Welcher Verbrauch war in der Praxis realistisch? Was für eine Rad- und Reifenkombination bot den besten Kompromiss aus Handling und Komfort? Diese und weitere Fragen beantwortete Herr Stangl souverän. Er zog alle Register, sprudelte nur so vor Fachwissen und hatte immer eine eigene Meinung.
Die ganze Szene im Verkaufsraum erinnerte mich an eine typische Situation in der Schule. Vielleicht erinnern Sie sich auch daran? Ich meine jene Schüler, die ausnahmsweise einmal richtig gut vorbereitet zu einer Stunde kamen und dann unbedingt drankommen wollten. So wirkte auch Herr Stangl auf mich: richtig gut vorbereitet und glücklich, dass er heute drankam und so viel erzählen durfte. Dabei trat der junge Mann zu keinem Zeitpunkt besserwisserisch oder gar arrogant auf. Sehr entspannt, lässig und nahbar kam er mir vor. Später, viel später erst gestand mir Herr Stangl, er sei bei diesem Gespräch so nervös gewesen, dass er sich fast in die Hose gemacht hätte. Doch noch erkannte ich ihn nicht als Faker. Vielmehr wollte ich langsam den Sack zumachen und ein Auto bestellen. Zunächst setzte sich Herr Stangl mit mir an einen Tisch mit Computer. Dort spielte er verschiedene Konfigurationen durch.
Am Ende waren nur noch die finanziellen Konditionen und die steuerlichen Fragen offen. Zum ersten Mal wirkte Herr Stangl jetzt ein klein wenig unsicher. Es war nur eine minimale Veränderung seiner Ausstrahlung, aber doch spürbar. Fast im selben Moment ging die Eingangstür auf und eine kleine Gruppe von Männern in dunklen Anzügen kam herein. Offensichtlich kamen da Mitarbeiter aus der Mittagspause zurück.
Fast ein wenig erleichtert sagte Herr Stangl: „Da kommen unsere Verkäufer. Ein Kollege übernimmt gleich bei Ihnen. Mit ihm besprechen Sie dann auch die kaufmännischen Konditionen.“
Mir passte das ganz und gar nicht. Selbstverständlich wollte ich den Ansprechpartner, der mich so überzeugt hatte, jetzt auch behalten.
Also sagte ich: „Herr Stangl, das können wir doch miteinander besprechen.“
„Das darf ich leider nicht“, entgegnete er. „Ich bin noch in der Ausbildung.“
Selten war ich so überrascht. Beinahe hatte ich schon beschlossen, bei diesem kompetenten Verkäufer zukünftig alle meine Autos zu kaufen. Und dann entpuppte er sich als Lehrling. Herr Stangl hatte das Verkaufsgespräch nur geführt, weil die wirklichen Verkäufer zu Tisch waren. Was für ein cooler Faker!
BELLA FIGURA MIT SCHLOTTERNDEN KNIEN
Seit der Spätphase der Industriegesellschaft spielen Spezialisierung und Expertentum eine so zunehmend große Rolle, dass an der Kulturtechnik des Fakes kaum noch jemand vorbeikommt. Es gibt nur noch wenige Wirtschaftszweige, in denen Einsteiger Fuß fassen könnten, ohne zumindest ein wenig zu faken. Im Kundenkontakt ist der Fake ohnehin längst Pflicht. Der Kunde erwartet überall den Experten, den Profi, den kompetenten Berater. Je unübersichtlicher das Angebot, desto mehr zählt Beratung zur Kernleistung. Mehr noch: Die Kombination aus Dienstleistung und tangiblem Produkt wird zum Standardfall. Doch wer kann mit 18 oder 20 Jahren schon ein mit allen Wassern gewaschener Branchenguru sein? Zumal, wenn das Wissen in fast jeder Branche immer schneller veraltet und das in der Ausbildung Gelernte bereits nach wenigen Jahren wertlos ist? Der Markt verlangt heute von den Repräsentanten eines jeden Unternehmens, dass sie gegenüber dem Kunden Bella Figura machen – und sei es mit schlotternden Knien.
Vielleicht hatten Sie ja nach der Lektüre der ersten drei Faker-Geschichten in diesem Buch den Eindruck, dass der Fake das Erfolgsgeheimnis einer Clique der Supererfolgreichen ist: der Weltunternehmer, der Sportstars, der Paradiesvögel der High Society. Das ist der Fake ganz sicher auch. Doch längst ist er eine unerlässliche Kernkompetenz für alle, die in einer sich immer schneller wandelnden Arbeitswelt überhaupt einen Job haben und produktiv sein wollen. Für einen Johannes Stangl, seinerzeit Lehrling in einem Autohaus in Oberösterreich, gelten genau die gleichen Erfolgsprinzipien wie für einen Elon Musk, den Gründer von Tesla Motors, der wie aus dem Nichts mit Elektroautos reüssierte und damit eine ganze Branche das Fürchten lehrte.
In meinem früheren Buch „Make the Fake: Warum Erfolg die Täuschung braucht“ erkläre ich diese Zusammenhänge ausführlich. Darin erzähle ich auch die Geschichte, wie der 17-jährige Krankenpflegeschüler Christoph Zulehner einst zum Faker wurde: Während meiner ersten Nachtwache im Krankenhaus, bei der ich allein für 35 Patienten zuständig war, kollabierte prompt eine Patientin – und mir blieb nichts anderes übrig als der Fake. Ich tat so, als ob Reanimation für mich eine tägliche Routine sei. Ähnlich wie Butter aufs Brot streichen oder Kamillentee in Schnabeltassen gießen. Ich gebe zu, dass meine Sympathie für den Lehrling Johannes Stangl auch etwas mit dieser biografischen Parallele zu tun haben könnte. Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen den jugendlichen Fakern Stangl und Zulehner: So etwas wie meine damalige Aktion bezeichne ich heute als einen „unbewussten Fake“. Stangl war hingegen schon sehr viel näher am „bewussten Fake“.
Ein unbewusster Faker hat Vertrauen in sich selbst; ein bewusster Faker gibt zusätzlich ein Versprechen an sich selbst ab. Als während meiner ersten Nachtwache eine sehr nette ältere Dame beschloss, ihre Herztätigkeit einzustellen, rutschte mir nicht nur das Herz in die Hose, sondern mir blieb auch kaum eine andere Wahl, als beherzt zu handeln. Ich traute mir das zu und tat etwas, das ich als Lehrling eigentlich noch nicht durfte. Das war bei Johannes Stangl genauso. Mit dem Unterschied, dass er leichter hätte kneifen können. Er hätte zum Beispiel das tun können, was in vielen Autohäusern ohnehin geschieht: den potenziellen Kunden, der da ohne Termin hereinschneit und um die ausgestellten Fahrzeuge schleicht, einfach ignorieren. Selbst wenn ich ihn angesprochen hätte, wäre es ihm ein Leichtes gewesen, den Fake zu vermeiden. Er hätte sagen können, dass die Verkäufer zu Tisch seien und ich mich bitte gedulden solle, bis sie zurück sind. Selbst wenn er mir eine Tasse Kaffee angeboten und mir ein paar Prospekte gereicht hätte, wäre er auf dem sicheren Boden dessen geblieben, was er als Auszubildender sollte und durfte. Aber Herr Stangl wollte es wissen. Sein Versprechen an sich selbst lautete: Ich zeige dem Kunden jetzt schon, was ich einmal können möchte. So gut es geht. Obwohl ich es noch nicht darf. Nicht um den Kunden zu täuschen, sondern weil ich es sonst vielleicht nie lerne.
„ICH LERNE NOCH“ – WER EIGENTLICH NICHT?
Es hätte nur ein winziges Detail am Outfit von Johannes Stangl anders sein müssen und sein mutiger Fake wäre ihm unmöglich gewesen. Ahnen Sie, was ich meine? Bestimmt sind Sie als Kunde irgendwo schon einmal von einem jungen Menschen bedient worden, der einen Anstecker mit dieser Aufschrift trug: „Ich lerne noch.“ Was macht ein solcher Anstecker mit Ihnen als Kunde? Keine Frage: Er schraubt Ihre Erwartungen auf die Höhe der Auslegeware herunter. Sie glauben sofort zu wissen: Der kann noch nichts – und der wird deshalb auch nichts für mich tun können. Vielleicht geben Sie dem Lehrling dennoch eine kleine Chance, einfach weil Sie ein fairer, höflicher und geduldiger Mensch sind. Aber selbst dann wünschen Sie sich insgeheim, dass Ihr Ansprechpartner bald von einem erfahrenen Kollegen abgelöst wird.
Johannes Stangl konnte unerkannt faken, weil er ein Namensschild trug wie alle anderen Mitarbeiter. Darauf stand lediglich: „Herr Stangl“. Er fakte insofern bewusst, als er sich zu Beginn des Verkaufsgesprächs noch nicht als Lehrling zu erkennen gab. Sicher, er sah sehr jung aus. Doch die Lebenserfahrung lehrt: Es gibt 16-Jährige, die aussehen wie 26 – und 26-Jährige, die aussehen wie 16. Ich jedenfalls zweifelte keine Sekunde an Herrn Stangl. Weder an seiner Fachkompetenz noch an seiner Berechtigung, mir ein Auto zu verkaufen. Am Ende kaufte ich nicht nur einen neuen Geschäftswagen, sondern wurde Stammkunde in diesem Autohaus. Das bin ich übrigens bis heute. Die Grundlage dafür hat Herr Stangl gelegt. Getreu dem Motto: Es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Ob ich einem Lehrling mit dem Anstecker „Ich lerne noch“ einen Satz wie „Rechnen Sie in der Praxis mit etwa 7,5 Litern Verbrauch“ geglaubt hätte, ist dagegen sehr fraglich. Selbst das zartest aufkeimende Flämmchen fachlicher Autorität erstickt dieser Anstecker doch sofort wieder.
Trotzdem habe ich den Eindruck, dass solche Buttons bei Arbeitgebern gerade immer beliebter werden. In meinen Augen ist das ein Unding. Und dies nicht allein wegen des Paradoxons, dass in Zeiten immer kürzerer Halbwertzeiten des Wissens so gut wie alle arbeitenden Menschen noch, wieder oder jetzt erst recht lernen. „Ich lerne noch“ – wer eigentlich nicht? Schlimmer noch als dieser Denkfehler ist, dass der Kunde durch den Kennzeichnungsirrsinn um einen Gesprächspartner auf Augenhöhe betrogen werden soll. Der informierte, zumindest jedoch der vorinformierte Kunde ist im Internetzeitalter nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Auch ich wusste, bevor ich Herrn Stangl begegnete, schon einiges über die Modelle von VW und Audi. Der Konfigurator, den ein Autoverkäufer nutzt, unterscheidet sich ja nicht einmal von dem, der auch dem Kunden online zur Verfügung steht. Ich wäre maßlos enttäuscht gewesen, keinem echten Fachmann zu begegnen, der mein Vorwissen vertieft und ergänzt.
Wenn ich einen Anstecker mit der Aufschrift „Ich lerne noch“ sehe, dann denke ich mir: Na ja, da kenne ich mich dann wahrscheinlich besser aus als der. Manchmal stimmt das ja tatsächlich. Wer als Vielreisender ständig Autos mietet, der dürfte die einzelnen Schritte des Anmietvorgangs und die Optionen – wie Versicherungsschutz, Winterreifen und so weiter – besser kennen als ein Lehrling in der Autovermietung an seinem ersten Tag. Bei einem gekennzeichneten Auszubildenden denke ich nur: Hoffentlich hält der mich jetzt nicht zu lange auf! Und der Lehrling? Der kann, gekennzeichnet wie tropisches Obst, eigentlich gar nicht anders, als befangen zu sein: Ich lerne noch, ich kann noch nichts, alle sehen es – also ist es auch so. Eine klassische sich selbst erfüllende Prophezeiung. Im besten Fall wird der Lehrling hoffen, dass der Kunde besonders nett zu ihm ist. Im schlechtesten Fall wird er sich sagen: Ich habe das Recht, keine Ahnung zu haben – es sieht ja eh jeder, also soll sich auch keiner beschweren. Eine Chance, sich zu beweisen, bekommt er so oder so nicht.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.