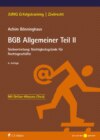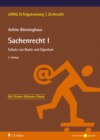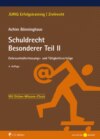Kitabı oku: «Schuldrecht Besonderer Teil I», sayfa 12
1. Teil Der Kaufvertrag › D. Die Rechte des Käufers bei Mängeln nach § 437
D. Die Rechte des Käufers bei Mängeln nach § 437
1. Teil Der Kaufvertrag › D. Die Rechte des Käufers bei Mängeln nach § 437 › I. Mangel und maßgeblicher Zeitpunkt
I. Mangel und maßgeblicher Zeitpunkt
144
§ 437 führt als Katalog die verschiedenen Rechte auf, die der Käufer bei Mängeln des Kaufgegenstandes hat. Bevor wir uns die Rechte im Einzelnen ansehen, betrachten wir vorweg die verschiedenen Formen des Mangels als zentralen Anknüpfungspunkt aller in § 437 genannten Rechte. Dabei geht es nicht nur um die Varianten des Sach- und Rechtsmangels, sondern auch um den maßgeblichen Zeitpunkt. Schließlich haben wir oben unter Rn. 62 ff. schon gesehen, dass die Mängelbeseitigung bereits als Primärleistungspflicht gem. § 433 Abs. 1 S. 2 geschuldet ist. Es stellt sich daher auch die Frage, wie die Primärleistungsphase (§ 433) von der Gewährleistungsphase (§§ 437 ff.) zeitlich abzugrenzen ist.

[Bild vergrößern]
145
Das Gesetz kennt zwei verschiedene Mängelkategorien, nämlich den Sachmangel gem. § 434 und den Rechtsmangel i.S.d. § 435. Innerhalb jeder Kategorien gibt es verschiedene Varianten. Sehen wir uns nun Sach- und Rechtsmangel nacheinander und mit den jeweiligen Varianten genauer an. Dabei gehen wir primär auf den Fall des Sachkaufs ein. Besonderheiten beim Rechtskauf werden am Ende behandelt.
1. Sachmangel, § 434
Sachmangel i.S.d. § 434
I.Sachmangel i.S.d. § 434 Abs. 1 S. 1
1.Beschaffenheitsvereinbarung
Versteckte HaftungsausschlüsseRn. 148 f.
2.Abweichen der „Ist-Beschaffenheit“ von der „Soll-Beschaffenheit“
II.Sachmangel i.S.d. § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 1
1.Keine Vereinbarung über konkrete Ist-Beschaffenheit
2.Vertraglich vorausgesetzte Verwendung
3.Fehlen der Eignung für vorausgesetzte Verwendung
III.Sachmangel i.S.d. § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2
1.Keine Vereinbarung über konkrete Ist-Beschaffenheit
2.Objektive Verkehrserwartung bzgl. Beschaffenheit/Verwendung
3.Bedeutung öffentlicher Äußerungen, insbesondere Werbung, § 434 Abs. 1 S. 3
IV.Montagefehler, § 434 Abs. 2
1.Fehlerhafte Montage
2.Fehler durch fehlerhafte Montageanleitung („Ikea-Klausel“)
Mangelhafte BedienungsanleitungRn. 163
V.„Aliud“ und „Manko“-Lieferung, § 434 Abs. 3
a) Sachmangel nach § 434 Abs. 1 S. 1
146
Ein Sachmangel kann zunächst in der konkreten Beschaffenheit der Kaufsache begründet liegen.

Beschaffenheit meint eine der Sache zumindest für gewisse Dauer anhaftende Eigenschaft, die ihren Grund im tatsächlichen Zustand der Sache hat.[1]
Beispiel
Beispiele anhand eines Pkws: Farbe, Ausstattung, Größe, Gewicht, Motorstärke, Höchstgeschwindigkeit, Verbrauch, Neuheit, Alter, Unfallfreiheit;
weitere Beispiele: Lage, Grenzverlauf und Bebaubarkeit eines Grundstücks, Urheberschaft an einem Kunstwerk.
Keine Beschaffenheit stellt beispielsweise der bloße Umstand dar, dass die Kaufsache importiert wurde.[2] Der Import „haftet“ der Sache eben nicht an.
Für die Entscheidung, ob die (tatsächliche) Beschaffenheit der Kaufsache als Sachmangel zu qualifizieren ist, kommt es in erster Linie auf die vertragliche Vereinbarung an (sog. „subjektiver Fehlerbegriff“).
aa) Beschaffenheitsvereinbarung
147
Ein Sachmangel liegt gem. § 434 Abs. 1 S. 1 vor, wenn die Kaufsache nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Die Vereinbarung kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen, unklare Angaben müssen nach §§ 133, 157 ausgelegt werden.
Beispiel 1
Autohändler V verkauft dem K ein als „neu“ bezeichnetes Auto.
Nach Auffassung der Rechtsprechung liegt bei Abschluss eines Kaufvertrages mit einem Kfz-Händler in der Beschreibung als „neu“ die Vereinbarung der Lieferung eines, abgesehen von der Überführungsfahrt, unbenutzten und „fabrikneuen“ Wagens.[3] „Fabrikneu“ ist ein PKW, wenn und solange das betreffende Modell im Zeitpunkt des Verkaufs vom Hersteller noch unverändert hergestellt wird, wenn es keine durch längere Standzeiten bedingte Mängel aufweist und wenn zwischen Herstellung des Fahrzeugs und Abschluss des Kaufvertrages nicht mehr als 12 Monate liegen.[4] Entscheidend ist bzgl. der unveränderten Herstellung, ob der Hersteller zum Verkaufszeitpunkt intern die Produktion eingestellt hatte, nicht dagegen, ob der Hersteller zu diesem Zeitpunkt bereits die neue Modellserie an die Händler ausgeliefert hatte.[5]
Beispiel 2
Die Angabe „Unfallschäden laut Vorbesitzer: Nein“ im Kaufvertrag stellt keine Beschaffenheitsvereinbarung i.S.d. § 434 Abs. 1 S. 1 dar. Vielmehr handelt es sich lediglich um eine reine Wissensmitteilung, mit der der Verkäufer die Angaben des Vorbesitzers wiedergibt.[6] Durch die Bezugnahme auf die Auskunft des Vorbesitzers gibt der Verkäufer hier gerade zu erkennen, selber nicht verbindlich dafür einstehen und die Gewähr für die Richtigkeit übernehmen zu wollen.
Beispiel 3
Der Verkauf eines PKW als „fahrbereit“ bedeutet, dass das Fahrzeug nach seiner Beschaffenheit betriebsbereit und nicht mit verkehrsgefährdenden Mängeln behaftet ist, aufgrund derer es bei einer Hauptuntersuchung als verkehrsunsicher eingestuft werden müsste.[7]
bb) Besonderheiten beim Verbrauchsgüterkauf
148
Beim Verbrauchsgüterkauf i.S.d. § 474 Abs. 1 gelten im Zusammenhang mit Beschaffenheitsvereinbarungen Besonderheiten.

Nehmen wir im vorstehenden Beispiel 3 einmal an, der Verkäufer des Gebrauchtwagens sei Unternehmer i.S.d. § 14 und der Verkäufer handele bei Vertragsschluss als Verbraucher i.S.d. § 13. Die Parteien hätten dann einen Verbrauchgüterkaufvertrag i.S.d. § 474 Abs. 1 geschlossen. Da der Verkäufer um die Haftungsrisiken im Gebrauchtwagenhandel weiß, will er „auf Nummer sicher gehen“ und vereinbart deshalb mit dem Käufer zusätzlich, der Wagen habe „möglicherweise“ Unfallschäden. Stellt eine solche Vereinbarung eine nach § 476 Abs. 1 S. 2 unwirksame Umgehung der ansonsten nach § 476 Abs. 1 S. 1 zwingend ausgestalteten Einstandspflicht für Sachmängel dar oder kann sich der Verbraucher wirksam auf ein solches „Risikogeschäft“ einlassen?
Hinweis
Die Folge einer nach § 476 Abs. 1 unwirksamen Vereinbarung besteht darin, dass sich der Verkäufer darauf „nicht berufen kann“. Damit ist klargestellt, dass nur diese Vereinbarung unwirksam ist und der Vertrag im Übrigen wirksam bleibt – § 139 kommt also nicht zur Anwendung.
149
Die Abgrenzung zwischen Beschaffenheitsvereinbarung und unzulässiger Beschränkung der Käuferrechte orientiert sich nach überwiegender Auffassung an der Frage, ob die jeweilige Vereinbarung dazu führen soll, dass der Käufer das Risiko eines verborgenen Mangels trägt.[8] Je konkreter dem Käufer durch die Vereinbarung konkrete Beschaffenheiten bzw. Defizite vor Augen geführt bekommt, desto eher ist eine Beschaffenheitsvereinbarung anzunehmen, deren freie Ausgestaltung § 476 Abs. 1 nicht beschränken will.[9] Ein wichtiges Indiz für eine zulässige Beschaffenheitsvereinbarung ist auch, ob sich die Festlegung der Beschaffenheit tatsächlich auf den Preis ausgewirkt hat.
In dem Fall, dass der Verkäufer mit dem Käufer vereinbart, der Wagen habe „möglicherweise Unfallschäden“, liegt eine unzulässige Abwälzung des Risikos vor. Art und Ausmaß etwaiger Vorschäden bleiben völlig unklar. Selbst wenn der Verbraucher mit diesem Risiko gegen einen Preisnachlass leben will, kann er dieses Risiko nicht wirksam auf sich nehmen. Dieses Verbot, „die Katze im Sack“ kaufen zu können, wird zwar als Entmündigung des Verbrauchers kritisiert, ist aber de lege lata hinzunehmen.[10] Anders läge es, wenn die Parteien vereinbaren: „Auto hat Unfallschäden“, und sich dies tatsächlich im Preis ausgewirkt hat. Keinesfalls kann der Verkäufer so eine Formulierung vorschieben, wenn die Parteien selber nicht wirklich von Unfallschäden ausgingen und deshalb der marktübliche Preis für ein unfallfreies Fahrzeug vereinbart wurde.
b) Sachmangel nach § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 1
150
Abweichend von § 434 Abs. 1 S. 1 kann es auch so sein, dass sich die Parteien nicht auf bestimmte Beschaffenheiten verständigt haben, sondern sich nur über die Eignung der Sache für eine bestimmte Verwendung ausdrücklich oder konkludent einig geworden sind. Hier muss die Kaufsache also solche Beschaffenheiten aufweisen, die im Ergebnis zu der vertraglich vorausgesetzten Eignung führen.
Beispiel
V verkauft dem K eine Druckerpatrone für einen Laserdrucker. Die Patrone ist kein vom Hersteller des Laserdruckers hergestelltes Ersatzteil. V teilt dem K aber mit, dass die Patrone gerade auch für seinen Laserdruck geeignet sei. Nun stellt sich heraus, dass die verkaufte Druckerpatrone nicht die besonderen Haken aufweist, um sie in die Haltevorrichtung des Laserdruckers von K einrasten zu lassen. Sie kann daher in diesem Laserdrucker nicht verwendet werden.
Über die besonderen Haken haben V und K keine Vereinbarung getroffen und sich wohl noch nicht einmal Gedanken gemacht. Entscheidend kam es ihnen aber darauf an, dass die Patrone im Laserdrucker des K eingesetzt werden kann. Da dafür wiederum diese Haken notwendig sind, liegt aufgrund der abweichenden Ausgestaltung der verkauften Patrone ein Sachmangel vor.
Hinweis
§ 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 ist ein praktisch wichtiger Auffangtatbestand zu § 434 Abs. 1 S. 1. Denn meistens werden sich die Parteien keine Vorstellungen über eine bestimmte Beschaffenheit machen, sondern ihre Aufmerksamkeit darauf richten, dass sich die Sache für eine bestimmte Verwendung eignet.
151
Wiederum ist im Falle des Verbrauchsgüterkaufs an eine unzulässige Umgehung i.S.d. § 476 Abs. 1 S. 2 zu denken.
Beispiel
Nehmen wir an, der Unternehmer V verkauft dem Verbraucher K einen gebrauchten PKW als „Bastlerfahrzeug“:[11] Gehen die Parteien tatsächlich von einer fehlenden Funktionsfähigkeit aus, ist die Vereinbarung insoweit als wirksame Festlegung fehlender Eignung anzusehen („kann nicht als Fahrzeug eingesetzt werden“). Ist die Angabe vom Verkäufer bloß vorgeschoben und im Preis nicht berücksichtigt, liegt eine unwirksame Umgehung der Haftung für die übliche Beschaffenheit nach § 476 Abs. 1 S. 2 vor.
c) Sachmangel nach § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2
aa) Gewöhnlicher Maßstab für Beschaffenheit und Verwendung
152
Fehlt es sowohl an einer Beschaffenheitsvereinbarung als auch an einer im Vertrag von den Parteien vorausgesetzten Verwendung, gilt subsidiär der so genannte „objektive Fehlerbegriff“. Danach kommt es darauf an, ob sich die Kaufsache zur gewöhnlichen Verwendung eignet und ob sie eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach Art der Sache erwarten kann (§ 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2). Als Vergleichsmaßstab ist die normale, durchschnittliche Beschaffenheit von Sachen gleicher Art heranzuziehen. Für die Beurteilung dessen, was der Käufer erwarten darf, kommt es ebenfalls auf den Durchschnittskäufer an.
Beispiel 1
K erwirbt von V dessen 7 Jahre alten Pkw Golf. K stellt fest, dass das Fahrzeug im Stadtverkehr 9 Liter Benzin auf 100 km verbraucht. K möchte von dem Kaufvertrag zurücktreten. Er ist der Ansicht, der Benzinverbrauch sei viel zu hoch. Über den Benzinverbrauch hatten K und V nicht gesprochen.
Da K und V über den Benzinverbrauch gar nicht gesprochen hatten, kommt allenfalls ein Mangel im Sinne von § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 in Frage: Zur gewöhnlichen Verwendung – das Fahren – eignet sich der Golf ohne weiteres. Fraglich ist aber, ob er die Beschaffenheit aufweist, die üblich ist und vom Käufer erwartet werden durfte. Ein durchschnittlicher Benzinverbrauch von 9 Liter pro 100 km im Stadtverkehr ist für gebrauchte Fahrzeuge nicht unüblich. Dass K andere Erwartungen hatte, muss hier außer Betracht bleiben: Das Fahrzeug entspricht dem, was ein durchschnittlicher Käufer erwarten würde. Eine – zu hoch geschraubte – diesbezügliche Erwartung hätte K deutlich machen und mit V eine entsprechende Beschaffenheit gem. § 434 Abs. 1 S. 1 vereinbaren müssen. Ein Mangel liegt nach alledem nicht vor.
Beispiel 2
K erwirbt ein Pferd von V, bei dem ein genetischer Defekt festgestellt wird. Das für sich allein rechtfertigt die Begründung eines Mangels nach §§ 90a S. 3, 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 noch nicht. Denn zur „üblichen Beschaffenheit“ eines Tieres gehört es nicht, dass es in jeder Hinsicht einer biologischen „Idealnorm“ entspricht.[12] Diese Sichtweise trägt dem Umstand Rechnung, dass Tiere als Lebewesen einer ständigen Entwicklung unterliegen und mit individuellen Anlagen ausgestattet sind.[13] Gewisse – auch genetisch bedingte – Abweichungen vom biologischen Idealzustand kommen bei Lebewesen erfahrungsgemäß häufig vor und gehören gerade zu den Beschaffenheiten, mit denen gerechnet werden muss.[14] Ein genetischer Defekt stellt deshalb nur dann eine beachtliche Beschaffenheitsabweichung i.S.d. § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 dar, wenn er bei vergleichbaren Tieren ungewöhnlich ist.
bb) Einfluss öffentlicher Angaben
153
Der Begriff der „üblichen Beschaffenheit“ wird durch § 434 Abs. 1 S. 3 ergänzt: Der Käufer darf auch solche Eigenschaften erwarten, die zwar an sich nicht zur gewöhnlichen Beschaffenheit der Sache gehören, die der Verkäufer, seine Gehilfen oder der Hersteller aber durch eine entsprechende öffentliche Äußerung der Sache selbst zugeordnet haben.
154
In drei Fällen sind die öffentlichen Äußerungen ohne Relevanz:
Wo ist das Tatbestandsmerkmal „Kennenmüssen“ gesetzlich definiert?
Der Verkäufer haftet nicht auf eine Beschaffenheit gemäß den öffentlichen Äußerungen, wenn er die betreffende Äußerung nicht kannte und sie auch nicht kennen musste.
Beispiel[15]
K erwirbt bei V einen neuen Pkw Golf. Dieser war in den Wochen zuvor in einer groß angelegten Pressekampagne des Herstellers als besonders sparsam beworben worden – das Fahrzeug verbrauche durchschnittlich lediglich 5 Liter Benzin auf 100 km. K und V hatten bei Abschluss des Kaufvertrages über den Benzinverbrauch nicht gesprochen. K stellt fest, dass das Fahrzeug entgegen den Ankündigungen in der Werbung durchschnittlich 6 Liter Benzin auf 100 km verbraucht.
Da K und V über den Benzinverbrauch nicht gesprochen hatten, kommt lediglich eine Mangelhaftigkeit gem. § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 in Betracht. An der Tauglichkeit zur üblichen Verwendung des Fahrzeuges als Fortbewegungsmittel ändert der höhere Benzinverbrauch nichts. Es ist auch nicht unüblich, dass der Benzinverbrauch eines Neuwagens über 5 Litern pro 100 km liegt. Der Benzinverbrauch von nur 5 Litern könnte hier aber gem. § 434 Abs. 1 S. 3 zur üblichen Beschaffenheit gehören, die K erwarten durfte. Eine Pressekampagne des Herstellers ist zweifellos als „öffentliche Äußerung“ im Sinne von § 434 Abs. 1 S. 3 zu bewerten. Der Benzinverbrauch betrifft auch eine bestimmte, nachprüfbare Eigenschaft des Fahrzeugs (nicht unter § 434 Abs. 1 S. 3 fallen dagegen allgemeine, „reißerische“ Anpreisungen). Fraglich bleibt, ob V sich mit Erfolg darauf berufen kann, dass er von der Werbekampagne keine Kenntnis hatte. Gem. § 434 Abs. 1 S. 3 kommt es darauf an, ob der Verkäufer die Äußerung kannte oder kennen musste. „Kennenmüssen“ meint nach der Definition in § 122 Abs. 2 Fahrlässigkeit im Sinne von § 276. Es kommt also darauf an, welche Sorgfalt im Verkehr als erforderlich anzusehen ist. Dazu wird man zumindest eine begrenzte Beobachtungspflicht dergestalt rechnen müssen, dass der Verkäufer eine Darstellung der von ihm verkauften Produkte in den Massenmedien kennen muss. Demzufolge kann V sich im Beispielsfall nicht darauf berufen, die Werbekampagne sei ihm unbekannt gewesen. Ein Mangel liegt also vor.
155
Öffentliche Äußerungen sind außerdem unbeachtlich, wenn die Äußerung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in gleichwertiger Weise berichtigt worden war.
Entscheidend kommt es hier darauf an, dass die Berichtigung der Äußerung auf einem Weg erfolgt, der denselben Wirkungsgrad hat.
Beispiel
Die Aussagen in einem TV-Werbespot werden nicht in „gleichwertiger Weise“ berichtigt, wenn beim Händler ein Flyer mit Hinweisen auf den „Fehlerteufel“ im TV-Spot ausliegt.
156
Schließlich sind solche Äußerungen unbeachtlich, wenn die Äußerung keinen Einfluss auf die Entscheidung des Käufers haben konnte. Entscheidend ist hier, ob eine Beeinflussung der Käuferentscheidung (objektiv) ausgeschlossen war.
Beispiel
Die falsche Werbeaussage findet sich in der japanischen Übersetzung einer Werbebroschüre, die dem deutschsprachigen Käuferkreis nicht zugänglich war.
d) Montagefehler (§ 434 Abs. 2 S. 1)
157
Ein Sachmangel ist nach § 434 Abs. 2 S. 1 auch dann gegeben, wenn eine vereinbarte Montage durch den Verkäufer oder dessen Erfüllungsgehilfen unsachgemäß durchgeführt worden ist.
aa) Vereinbarte Montageleistung
158
Ein Montagemangel im Sinne von § 434 Abs. 2 S. 1 setzt zunächst voraus, dass der Verkäufer die Montage vertraglich übernommen hat. Die Montagepflicht ist dann Hauptleistungspflicht.[16]
bb) Fehlerhafte Montage
159
Die Montage wurde unsachgemäß ausgeführt, wenn die montierte Sache bei Gefahrübergang und Abschluss der Montageleistung nicht der vertraglichen Vereinbarung entspricht (§ 434 Abs. 1 S. 1) oder wenn sie nicht den nach § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 geschuldeten Anforderungen entspricht.[17]
e) Mangelhafte Montageanleitung (§ 434 Abs. 2 S. 2)
aa) Bestimmung zur Montage
160
§ 434 Abs. 2 S. 2 erfordert zunächst, dass der Kaufgegenstand „zur Montage bestimmt“ ist. Das ist der Fall, wenn der bestimmungsgemäße Gebrauch der Sache erkennbar ein Zusammensetzen von Einzelteilen, eine Aufstellung, einen Einbau oder einen Anschluss erfordert.[18] In allen diesen Fällen setzt das Gesetz die Notwendigkeit einer (mündlichen oder schriftlichen) Montageanleitung voraus.
bb) Fehlerhafte Montageanleitung bei Gefahrübergang
161
Fehlt die Montageanleitung ganz, liegt bereits ein Mangel nach § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 vor.[19]
Die Montageanleitung ist mangelhaft, wenn sie den ganz überwiegenden Teil der potenziellen Käufer nicht in die Lage versetzt, die Montage fehlerfrei durchzuführen.[20]
162
Ein Sachmangel liegt nach § 434 Abs. 2 S. 2 Hs. 2 allerdings trotz mangelhafter Montageanleitung nicht vor, wenn die Montage dennoch fehlerfrei gelingt. Für diesen Ausnahmetatbestand trägt der Verkäufer die Beweislast, wie sich aus der Gesetzesformulierung „es sei denn“ ergibt.
Beispiel
Der K erwirbt im Möbelmarkt der V GmbH für 250 € ein Kinderhochbett mit Rutsche zum Selbstaufbau. Die Montageanleitung ist – da sie durch ein automatisches Übersetzungsprogramm aus dem Schwedischen völlig falsch ins Deutsche übersetzt wurde – ganz und gar unverständlich. Dem handwerklich geschickten K gelingt es trotzdem, das Bett fehlerfrei aufzubauen.
Da die Montageanleitung laut Sachverhalt unverständlich gewesen ist, war ein ordnungsgemäßer Zusammenbau des Bettes auf ihrer Grundlage für einen durchschnittlich versierten Käufer nicht möglich. Die Montageanleitung war somit mangelhaft. Das Vorliegen eines Sachmangels ist hier aber ausnahmsweise gem. § 434 Abs. 2 S. 2 Hs. 2 ausgeschlossen. Trotz der mangelhaften Montageanleitung war dem K die fehlerfreie Montage gelungen, so dass die Voraussetzungen für diesen Ausschlusstatbestand vorliegen. Die mit dem Aufbau verbundenen Strapazen und Mühen berechtigten nach der gesetzgeberischen Entscheidung also noch nicht einmal zu einer Minderung.
163

Fraglich ist, ob § 434 Abs. 2 S. 2 auf die Lieferung mangelhafter Bedienungsanleitungen (analog) anzuwenden ist.
Beispiel
K hat sich eine neue Digitalkamera gekauft, der versehentlich eine Bedienungsanleitung ausschließlich auf Chinesisch und Japanisch beigefügt wurde. K weiß mit den Schriftzeichen nichts anzufangen und kann deshalb mit der Kamera nicht richtig umgehen.
Für eine analoge Anwendung des § 434 Abs. 2 S. 2 auf mangelhafte Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen spricht die Ähnlichkeit der Fallgestaltungen. Es ist aber zweifelhaft, ob die für eine analoge Anwendung erforderliche planwidrige Regelungslücke überhaupt besteht. Denn in der mangelhaften Gebrauchs- oder Bedienungsanleitung kann man bereits ein Sachmangel im Sinne von § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 sehen, weil Kaufsache und Bedienungsanleitung eine Einheit bilden und sich die Kaufsache nur zum gewöhnlichen Gebrauch eignet, wenn ihre Nutzung – für die die Bedienungsanleitung erforderlich ist – möglich ist.[21] Einer analogen Anwendung des § 434 Abs. 2 S. 1 bedarf es deshalb nicht.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.