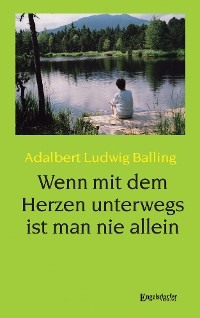Kitabı oku: «Wenn mit dem Herzen unterwegs ist man nie allein», sayfa 2
Serva ordinem et ordo te servabit
Diesen lateinischen Spruch hat uns Novizen3 in den 1950er Jahren Pater Augustin solange nahegelegt, bis wir auch seine mahnenden Worte richtig zu deuten wussten.
Es spricht vieles für diesen Leitspruch, aber mit den Jahren mag er auch abgedroschen und altfränkisch klingen, vor allem wenn hin und wieder flotte Sprüche dagegen ins Feld geführt werden, etwa die Aussage des Schweizer Autors Max Frisch: »Ordnung braucht nur, wer mit der Welt nicht eins ist.«
Natürlich gibt es auch jene, die jede Art von Ordnung als Zwang betrachten und jede Form gesellschaftlicher Etikette und Ordentlichkeit als Einmischung bzw. Beschränkung der persönlichen Freiheit verstehen und sie deswegen strikt ablehnen. Auch nur die geringste Anweisung wird ignoriert; so jede noch so vorsichtige Empfehlung und jeder als hilfreich gedachter Ratschlag von außen.
Was tun? Trotz allem an das Gute im Menschen glauben und nicht aufhören, gut auch zu denen hinzudenken, die einem nichts als Prügel zwischen die Beine werfen. Wenn später aus ihren Prügeln gar Felsbrocken werden, dann sollte man am besten heute noch damit beginnen, aus den Steinen Straßen, Gartenmauern und Brücken zu errichten…
Böses sollte man niemals mit Bösem vergelten oder bekämpfen wollen; Gutes allenfalls mit Gutem beantworten. Denn nur wer mit dem Herzen unterwegs ist, kann auch die Herzen erreichen.
Samstags wird die Insel gekehrt
In meiner Kindheit und Jugend war es üblich, am Samstagnachmittag die Dorfstraßen und den Hof zu kehren. Am Sonntag sollten die Dorfstraßen frei sein von Ackerschollen und Steinen; sonntags kleidete man sich festtäglich; sonntags ging man morgens zur Messe und am frühen Nachmittag in die Andacht. Schwere Arbeiten verrichtete man an Sonn- und Feiertagen nicht; nur das Viehfüttern und Viehbetreuen war erlaubt; selbstverständlich. Gelegentlich gab der Dorfpfarrer auch Sondererlaubnis, wenn zum Beispiel schlechtes Wetter drohte und das Heu oder die Getreideernte noch nicht eingefahren waren. Das passierte selten. Ansonsten wurde das Sonntagsgebot strikt eingehalten.
Damals betete man auch noch regelmäßig den Wettersegen. Und an den Bitttagen wurde durch die Fluren »gewallt« – mit Kreuz und Fahnen, häufig auch von der dörflichen Blaskapelle begleitet. Gemeinsam betete man um gutes Wetter und um Gottes Segen für eine gute Ernte.
Na gut, wir waren beim Straßen- und Hofkehren am Samstag. Damals, vor Jahrzehnten, als wir unsere Besen noch selber anfertigten. Unser Papa war überhaupt sehr geschickt beim Herstellen einfacher Werkzeuge. Neben Birkenbesen stellte er auch Holzrechen her, Weidenkörbe, Strohnäpfe, Hanf- und Sisalseile und dergleichen mehr.
Anfang der 1970er Jahre stieß ich auf eine ähnliche Sitte des wöchentlichen, öffentlichen Reinigens. Und zwar weit entfernt in der Südsee, genauer gesagt, auf den Siassí-Inseln, die Papua-Neuguinea vorgelagert sind. Dort wirken seit über fünfzig Jahren Mariannhiller Missionare. Sie waren es, die den seltenen Brauch einführten, wenigstens einmal pro Woche das Inselchen, etwa von der Größe eines Fußballfeldes, von den Schulkindern fegen zu lassen.
Das Kehren besorgen die Kanaken-Kinder mit ganz einfachen Palmwedeln. Wenn sie samstags vor dem Gebäude ihrer Volksschule gemeinsam zum Inselsäubern antreten, herrscht Hochbetrieb. Ein Bild für Götter!
Als ich später, wieder zurück in Deutschland, davon erzählte, meinten viele: Wie herrlich! Echte Südsee-Romantik! Aber für die Einheimischen ist es Alltag; auch sie müssen sich (auch heute noch) erst mal das Salz in der Suppe verdienen. Gar so sorglos, wie es mitunter scheint, ist ihr Alltag auch nicht. Da gilt es, jeden Tag ein Mittag- und Abendessen vorzubereiten. Die Männer fahren zum Fischen aufs Meer hinaus. Oder sie paddeln in ihren selbstgemachten Auslegerbooten zur Gartenarbeit. Der gemeinsame Garten liegt mehrere Kilometer entfernt auf einer größeren Insel, die etwas mehr Humus hat als das eigene Atoll. Auch das ist körperlich anstrengend und zeitraubend.
Die Schulkinder benützen ebenfalls Kanus, um morgens auf das fußballfeldgroße Eiland zu gelangen, wo die Schulgebäude stehen sowie die Hütten der Lehrer, aber auch die mickrigen Behelfsbauten der Missionare und Missionshelfer.
Also, das Leben auf den Siassi-Inselchen vor der Ostküste Papua-Neuguineas ist kein Zuckerschlecken; auch ihnen flattern keine gebratenen Tauben in den Mund; und von Südsee-Romantik reden allenfalls die Touristen. Auch das Kehren und Verschönern der Insel ist mühsame Handarbeit. Aber den Schulkindern macht es Spaß; sie lachen und singen dabei; es gehört zu ihrem Alltag…
Wer sich geliebt weiß, wird niemals ernsthaft krank
Frau G. war 100 Jahre alt geworden. Nach der Frühmesse in der Kapelle des Seniorenheims, in der wir ihrer in besonderer Weise gedacht hatten, wünschte ich ihr abermals alles Liebe und Gute, vor allem Gottes Segen für die kommenden Jahre. Dazu sangen alle Umstehenden das übliche »Happy Birth-Day«! Da flüsterte mir die Jubilarin zu: »Herr Pater, wollen Sie mich heute nicht auch einmal umarmen!?« – Ich nickte lachend, beugte mich hinunter und nahm sie, dieses zarte, schier durchsichtige Persönchen, vorsichtig in die Arme. Jetzt zwinkerte Frau G. mit vor Freude lachenden Augen und sagte: »Fester, Herr Pater, fester!« Und alle Umstehenden klatschten Beifall, als ich sie ein zweites Mal in die Arme schloss.
Knapp 14 Tage später starb sie, die stets frohgelaunte und nie trübsinnige Frau G. Ein paar Tage zuvor hatte ich sie noch gefragt, diesmal unter vier Augen, wie sie es denn schaffe, nie den Kopf hängen zu lassen. Ihre prompte Antwort lautete: Wer sich Gott anvertraut, braucht sich nie zu fürchten; wer versucht, dankbar zu leben und auch für andere da zu sein, wird auch selber geliebt. Wer sich angenommen und geliebt weiß, wird niemals ernsthaft krank. »Und das ist mein Rezept, 100 Jahre alt zu werden: Was du nicht willst, das man dir antut, das füge auch keinem andern zu!«

GUTE MENSCHEN STERBEN NICHT
Sie leben fort in den Herzen derer, die ihnen Gutes wünschen
Gute Menschen leben fort in der Erinnerung ihrer Freunde, in den Gebeten derer, die gut an sie denken. Gute Menschen bleiben mit uns in inniger Verbindung – auch vom Jenseits her.
Ich kenne und erinnere mich zahlreicher guter Menschen, aus meinem Verwandten- und Bekanntenkreis, aber ganz besonders auch aus meiner Gemeinschaft, der Missionare von Mariannhill. Viele von ihnen, fast alle, hätten es verdient, dass man über sie schriebe, damit auch andere von ihrer Güte und Liebenswürdigkeit erführen. Über mehrere von ihnen habe ich bereits geschrieben: Kurze Porträts in zwei Taschenbüchern4.
Über das Leben einiger von ihnen erschienen sogar dicke Biografien5, die viel Bewundernswertes aus ihrem Leben festhalten. Darunter befinden sich neben Patres (und Bischöfen) auch Ordensbrüder.
Ich weiß, mehrere männliche Ordensgemeinschaften dünken sich besonders modern und aufgeschlossen, indem sie keinen Unterschied mehr machen zwischen Priestern und Nicht-Priestern, sondern jedes Mitglied in gleicher Weise mit BRUDER ansprechen.
Wir (die Missionare von Mariannhill) folgten diesem Trend nicht. Aber mittlerweile können bei vielen klösterlichen Gemeinschaften, auch bei uns, (sogar einfache) Laien-Brüder das Amt des Superiors übernehmen und Hausgemeinschaften vorstehen. Und, was bis vor einigen Jahren vom Ordensrecht nicht erlaubt war: Auch Brüder können jetzt in ihrer eigenen Gemeinschaft (natürlich nach entsprechenden Studien) die Priesterweihe empfangen. Früher mussten sie, wenn sie als »Spätberufene« Priester werden wollten, die Kongregation wechseln; in der eigenen Gemeinschaft war es nicht erlaubt, dass ein Bruder später auch zum Priester geweiht wurde. Das war weithin Ordensrecht, für (fast) alle klösterlichen Gemeinschaften verpflichtend! – All das hat mich bewogen, im Folgenden nur Ordensbrüder (keine Patres) aus meiner Gemeinschaft auszuwählen, über die ich kurz berichten möchte.
Eigentlich waren bei uns schon zur Zeit der Gründung gerade die Brüder hoch in Ehren: Abt Franz Pfanner, auf den die Gemeinschaft der Missionare von Mariannhill zurückgeht, hatte von Anfang an sehr viel mehr Brüder als Priester in seinen Reihen. Schon damals etwas eher Außergewöhnliches! So ist es für mich auch relativ leicht, an prominente Brüder zu erinnern, die Großes, um nicht zu sagen Geniales, geleistet haben. Einige von ihnen starben im Rufe der Heiligkeit:
Das Herrgöttle von Natal
NIVARD STREICHER (1854–1927) – Er war einfacher Möbelschreiner aus Erding bei München, ehe er sich den Mönchen von Banjaluka (Bosnien) – und später in Mariannhill in Südafrika anschloss. Abt Franz Pfanner erkannte schon sehr früh die Fähigkeiten des jungen Bruders und machte ihn zu seinem Vertrauensmann. Nivard, sein Klostername, wurde, fast nebenbei und im Eigenstudium, Ingenieur und Architekt; obendrein auch Fachmann für Landwirtschaft und Viehzucht im südlichen Afrika. Er baute zahlreiche Kirchen, Konvente, Schulen und Werkhallen, aber auch künstliche Staudämme, Elektro-Anlagen und Wasserleitungen. Die Regierung von Natal erkannte Nivards geniale Fähigkeiten und schenkte ihm zeitlebens ein Gratis-Ticket für die Bahn, nicht zuletzt um diesen Allroundman auch für ihre Zwecke zu nützen, vor allem als Ratgeber für größere bautechnische Projekte.
Als er 1927 starb, nannten ihn viele seiner (nicht immer ganz neidlosen) Mitbrüder das »Herrgöttle von Natal«, andere titulierten ihn »den braunen Abt von Mariannhill« – braun war damals die Ordenskleidung der Brüder. Natürlich steckte in beiden Spitznamen auch etwas »liebevoll Spöttisches«. Seine Mitbrüder wussten nur zu gut: Bruder Nivard war ein Genie, das sich fast alles selber beibrachte. Und doch blieb er zeitlebens einfach, bescheiden – und fromm. Der Rosenkranz war sein steter Begleiter…
Der Wandermönch von Triashill
ÄGIDIUS PFISTER (1876–1932) – Es war vor rund 55 Jahren in Gweru (damals hieß es noch Gwelo) im heutigen Simbabwe. Bischof Schmitt (Bulawayo) hatte mich, den Neuling im Land, gebeten, mit einem geliehenen VW-Käfer vier afrikanische Lehrer zu einer Tagung über die Soziallehre der Katholischen Kirche in die Nachbarstadt zu bringen. Es trafen sich etwa 60 bis 70 Geistliche und Laien, unter ihnen ein paar Europäer; mehrheitlich waren es schwarze Lehrer und Sozialarbeiter. Wortführend waren britische Jesuiten-Missionare, die ich sehr zu schätzen wusste.
In der ersten Tee-Pause am Vormittag kam ein älterer Afrikaner auf mich zu, streckte mir die Hand entgegen und sagte: »Willkommen, Herr Pater! Sie sind mein Freund!« – Ich stutzte, hob ungläubig die Schultern und fragte: »Woher kennen wir uns? Ich kann mich nicht erinnern, Sie je gesehen zu haben.« – Der Mann schüttelte mir trotzdem die Hand und erklärte freundlich: »Stimmt. Aber Sie sind dennoch mein Freund; denn alle Mariannhiller sind meine Freunde. Warum? Weil mich ein Bruder von Ihnen getauft hat – und der auch meine Eltern und Großeltern vom Christentum überzeugt hat. Das war der gute, unvergessliche Brother Ägidius!« – Als ich nachfragte: »Ägidius who?«, erzählte er mir in wenigen Worten, was er noch von diesem Bruder wusste, der inzwischen schon 30 Jahre tot war. – Und als ich wieder nach Bulawayo zurückkam, fragte ich jeden unserer älteren Missionare, was sie noch über ihn wussten. Einheitlich, alle ohne Ausnahme, schilderten mir den Bruder als einen heiligmäßigen Mann. »Der liebe gute Ägid!« sagte einer nach dem andern, und alle verwiesen auf seine unwahrscheinliche Regsamkeit als Wandermönch und Katechet, der jährlich Tausende von Kilometern zu Fuß zurücklegte – nur um möglichst viele noch Nicht-Christen (Heiden sagte man damals noch) zu bekehren. Kein Wunder, dass der alte Mann aus Triashill mir bei oben erwähntem Treffen über die Soziallehre der Kirche gleich am Anfang den Bruder einen Heiligen nannte – und alle, die Ägids Gemeinschaft angehörten, als seine persönlichen Freunde.
Damals fing ich an, alles, was ich über diesen Mariannhiller Bruder erfahren konnte, zu notieren und zu sammeln. Das war der Anfang meiner diesbezüglichen Recherchen. 40 Jahre später begann ich, eine Biografie6 über ihn zu schreiben. Seit Erscheinen des Buches bin ich überzeugt, dass Bruder Ägidius eines Tages selig- und heiliggesprochen werden wird. Ich denke, dass der einheimische Klerus schon dafür werben wird, um den Seligsprechungsprozess zu initiieren – vielleicht in Abstimmung mit den Bistümern Umtali (Mutare) und Bulawayo, der Heimatdiözese Rottenburg-Stuttgart sowie der Gemeinschaft der Missionare von Mariannhill.
Bettler im Auftrag eines Höheren
STANISLAUS HASELBACHER (1854–1949) – Es sei schier unmöglich, etwas Gutes zu schreiben, ohne sich guter Menschen zu erinnern. An dieses Wort von Georg Christoph Lichtenberg musste ich denken, als ich mich verstorbener Mitbrüder erinnerte, an deren Gutsein und Gutes-Tun ich kurz erinnern wollte. In der Tat, wir erinnern uns ihrer auch noch nach Jahrzehnten: Die Toten sind niemals tot; sie bleiben uns verbunden; sie leben fort in unseren Gesprächen, in unseren Erinnerungen, in unseren Gebeten.
So war es auch bei Bruder Stanislaus. Er stammte aus Maria-Trost in der Steiermark und erlernte das Müller-Handwerk. Mit 25 Jahren schloss er sich den Trappisten von Banjaluka an, eine Neugründung Franz Pfanners, des späteren Abtes von Mariannhill in Südafrika. Der erkannte die Begabung des jungen Bruders und machte ihn zum Bubenpräfekten und Brüder-Magister. Einer von ihnen war noch vor der Jahrhundertwende (um 1898) zum Priester geweiht worden; der erste schwarze Weltpriester aus Natal!
Schon bald übertrug Pfanner dem tüchtigen Bruder aus Österreich ganz andere Aufgaben; er sollte künftig in Europa um Ordensberufe und Gelder für die Mission im südlichen Afrika werben. In unzähligen Vorträgen machte er seine Hörer in Deutschland, Österreich und in der Schweiz auf die Mariannhiller Missionare aufmerksam. Er durfte sogar von den Kanzeln großer Kathedralen predigen; damals noch etwas ganz Neues für einen Laienbruder! – Seine Hauptstützpunkte waren Graz und Linz in Österreich sowie Gersau und Altdorf in der Schweiz.
Trotz seines hohen Alters war er mit 90 immer noch rüstig und voller Esprit und Humor: »Ich bin ein Steiermärker«, pflegte er zu sagen, »und die Steiermärker werden immer stärker!« Mit 95 konnte er noch ohne Brille lesen. Voller Stolz erinnerte er sich an ein Pfanner-Wort: »Hier sieht’s traurig aus, meine lieben Brüder: Kein Baum, kein Strauch, kein Christ. Doch wenn wir hier nur eine Seele für den Himmel gewinnen, dann sind wir tausendfach belohnt.« – Br. Stanislaus starb 1949, hoch verehrt und geschätzt!
Vom Steinmetz am Kölner Dom zum Chef-Einkäufer von Mariannhill
MARTIN HEINLEIN (1855–1926) – Sein Markenzeichen war die Reisetasche. So wie bei Chamberlain der Regenschirm. Oder bei Helmut Schmidt die Zigarette.
In seinen frühen Jahren war das nicht so. Er stammte aus Ottelmannshausen bei Königshofen in der fränkischen Rhön; dort hatte er bei seinem Vater als Steinmetz gelernt. Nach der Gesellenprüfung ging er, wie damals üblich, auf die Walz »und war unter anderem«, wie er in seinen Memoiren gegen Ende seines Lebens schreibt, »zwei Jahre lang am Kölner Dom7 tätig, wo ich sozusagen erst ein richtiger Steinmetz wurde«.
Ernst Wichert schrieb einmal, die stillen Leben seien wie die Steine; sie wüchsen in der Tiefe, und niemand wisse von ihnen, »aber einmal werden die großen Dome aus ihnen gebaut.« Dieses Wort hätte er Bruder Martin Heinlein widmen können. Was wir heute von ihm selber wissen, stammt aus seinen späten Jahren. Davor war er viel zu beschäftigt, als sich damit ernsthaft zu befassen.
Es war ein sehr aktives Leben, vor allem als Reisender in Sachen Missionsabtei Mariannhill. – Mönch war er in Banjaluka/Bosnien geworden; Pfanner rekrutierte ihn für Südafrika, als er gerade Lazarettgehilfe beim Stabsarzt des 2.Bayerischen Pionier-Bataillonswerdenwollte. Einzige Bedingung des Abtes: Die Reisekosten zum Kap der Guten Hoffnung müsse er selbst tragen. Sollte es ihm in Südafrika nicht gefallen, so müsse er auf eigene Kosten nach Europa zurückreisen. Heinlein stimmte zu. Solch mutige Kerle imponierten Pfanner über alles. Er machte ihn schon bald zum Chefeinkäufer des soeben erst entstehenden missionarischen Zentrums von Mariannhill – samt Außenstationen. Mit kurzer Unterbrechung waren es insgesamt 25 Jahre.
Und, als Abt Franz einen Mann für Amerika suchte, um dort für die Mission zu werben, um Spenden und um geistliche Berufe, da war es Bruder Martin, den er über den Ozean schickte; er war der erste Mariannhiller Missionar überhaupt, der die USA betrat. Nach drei Jahren lösten ihn in Amerika zwei jüngere Brüder ab; Bruder Martin durfte in sein geliebtes Natal zurückkehren…
Mariannhill war als Missions-Abtei inzwischen für viele Außenstationen zuständig, und Bruder Martin wurde abermals Chef-Einkäufer des Zentrums.
Es muss wohl schon in den 90er Jahren gewesen sein, als Martin Heinlein bei einem seiner vielen Besorgungen in Durban Mahatma Gandhi begegnete, der vor seinem Freiheitskampf in Indien cirka 15 Jahre lang in Südafrika gelebt hatte. Bruder Martin lud den jungen indischen Rechtsanwalt (der auf seiner Rückreise von England, wo er studiert hatte, im südafrikanischen Natal hängen geblieben war) zu einem Besuch nach Mariannhill ein. Noch im späten Alter erinnerte sich Br.Martin an diesen Besuch. Gandhi sei nach seinem Rundgang sehr beeindruckt nach Durban zurückgekehrt. In einer englischsprachigen in Südafrika publizierten Zeitung veröffentlichte Gandhi einen ausführlichen Bericht über alles,was er dort gesehen und was ihn am meisten überrascht hat. Nach einem kurzen Besuch der Monastery-Kapelle kam ihm erstmals die Idee vom »gewaltlosen Widerstand«. Der Kreuzweg bzw. das stille Leiden Christi (ohne jede Gegengewalt) hatte ihn zutiefst bewegt.
Bruder Martins letzte größere Reise (1922) führte ihn in die Niederlande; man hatte ihn beauftragt, den kranken Bruder Nivard (Kloster-Architekt) nach Europa zu begleiten. Wieder in Natal, verbrachte er seinen Lebensabend im Altenheim von Mariannhill: »Ich habe mir besonders vorgenommen, da ich jetzt zu keiner anderen Arbeit mehr fähig bin, für meine Angehörigen, Freunde und Wohltäter zu beten«, pflegte er oft zu sagen. Wenige Tage vor seinem Tod beendete er seine Memoiren mit den Worten: »Ich kann diesen Bericht nicht beschließen, ohne dem lieben Gott nochmals von Herzen zu danken für die Liebe und Güte,womit er mich hierher geführt und mir erlaubt hat, in der Mission mitarbeiten zu dürfen. Er hat alles gelenkt und geleitet.«
Vom Bayerischen Jägerbataillon zum Förster von Mönchsdeggingen
EDUARD NIEDERMEIER (1896–1976) – Nach der Volksschule im heimatlichen Oberschweinbach bei Fürstenfeldbruck besuchte der Junge zwei landwirtschaftliche Winterkurse in Sankt Ottilien, war anschließend Praktikant in Starnberg und wurde 1914 zum Bayerischen Jägerbataillon in Freising einberufen. Der Erste Weltkrieg war ausgebrochen.
Nach dem Krieg (er war dreimal verwundet worden) arbeitete er beim Vermessungsamt in Fürstenfeldbruck, doch schon 1923 verließ er den Staatsdienst und trat bei den Mariannhiller Missionaren in Reimlingen ein. Vom Ries aus ging es ein Jahr später nach Südafrika,wo Bruder Eduard das Maurerhandwerk erlernte; Maurer waren überall gefragt. Später, als man seine Fähigkeiten besser kennenlernte, wurde er Präfekt und Lehrer am St. Francis College in Mariannhill bei Durban. Schließlich brach der Zweite Weltkrieg aus und Br. Eduard wurde, weil deutscher Staatsbürger, im Lager Pavianspoort bei Pretoria interniert – von 1939–1944. Dann wurde er auf eigenes Ersuchen hin repatriiert und kehrte nach Reimlingen zurück.
Hier übernahm er die Sorge um den Wald, ab 1952 vor allem um die den Mariannhiller Missionaren übergebenen Waldstücke bei Mönchsdeggingen. Waldbruder nannten wir ihn seitdem. Uns Novizen, die wir regelmäßig mit ihm im Wald arbeiteten, lehrte er Ehrfurcht vor allem, was grünte, aber auch den Sinn und die Wichtigkeit der körperlichen Arbeit. Nie fing er sein Tagewerk an, ohne vorher ein kurzes Gebet zu sprechen. Nicht selten überraschte er uns mit englischen Sinnsprüchen und Sprichwörtern und freute sich insgeheim, wenn er unsere »ungläubigen Gesichter« beobachtete. Sein Englisch war erstaunlich gut. Ich erinnere mich noch sehr genau, wie er ein englisches Zitat vortrug, schier salbungsvoll den Oxford-Akzent nachahmend: »The world is a stage and the men are the players!« (Die Welt ist eine Bühne, und die Menschen sind die Spieler!) Rasch und mit lachenden Augen fügte er hinzu: »Stammt nicht von mir, sondern von Shakespeare.«
Bruder Eduard war ein bayerisches Original im besten Sinne des Wortes. Krankheit und Leid ertrug er mit viel Geduld. Er wollte keinem zur Last fallen. Als er nicht mehr in den Wald gehen konnte, half er im Packraum der Reimlinger Druckerei mit. Dann zog er sich eine schwere Erkältung zu. Wenige Tage später schlief er leise ein – und wachte nicht mehr auf.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.