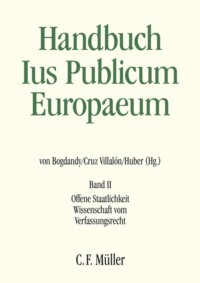Kitabı oku: «Handbuch Ius Publicum Europaeum», sayfa 2
2. Die Beratungen im Verfassungskonvent und im Parlamentarischen Rat
5
Im Verfassungskonvent von Herrenchiemsee und im Parlamentarischen Rat in Bonn waren es verschiedene Beweggründe, aus denen die Integrationsbereitschaft Deutschlands in der Präambel des Grundgesetzes zum Ausdruck gebracht und durch operationale Bestimmungen im Haupttext ergänzt werden sollte. Die Befürworter einte die Einsicht, dass ein dauerhafter Frieden in Europa nur durch eine Integration der europäischen Staaten zu erreichen wäre. Neben den überzeugten Europäern, zu denen etwa Konrad Adenauer, Carlo Schmid und Wilhelm Heile gehörten,[19] gab es auch Mitglieder, die für die Öffnung nach Europa votierten, da sie darin den einzigen Weg sahen, auf dem Deutschland wieder Wohlstand erlangen und als „voll souveräne[r] Staat in die europäische Völkergemeinschaft“[20] zurückkehren könnte.[21] Es gab in diesem Sinne durchaus auch eine politisch und wirtschaftlich interessengeleitete „Flucht nach Europa“.[22] Im Übrigen traten im Konvent von Herrenchiemsee und im Parlamentarischen Rat die auch die weitere Entwicklung prägenden unterschiedlichen Vorstellungen über die europäische Nachkriegsordnung zutage. Während nach einer Auffassung sich Europa als dritte Kraft zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten etablieren sollte, betonte eine andere Strömung die atlantische Verbindung zu den USA. Die stärkere Westbindung verstärkte freilich den Gegensatz zur Sowjetunion, so dass die Gegner dieser Politik geltend machten, dass dadurch zugleich die dauerhafte Spaltung Deutschlands immer wahrscheinlicher werde. Konkrete Konzepte für eine Einigung Europas traten im Übrigen bei den Beratungen zum Grundgesetz nicht zutage. In jedem Falle reichten die Vorstellungen über die auf der Londoner Sechs-Mächte-Konferenz im Juni 1948 geforderten Grundsätze, nach denen Deutschland jedenfalls in wirtschaftlicher Hinsicht mit den anderen Staaten Westeuropas verbunden sein sollte,[23] hinaus. Die Debatten im Verfassungskonvent und im Parlamentarischen Rat widerlegen daher auch in dieser Hinsicht die These, dass die im Grundgesetz getroffene Entscheidung für eine offene Staatlichkeit letztlich von den westlichen Alliierten erzwungen worden sei.
6
Die Deutlichkeit, mit der im Ergebnis das Grundgesetz die Grundentscheidung für die offene Staatlichkeit zum Ausdruck brachte, war auch gemessen am Maßstab der Verfassungsentwicklung in den anderen europäischen Staaten ein Novum. Dies gilt weniger für Art. 25 GG, der die allgemeinen Regeln des Völkerrechts zu einem mit Übergesetzesrang ausgestatteten Bestandteil des Bundesrechts erklärt. Diese Bestimmung bringt zwar gegenüber der entsprechenden Bestimmung der Weimarer Verfassung[24] eine Aufwertung des Völkerrechts, bewegt sich jedoch noch in traditionellen Bahnen. Einen neuen Ansatz enthält indes Art. 24 GG, der erstmals die Möglichkeit einräumt, „Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen zu übertragen“.
7
Allerdings hatte bereits die französische Verfassung von 1946 in ihrer Präambel einen ersten Schritt hin zur Öffnung und zur Bereitschaft zum Verzicht auf Souveränitätsrechte auf der Basis der Gegenseitigkeit getan. In der Präambel[25] heißt es: „Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la Paix“. Eine ähnliche Regelung wurde bald darauf in die italienische Verfassung von 1947 aufgenommen.[26] Beide Verfassunggeber hatten dabei auch die Gründung der Vereinten Nationen und die Schaffung möglicher weiterer Systeme kollektiver Sicherheit im Blick.
8
Die Gewährleistung eines dauerhaften Friedens, gleichsam in Weiterentwicklung des Leitmotivs des Westfälischen Friedens,[27] war Ziel aller Integrationsbestrebungen. Dies galt in besonderem Maße auch für die Beratungen zum Grundgesetz, wo bereits der Entwurf des Unterausschusses I des Verfassungskonvents auf Herrenchiemsee einen Integrationsartikel (Art. D) vorsah, der dem späteren Art. 24 des Grundgesetzes sehr nahe kam.[28]
| Art. D des ursprünglichen Entwurfs(August 1948): | Art. 24 des Grundgesetzes(endgültige Fassung vom 23. Mai 1949): |
|---|---|
| (1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen. | (1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen. |
| (2) Insbesondere kann er im Interesse der Aufrechterhaltung des Friedens sein Gebiet in ein System kollektiver Sicherheit einordnen und hierbei, unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit, in diejenigen Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, durch die eine friedliche und dauerhafte Ordnung der europäischen Verhältnisse erreicht und sichergestellt werden kann. | (2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern. |
| (3) Ein solches Gesetz bedarf in Bundesrat und Bundestag einer Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl. | (3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund Vereinbarungen über eine allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale Schiedsgerichtsbarkeit beitreten. |
9
Während Abs. 2 des Art. D (später Art. 24) mit der Möglichkeit einer reziproken Beschränkung von Hoheitsrechten die Vorbilder der französischen und der italienischen Verfassung aufgreift, geht Abs. 1 mit der Option einer Übertragung von Hoheitsrechten erheblich darüber hinaus und wird so zum nachdrücklichsten Bekenntnis zur „offenen Staatlichkeit“, wie die Integrationsbereitschaft später apostrophiert wurde. Mit der weitgehenden Öffnungsklausel sollte „nach den Dingen, die im Namen des deutschen Volkes geschehen sind“, eine „Vorleistung“ erbracht[29] werden, die, wie ein Redner formulierte, zugleich eine „sehr schöne Antwort“ sei „auf das, was die französische Republik in der Präambel ihrer neuen Verfassung sagt“.[30]
10
Wenngleich die Vorstellungen über die Gestalt des in der Präambel des Grundgesetzes angesprochenen „vereinten Europas“ eher diffus blieben,[31] wurden die bei Integrationsentscheidungen einzuhaltenden Verfahrensregeln eingehend diskutiert. Gegen Integrationsentscheidungen durch einfaches Gesetz wurde geltend gemacht, dass es dabei um eine besonders wichtige Frage gehe, so dass ein verfassungsänderndes Gesetz,[32] im Hinblick auf die betroffenen Länderinteressen jedenfalls aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundesrat[33] zu fordern sei. Dieser Forderung wurde entgegengehalten, dass damit der Integrationsklausel die „Pointe“ genommen würde, da eine Integration durch Verfassungsänderung immer möglich sei.[34] Die Entscheidung über die Integrationsbereitschaft solle eindeutig im Grundgesetz selbst getroffen werden.[35] Aus denselben Erwägungen wurden letztlich auch die im ursprünglichen Entwurfstext vorgesehene Anforderung einer Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl in Bundestag und Bundesrat sowie das Erfordernis einer Zustimmung des Bundesrats verworfen.
3. Grundsätzliche verfassungsrechtsdogmatische Einordnung der Integrationsklausel des Art. 24 Abs. 1 GG
11
Die Integrationsklausel des Art. 24 Abs. 1 GG war bald, insbesondere nach den ersten Schritten der europäischen Einigung, Gegenstand verfassungsrechtsdogmatischer Erörterungen und Einordnungen. Rasch setzte sich die Einsicht durch, dass die „Übertragung“ von Hoheitsrechten nicht so verstanden werden kann, dass der zwischenstaatlichen Einrichtung jeweils ein Ausschnitt aus der nationalen Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten übertragen wird, sondern dass durch die „Übertragung“ auf der Grundlage eines völkerrechtlichen Vertrags eine einheitliche Hoheitsgewalt neuer Qualität geschaffen wird, für die die Vertragsstaaten ihre innerstaatliche Kompetenzsphäre, ihren „Souveränitätspanzer“[36], öffnen.[37] In diesem Sinne wird die Befugnis der zwischenstaatlichen Einrichtung, durch Rechtsakte die staatlichen Organe und die Bürger unmittelbar zu verpflichten, der sog. „Durchgriffseffekt“, als entscheidendes Merkmal für die Anwendung des Art. 24 Abs. 1 GG angesehen.[38]
12
Die Öffnung der innerstaatlichen Kompetenzsphäre, die Permeabilität des Staates, hat Klaus Vogel prägend als „offene Staatlichkeit“ charakterisiert.[39] Bezogen auf die dadurch eröffnete Möglichkeit der Einordnung Deutschlands in eine supranationale Gemeinschaft, deren Recht Vorrang gegenüber dem nationalen Recht beansprucht, sprach Hans Peter Ipsen von Art. 24 Abs. 1 GG als „Integrationshebel“.[40] Das spanische Verfassungsgericht sollte später im Hinblick auf die vergleichbare Bestimmung des Art. 93 der spanischen Verfassung von 1978 von einem „Scharnier“ (bisagra) sprechen.[41] Bewusst war den meisten Autoren von Anfang an, dass mit jeder Übertragung von Hoheitsrechten eine materielle Verfassungsänderung einhergeht.[42] Art. 24 Abs. 1 GG wird in diesem Sinne nicht nur eine auch die Kompetenzsphäre der Länder einbeziehende Integrationskompetenz des Bundes entnommen, sondern auch eine Sonderregelung im Verhältnis zu Art. 79 GG, der für eine Grundgesetzänderung eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat vorsieht. Indem Art. 24 Abs. 1 GG regelt, dass nur ein einfaches Bundesgesetz erforderlich ist, trifft er hingegen keine Bestimmung darüber, ob im konkreten Fall die Zustimmung des Bundesrates erforderlich ist oder ob es sich um ein Einspruchsgesetz handelt. Diese Frage richtet sich, soweit es nicht um die Hoheitsübertragung als solche geht, nach Art. 59 Abs. 2 GG, also danach, ob sich der Integrationsvertrag auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht, die eine Zustimmungspflicht auslösen oder nicht. Die bloße Tatsache, dass ein Integrationsvertrag Hoheitsrechte der Länder berührt, hat eine Zustimmungsbedürftigkeit nicht zur Folge.[43]
13
Daraus, dass Art. 24 Abs. 1 GG dem Bund die Möglichkeit eröffnet, Hoheitsrechte zu übertragen, folgt nicht die Verpflichtung, dies bei jeder Gelegenheit zu tun. Allerdings hat man unter Berücksichtigung des Zusammenhangs mit den Vorschriften der Art. 24 bis 26 GG den „Willen“ des Grundgesetzes zu erkennen gemeint, „den Bund und seine Organe zu einer aktiven Politik und Gesetzgebung in der Richtung auf solch eine ‚offene‘ Staatlichkeit zu verpflichten“.[44] Demgegenüber wurde zu Recht zur Zurückhaltung gemahnt.[45] Jedenfalls kann aus der Ermächtigung des Art. 24 Abs. 1 GG nicht eine Staatszielbestimmung abgeleitet werden, die einen rechtlichen Maßstab für Integrationsentscheidungen liefert. Hingegen sind der Präambel des Grundgesetzes das Friedensziel sowie das Ziel eines vereinten Europas zu entnehmen. Zutreffend ist, dass die Vorschriften der Art. 24 bis 26 GG eine effektive Verfolgung dieser Ziele ermöglichen sollen.[46]
Erster Teil Offene Staatlichkeit › § 14 Offene Staatlichkeit: Deutschland › II. Offene Staatlichkeit und europäische Integration
II. Offene Staatlichkeit und europäische Integration
1. Die offene Staatlichkeit in der Bewährung
14
Mit den Öffnungsklauseln des Grundgesetzes waren verfassungsrechtlich die Voraussetzungen geschaffen, die Bundesrepublik in eine intensive internationale Zusammenarbeit bis hin zur Integration in supranationale Gemeinschaften zu führen. Das Grundgesetz musste nun mit Leben erfüllt werden. Mit der fortschreitenden europäischen Integration, deren Einwirkung auf das nationale Recht immer tiefere Spuren hinterließ, wurden zunehmend die Grenzen der Integrationsfreundlichkeit des Grundgesetzes ausgelotet, bis schließlich im Wege einer Grundgesetzänderung ausdrückliche Integrationsdirektiven verankert wurden.
a) Europapolitische Weichenstellungen
15
Die Europapolitik war seit der 1. Legislaturperiode ein zentrales Element der politischen Debatte. Die Bundesrepublik hatte zwar an der Gründung des Europarats, dessen Satzung bereits am 5. Mai 1949 unterzeichnet wurde, noch nicht mitwirken können,[47] doch war sie an Verhandlungen über die Gründung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) auf der Grundlage des Schuman-Plans[48] von Anfang an maßgeblich beteiligt.[49] Dabei traten innerhalb der politischen Kräfte der Bundesrepublik die unterschiedlichen europapolitischen Vorstellungen zu Tage. Während die CDU, insbesondere in der Person von Konrad Adenauer, der Westintegration der Bundesrepublik Vorrang einräumte, vertrat die SPD mit ihrem Vorsitzenden Kurt Schumacher das Ziel, Europa auf breiter Basis als dritte Kraft zwischen den USA und der Sowjetunion zu etablieren und so die Wiedervereinigung Deutschlands zu erreichen. In der EGKS erblickten sie eine rein westeuropäische Lösung, die die Spaltung Deutschlands vertiefen würde.[50] Carlo Schmid, der den Schuman-Plan zunächst begrüßt hatte, bemängelte, dass das Vereinigte Königreich, dessen Regierung seinerzeit von der Labour-Partei gestellt wurde, und die skandinavischen Staaten der Gemeinschaft nicht angehören würden.[51]
16
Das Vertragsgesetz über die Mitwirkung der Bundesrepublik an der EGKS, das noch vor Unterzeichnung des Vertrags mit den drei Westmächten über die Aufhebung des Besatzungsregimes (Deutschlandvertrag)[52] im Bundestag beraten wurde, konnte im Ergebnis auch gegen die Stimmen der SPD beschlossen werden,[53] da Art. 24 Abs. 1 GG lediglich ein einfaches Gesetz fordert, mithin eine verfassungsändernde Mehrheit nicht erforderlich war. Mit Beginn des Funktionierens der EGKS beendete die im Jahre 1949 von den Westalliierten und den Beneluxstaaten errichtete Internationale Ruhrbehörde, deren Errichtung im Parlamentarischen Rat gerade bei den „Europäern“ aller Parteien auf heftige Kritik gestoßen war,[54] ihre Arbeit.[55]
17
Die parteipolitischen Auseinandersetzungen über die Europapolitik hielten an, so etwa auch bei der Debatte über die (letztlich gescheiterte) Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Ein breiterer Konsens konnte erst bei der Entscheidung über die Römischen Verträge erreicht werden: Für den Vertrag über die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und den Vertrag über die Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG),[56] die am 25. März 1957 unterzeichnet wurden, stimmte schließlich auch die Mehrheit der SPD-Abgeordneten. Vorbehalte hatte es zunächst ebenso in der CDU gegeben, so namentlich bei Ludwig Erhard, der eine Beeinträchtigung der Marktwirtschaft und des Freihandels (im Verhältnis zu Drittstaaten) durch Dirigismus und Abschottung der Gemeinschaft befürchtete.[57] Der Einfluss Jean Monnets, der mit seinem „Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Europa“ einen informellen, parteiübergreifendenden Diskussionskreis maßgeblicher europäischer Politiker über Ziele und Wege der europäischen Integration etabliert hatte,[58] spielte für die Erlangung dieses weit reichenden Konsenses eine wichtige Rolle.[59]
b) Das Verhältnis zwischen deutschem Verfassungsrecht und europäischem Gemeinschaftsrecht
18
War die Frage nach einem möglichen Spannungsverhältnis zwischen den in der Verfassung verankerten Zielen einer europäischen Integration einerseits und der deutschen Wiedervereinigung andererseits sowie nach den daraus gegebenenfalls zu ziehenden Konsequenzen in erster Linie politisch zu beantworten, so war das bald zu Tage tretende Problem eines möglichen Konflikts zwischen dem Europäischen Gemeinschaftsrecht und tragenden Bestimmungen des deutschen Verfassungsrechts Gegenstand gerichtlicher, insbesondere verfassungsgerichtlicher Entscheidungen sowie rechtswissenschaftlicher Auseinandersetzungen. Drei Konfliktlinien des Gemeinschaftsrechts standen im Vordergrund: erstens ein möglicher Konflikt mit dem Rechtsstaatsprinzip, insbesondere den Grundrechten (aa), zweitens ein Konflikt mit dem Demokratieprinzip (bb) und drittens ein Konflikt mit dem Bundesstaatsprinzip (cc).
aa) Grundrechte
19
In seinem Urteil Costa/ENEL vom 15. Juli 1964 hatte der EuGH festgestellt, dass der Vorrang des Gemeinschaftsrechts vorbehaltlos gilt, so dass dem supranationalen Recht „keine wie immer gearteten innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgehen können“.[60] Darin lag zugleich eine Aufforderung an die nationalen Verfassungsgerichte, sich einer Kontrolle des sekundären Gemeinschaftsrechts am Maßstab des nationalen Verfassungsrechts, insbesondere der Grundrechte, zu enthalten. Dies stieß insbesondere in Italien und Deutschland auf Sensibilitäten, da die nach dem Krieg angenommenen Verfassungen beider Länder den Grundrechten und ihrem einfachgerichtlichen und verfassungsgerichtlichen Schutz besonderen Stellenwert einräumen. Nachdem zunächst die Corte costituzionale in ihrer Frontini-Entscheidung vom 27. Dezember 1973 einen äußersten Vorbehalt zugunsten des Schutzes der fundamentalen Verfassungsprinzipien sowie der Grundrechte formuliert hatte,[61] behielt sich das Bundesverfassungsgericht in seinem sog. Solange I-Beschluss vom 29. Mai 1974 eine weiter gehende Kontrolle des innerstaatlich anwendbaren Gemeinschaftsrechts hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit den im Grundgesetz verankerten Grundrechten vor. Zwar hatte das Gericht in einer Entscheidung aus dem Jahre 1967 das Europäische Gemeinschaftsrecht in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des EuGH als eine „autonome Rechtsquelle“ anerkannt und daher Verfassungsbeschwerden gegen Akte der Gemeinschaft für unzulässig erklärt,[62] doch betonte es nunmehr, dass Art. 24 Abs. 1 GG nicht den Weg eröffne, „die Grundstruktur der Verfassung, auf der ihre Identität beruht, ohne Verfassungsänderung, nämlich durch die Gesetzgebung der zwischenstaatlichen Einrichtung zu ändern“.[63] Ein „unaufgebbares, zur Verfassungsstruktur des Grundgesetzes gehörendes Essentiale“ sei der Grundrechtsteil des Grundgesetzes.[64] Solange sowohl ein unmittelbar demokratisch legitimiertes Parlament fehle, dem gegenüber die rechtsetzenden Gemeinschaftsorgane verantwortlich seien, als auch ein Grundrechtskatalog, der die Gewissheit gebe, dass ein dem Grundgesetz vergleichbarer Grundrechtsstandard gewährleistet ist, werde es seine Kontrolle ausüben, wobei es nicht über die Gültigkeit der Rechtsakte der Gemeinschaft, sondern nur über die innerstaatliche Anwendbarkeit entscheide. Drei der acht Richter des Zweiten Senats formulierten gegen diese Entscheidung ein Sondervotum, in dem sie zum einen die Unvereinbarkeit einer solchen Kontrolle mit Art. 24 Abs. 1 GG ins Feld führten, zum anderen auf die im Grundsatz auch von der Senatsmehrheit anerkannte grundrechtsfreundliche Rechtsprechung des EuGH näher eingingen. Nicht zuletzt im Hinblick auf den sich abzeichnenden Widerstand in den Mitgliedstaaten hatte der EuGH gerade in dieser Zeit die Grundlagen für eine dynamische Grundrechtsrechtsprechung gelegt, indem er Grundrechtsverbürgungen des Gemeinschaftsrechts aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten sowie den Garantien der seit 1974 von allen Mitgliedstaaten ratifizierten EMRK herleitete.[65]
20
Die Linie des Solange I-Beschlusses war nicht zu halten, wollte das Gericht nicht die Wirksamkeit der Gemeinschaftsrechtsordnung in den Mitgliedstaaten generell in Frage stellen. Die teilweise heftige Kritik der Entscheidung in der wissenschaftlichen Literatur[66] sowie die weitere Entwicklung blieb auf die deutschen Verfassungsrichter nicht ohne Eindruck. Bereits in seinem so genannten „Vielleicht-Beschluss“ vom 25. Juli 1979 betonte das Gericht die Notwendigkeit „einer möglichst einheitlichen Auslegung und Anwendung des Gemeinschaftsrechts durch alle Gerichte im Geltungsbereich des EWG-Vertrages“ im Interesse „der Rechtssicherheit und der Rechtsanwendungsgleichheit“ und ließ es offen, „ob und gegebenenfalls inwieweit – etwa angesichts mittlerweile eingetretener politischer und rechtlicher Entwicklungen im europäischen Bereich – für künftige Vorlagen von Normen des abgeleiteten Gemeinschaftsrechts“ der Kontrollanspruch aufrechterhalten werde.[67] Der entscheidende Schritt zu einer weitgehenden Rücknahme des Kontrollanspruchs wurde mit dem so genannten Solange II-Beschluss vom 22. Oktober 1986 vollzogen, in dem der Zweite Senat des Gerichts ausführlich darlegte, dass die Entwicklung des Gemeinschaftsrechts, insbesondere die von ihm im Einzelnen nachgezeichnete Rechtsprechung des EuGH, mittlerweile einen dem deutschen Recht vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleiste. Wörtlich heißt es:[68] „Solange die Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Gemeinschaften, einen wirksamen Schutz der Grundrechte gegenüber der Hoheitsgewalt der Gemeinschaften generell gewährleisten, der dem vom Grundgesetz als unabdingbar gebotenen Grundrechtsschutz im wesentlichen gleichzuachten ist, zumal den Wesensgehalt der Grundrechte generell verbürgt, wird das Bundesverfassungsgericht seine Gerichtsbarkeit über die Anwendbarkeit von abgeleitetem Gemeinschaftsrecht, das als Rechtsgrundlage für ein Verhalten deutscher Gerichte und Behörden im Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch genommen wird, nicht mehr ausüben und dieses Recht mithin nicht mehr am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes überprüfen“. Damit hatte das Bundesverfassungsgericht einen auch für die Europäische Gemeinschaft akzeptablen modus vivendi gefunden, ohne den nationalen Verfassungsvorbehalt vollständig aufzugeben.
21
Eine Rückkehr zu einer aktiveren Kontrolle des Gemeinschaftsrechts schien sich mit dem Maastricht-Urteil vom 12. Oktober 1993 anzudeuten. Der Zweite Senat sprach selbstbewusst von einem „Kooperationsverhältnis“ zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem EuGH[69] und betonte besonders die Abhängigkeit der Geltung und Anwendung des Gemeinschaftsrechts in Deutschland von dem im Zustimmungsgesetz enthaltenen Rechtsanwendungsbefehl.[70] Nicht mehr vom Zustimmungsgesetz gedeckte Änderungen des „Integrationsprogramms“ und daraus hervorgehende „ausbrechende“ Rechtsakte seien im deutschen Hoheitsbereich nicht verbindlich, was der Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht unterliege.[71] Deutschland bleibe einer der „Herren der Verträge“.
22
Mit der Doktrin der „ausbrechenden Rechtsakte“ wird implizit die Letztentscheidungsbefugnis des EuGH für die Auslegung des Primärrechts bestritten. Mit dessen übergreifendem Rechtsprechungsauftrag (Art. 220, 230 EG) ist das nicht in Übereinstimmung zu bringen.[72] Offensichtlich wollte das Bundesverfassungsgericht einen „Warnschuss“ gegen allfälliges ultra vires-Handeln des EuGH selbst abgeben, dessen dynamische Rechtsfortbildung auch in anderen Mitgliedstaaten auf Vorbehalte stößt.[73] Die paradoxe Frage des „Quis custodiet custodes?“, d.h. in der Konsequenz, welches der beiden Rechtsprechungsorgane tatsächlich ultra vires handeln würde, wäre im Übrigen selbst im Falle einer ausnahmsweise zulässigen Kontrolle nicht aufzulösen, da das Vorliegen der Ausnahme streitig bliebe. In seinem „Bananenmarkt“-Beschluss vom 7. Juni 2000 stellte der Zweite Senat klar, dass das Maastricht-Urteil an der „Solange II-Rechtsprechung“ nichts geändert habe und daher Verfassungsbeschwerden und Richtervorlagen wegen einer möglichen Verletzung von Grundrechten durch sekundäres Gemeinschaftsrecht nur zulässig seien, wenn im Einzelnen dargelegt werde, „dass der jeweils als unabdingbar gebotene Grundrechtsschutz generell nicht gewährleistet“, d.h. „die europäische Rechtsentwicklung einschließlich der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nach Ergehen der Solange II-Entscheidung [...] unter den erforderlichen Grundrechtsstandard abgesunken“ sei.[74]