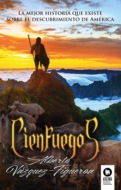Kitabı oku: «Tuareg», sayfa 3
Schon vor dem Morgengrauen kam Wind auf. Jeder neue Tag wurde von diesem Wind angekündigt. Sein nächtliches Heulen verwandelte sich in bitteres Klagen, bevor eine Stunde später jenseits der felsigen Hänge des Huaila-Gebirges der erste Lichtstrahl den Himmel erhellte.
Gacel lauschte mit offenen Augen. Er betrachtete das Dach seiner khaima mit den altvertrauten Stützpfosten. Im Geist sah er kugelige Dornenbüsche, die vom Wind über Sand und Geröll getrieben wurden, immer unterwegs, immer auf der Suche nach einem Ort, an dem sie sich festkrallen könnten, nach einer endgültigen Heimat, in der sie zur Ruhe kommen könnten und vom ewigen Herumirren quer durch Afrika erlöst wären. Im milchigen Licht des frühen Morgens, das von unzähligen winzigen, in der Luft schwebenden Staubpartikeln gefiltert wurde, tauchten diese Büsche wie Geister aus dem Nichts auf, stürzten sich auf Menschen und Tiere, um sich ebenso schnell, wie sie gekommen waren, in der unendlichen, grenzenlosen Leere wieder zu verlieren.
»Irgendwo muß es eine Grenze geben, das weiß ich genau«, hatte der junge Mann voller Angst und Verzweiflung gesagt. Und jetzt war er tot! Noch nie zuvor hatte jemand zu Gacel von Grenzen gesprochen, denn Grenzen hatte es in der Sahara nie gegeben.
»Welche Grenze könnte auch den Sand und den Wind aufhalten?« dachte er.
Er wandte sein Gesicht wieder der Nacht zu und versuchte zu verstehen, aber es gelang ihm nicht. Jene Männer waren bestimmt keine Verbrecher gewesen, doch einen von ihnen hatte man umgebracht und den anderen wer weiß wohin verschleppt. Kein Mensch durfte so kaltblütig ermordet werden, mochte er auch noch soviel Schuld auf sich geladen haben. Vor allem durfte dies nicht geschehen, während er unter dem schützenden Dach eines amahar schlief.
Mit dieser Angelegenheit mußte es eine seltsame Bewandtnis haben, aber Gacel kam nicht dahinter. Nur eines war klar: Das älteste Gesetz der Wüste war gebrochen worden. Und das konnte kein amahar hinnehmen.
Die alte Khaltoum kam Gacel in den Sinn, und er spürte, wie sich die Furcht gleich einer kalten Hand um sein Herz legte. Er beugte sich über Laila und blickte in ihre glänzenden, wachen Augen, in denen sich der Schein des ersterbenden Feuers spiegelte. Sie tat ihm leid, denn sie war kaum fünfzehn Jahre alt. Ihre Nächte würden leer sein ohne ihn. Auch sich selbst bedauerte er. Denn auch seine Nächte würden leer sein, wenn sie nicht mehr an seiner Seite ruhte.
Er strich ihr übers Haar und spürte, wie sie ihm diese Geste dankte, denn sie öffnete ihre großen, scheuen Gazellenaugen noch weiter.
»Wann wirst du zurückkommen?« flüsterte sie, und es war mehr ein Flehen als
eine Frage.
»Ich weiß es nicht«, antwortete er kopfschüttelnd. »Sobald ich die Gerechtigkeit
wieder hergestellt habe.«
»Was bedeuten denn die beiden Männer für dich?«
»Nichts«, gestand er ein. »Nichts - bis gestern. Aber es geht eigentlich nicht um
sie. Es geht um mich, doch das verstehst du wohl nicht.«
Laila verstand genau, aber sie sagte nichts. Sie drückte sich noch enger an ihn, als erhoffte sie von ihm Kraft oder Wärme. In einem letzten Versuch, ihn zurückzuhalten, streckte sie die Arme nach ihm aus, aber er erhob sich und trat ins Freie.
Draußen sang der Wind noch immer sein sanftes Klagelied. Es war kalt. Gacel hüllte sich enger in seine gandura. Unwillkürlich erschauerte er, und er wußte nicht, ob es die Kälte war oder die furchtbare Leere der Nacht, die vor ihm lag, wie ein Meer von schwarzer Tinte, das ihn verschlingen wollte. Doch da tauchte Suilem mit R’Orab aus der Finsternis auf und reichte ihm die Zügel.
»Ich wünsche dir Glück, Herr«, sagte er und verschwand, als hätte ihn der Erdboden verschluckt.
Gacel zwang das Kamel in die Knie, kletterte auf seinen Rücken und gab ihm mit dem Hacken einen leichten Stoß gegen den Hals.
»Schiaaaa!« rief er. »Vorwärts!«
Das Kamel brüllte übellaunig, kam schwerfällig hoch und blieb völlig reglos auf seinen vier Beinen stehen, den Kopf in den Wind gereckt, als wartete es auf etwas.
Der Targi richtete das Tier nach Nordosten und gab ihm mit dem Hacken einen stärkeren Stoß als zuvor, damit es sich in Bewegung setzte.
Im Eingang von Gacels khaima zeichnete sich eine schattenhafte Gestalt ab. Lailas Augen funkelten in der Nacht. Gleich darauf waren Reiter und Kamel verschwunden, als hätte der Wind sie wie einen Dornenbusch mit sich fortgetragen.
Noch ließ das fahle Licht des Morgengrauens auf sich warten, und Gacel mußte seine Augen anstrengen, um den Kopf seines Kamels zu erkennen, aber er brauchte nicht mehr Helligkeit. Er wußte, daß es im Umkreis von mehreren hundert Kilometern kein Hindernis gab. Der Instinkt des Wüstenbewohners und die Fähigkeit, sich mit geschlossenen Augen zu orientieren, wiesen ihm sogar in der finstersten Nacht den Weg.
Dies war eine Fertigkeit, die nur Männer wie er besaßen, Männer, die in der Sahara geboren und aufgewachsen waren. Ähnlich wie eine Brieftaube, ein Zugvogel oder ein Walfisch in den Tiefen des Ozeans wußte ein Targi stets, wo er sich befand und wohin er unterwegs war. Norden, Süden, Osten und Westen: Wasserstellen, Oasen, Sandpisten, Berge, »Leeres Land«, Dünentäler, steinige Ebenen ... Die weite Sahara mit ihrer ganzen Vielfalt spiegelte sich in den Tiefen von Gacels Gehirn, erzeugte eine Art Widerhall, aber er wurde sich dessen nie ganz bewußt.
Als die Sonne aufging, saß er noch immer auf seinem Mehari. Die Sonne stieg höher, bis sie über seinem Kopf stand. Ihre Kraft nahm rasch zu. Sie ließ den Wind verstummen, und ihr Licht prallte auf die Erde. Der treibende Sand kam zur Ruhe, die Dornenbüsche rollten nicht mehr hin und her. Eidechsen krochen aus ihren Höhlen. Die Vögel blieben unten am Boden. Sie wagten nicht mehr, sich in die Luft zu schwingen, als die Sonne den Zenit erreichte.
Der Targi brachte sein Kamel zum Stehen und ließ es niederknien. Dann pflanzte er sein langes Schwert und sein altes Gewehr in den Sand, um zwischen ihnen und dem Sattelhorn eine kleine Zeltplane aus grobem Tuch aufzuspannen.
Er flüchtete sich in den Schatten, lehnte den Kopf gegen die Flanke des weißen Kamels und war gleich darauf eingeschlafen.
Ein Geruch, der in der Wüste von allen Menschen am sehnlichsten herbeigewünscht wird, weckte Gacel und ließ seine Nasenflügel erbeben. Er schlug die Augen auf, rührte sich aber nicht. Er atmete tief und traute sich kaum, zum Himmel aufzublicken, denn er fürchtete, daß alles nur ein Traum war. Als er schließlich den Kopf nach Westen wandte, erblickte er weit hinten über dem Horizont eine große, dunkle, verheißungsvolle, lebenspendende Wolke. Sie war anders als jene weißen Wolken, die manchmal in großer Höhe von Norden her über den Himmel zogen und verschwanden, ohne die eitle Hoffnung auf ein bißchen Regen erfüllt zu haben.
Jene graue, tiefhängende, prachtvolle Wolke sah so aus, als enthielte sie das gesamte segensreiche Wasser der Welt. Sie war wahrscheinlich die schönste Wolke, die Gacel in den letzten fünfzehn Jahren gesehen hatte, die schönste seit dem großen Unwetter, das Lailas Geburt vorausgegangen war. Es hatte dazu geführt, daß die Großmutter dem Mädchen eine düstere Zukunft weissagte, denn der ersehnte Regen war so stark, daß er einen reißenden Strom bildete, der Zelte und Tiere mit sich fortriß, Nutzpflanzen vernichtete und eine Kamelstute ertrinken ließ.
R’Orab bewegte sich unruhig, verdrehte den langen Hals und richtete die bebenden Nüstern auf den Vorhang aus Wasser, der das Licht des Tages zerteilte und das Gesicht der Landschaft veränderte, während er rasch näher kam. Das Kamel brüllte leise, und dann drang aus seiner Kehle eine Art Schnurren, als wäre es eine riesige, zufriedene Katze. Gacel erhob sich langsam, nahm dem Tier Sattel und Zaumzeug ab und entledigte sich selbst seiner Kleidung, die er sorgsam über die dornigen Büsche breitete, damit sie möglichst viel Regen abbekamen. Barfuß und splitternackt wartete er darauf, daß die ersten Tropfen in den Sand fielen, bevor das Wasser wie ein reißender Bach herabstürzte und seine Sinne zuerst mit einem leisen Plätschern, dann mit einem donnernden Rauschen betörte. Er würde den Regen auf der Haut fühlen wie eine Liebkosung, im Mund die Frische und Reinheit des Wassers auskosten und den köstlichen Duft der feuchten Erde einatmen, während rings um ihn ein dichter Dunst vom Boden aufstiege. Da war sie endlich, die wunderbare, fruchtbringende Vereinigung von Himmel und Erde. Noch am selben Nachmittag würde die Sonne den schlafenden Samen der achab-Sträucher wecken, so daß die Pflanzen innerhalb kürzester Zeit die weite, ebene Fläche mit ihrem Grün überziehen und diese Gegend der Wüste verzaubern würden.
Allerdings wären sie schon nach ein paar Tagen wieder verblüht und würden abermals in einen langen Schlaf fallen, bis der nächste Regenschauer sie wiederum zum Leben erwecken würde. Doch vielleicht vergingen bis dahin erneut fünfzehn Jahre.
Wie schön er war, der wilde, ungebundene achab.In beackertem Boden, in der Nähe einer Wasserstelle oder unter der sorgsamen Pflege eines Bauern, der ihn tagtäglich bewässerte, wollte er nicht gedeihen. Er war wie der Geist der Tuareg: Ähnlich wie diese Menschen hatte der achab es fertiggebracht, die Jahrhunderte in der Stein- und Sandwüste zu überdauern, in einer Gegend, die von den meisten Menschen gemieden wurde.
Der Regen durchtränkte Gacels Haar und befreite seinen Körper von einer Schorfschicht aus Schweiß und Schmutz, die Monate, vielleicht sogar Jahre alt sein mochte. Er half mit den Fingernägeln nach, und dann suchte er sich einen flachen, porösen Stein, mit dem er seine Haut abscheuerte, bis sie immer heller wurde. Das Regenwasser, das an ihm herabrann, war fast indigoblau, denn die nicht sehr beständige Färbung seiner Kleidung hatte im Lauf der Zeit jeden Quadratzentimeter seines Körpers imprägniert.
Zwei lange Stunden stand Gacel so im Regen, fröstelnd, aber glücklich. Er mußte gegen die Versuchung ankämpfen, kehrtzumachen und nach Hause zu reiten, um den Regen zu nutzen. Er wollte Gerste pflanzen, die Ernte abwarten und sich im Kreis der Seinen jener wunderbaren Gabe erfreuen, die Allah ihm zu schicken geruht hatte. Vielleicht war der Regen ein Fingerzeig dafür, daß er daheimbleiben sollte, in seiner kleinen Welt. Vielleicht sollte er jene Beleidigung vergessen, von der ihn nicht einmal alles Wasser dieser dicken Regenwolke reinzuwaschen vermocht hätte. Aber Gacel war ein Targi, und sein eigenes Unglück wollte es, daß er wohl einer der letzten echten Tuareg des Flachlandes war. Nie würde er vergessen, daß man ihm einen Gast unter seinem eigenen Dach ermordet und einen zweiten mit Gewalt verschleppt hatte.
Sobald die Wolke nach Süden weitergewandert war und die Nachmittagssonne seinen Körper und seine Kleidung getrocknet hatte, zog er sich wieder an, sattelte das Kamel und setzte seinen Weg fort. Zum ersten Mal verschmähte er Wasser und Regen, Leben und Hoffnung. Er wandte sich von etwas ab, das sein eigenes Herz und das seiner Lieben noch vor zwei Tagen mit unbändiger Freude erfüllt hätte.
Bei Anbruch der Nacht suchte er sich eine kleine Düne, scharrte mit den Händen den noch feuchten Sand beiseite, bettete sich in die Kuhle und bedeckte sich fast gänzlich mit trockenem Sand, denn er wußte, wie kalt es kurz vor Tagesanbruch sein konnte. Dann würde der Wind die Wassertropfen, die noch auf den Steinen und dem dürren Gestrüpp glänzten, zu Rauhreif gefrieren lassen.
In der Wüste konnte die Differenz zwischen Mittagshitze und Morgenkälte kurz vor Sonnenaufgang bis zu fünfzig Grad betragen. Aus eigener Erfahrung wußte Gacel, daß jene Kälte dem unvorsichtigen Reisenden in die Knochen kriechen und ihn krankmachen konnte, so daß die schmerzenden Gelenke seines Körpers tagelang steif blieben und sich weigerten, den Befehlen des Willens unverzüglich Folge zu leisten.
Drei Jäger waren vor längerer Zeit in den Ausläufern des kargen Huaila-Gebirges erfroren aufgefunden worden. Gacel erinnerte sich noch an den Anblick ihrer Leichen. Die Männer hatten sich eng aneinandergekauert und waren so im Tode miteinander verschmolzen worden. Das hatte sich in jenem kalten Winter ereignet, als die Tuberkulose auch Gacels kleinen Sohn Bisrha hinweggerafft hatte. Die Gesichter der Toten schienen zu lächeln. Später, als die Sonne ihre Körper allmählich austrocknete, boten sie mit ihrer pergamentenen Haut und ihren gebleckten Zähnen einen makabren Anblick.
Dies war ein grausames Land, denn hier konnte ein Mann innerhalb weniger Stunden an Hitze, aber auch an Kälte sterben. Manch ein Kamel hatte schon tagelang vergeblich nach Wasser gesucht, um dann eines Morgens nach einem Unwetter in einem reißenden Strom zu ersaufen. Ja, dies war ein grausames Land, aber Gacel konnte es sich nicht vorstellen, in einem anderen zu leben. Es wäre ihm nie eingefallen, den Durst, die Hitze und die Kälte in dieser grenzenlosen Weite gegen die Bequemlichkeiten einer engen Welt ohne Horizont einzutauschen. Jeden Tag dankte er Allah, das Gesicht nach Osten gen Mekka gewandt, für die Gnade, daß er dort leben durfte, wo er lebte, und daß er ein Mann aus dem gesegneten »Volk des Schleiers« war.
Vor dem Einschlafen verlangte es ihn nach Laila, und beim Erwachen stellte er fest, daß sich der straffe Frauenkörper, den er im Traum an sich gedrückt hatte, in Sand verwandelt hatte - Sand, der ihm durch die Finger rieselte.
Der Wind klagte leise. Es war die Stunde des Jägers. Gacel blickte zu den Sternen auf. Sie verrieten ihm, wie lange es noch dauern würde, bis das Licht des Tages sie am Firmament erlöschen ließe. Er rief in die Finsternis hinaus, und sein Mehari, das kauend seinen Hunger an den von Tau benetzten, struppigen Büschen stillte, antwortete ihm leise. Gacel sattelte es und setzte ohne anzuhalten seinen Weg fort, bis er am frühen Nachmittag fünf dunkle Flecken entdeckte, die sich am Horizont über der mit Steinen bedeckten Ebene abhoben. Es war das kleine Zeltlager von Mubarrak-ben-Sad, dem amahar vom »Volk der Lanze«, der die Soldaten zu Gacels khaima geführt hatte.
Gacel verrichtete seine Gebete und setzte sich dann auf einen glatten Stein, um den Sonnenuntergang zu betrachten. Er hing düsteren Gedanken nach, denn er ahnte, daß die letzte friedliche Nacht seines Lebens vor ihm lag. Im Morgengrauen würde er die elgebira des Krieges, der Rache und des Hasses öffnen müssen. Kein Mensch vermochte jemals vorauszusagen, wieviel Tod und Gewalt sie enthielt.
Er versuchte, die Beweggründe zu verstehen, die Mubarrak dazu verleitet hatten, mit der heiligsten Tuareg-Tradition zu brechen, aber es gelang ihm nicht. Mubarrak war ein Führer durch die Wüste und ohne Zweifel ein guter, aber als Targi durfte er sich nur dazu hergeben, Karawanen zu führen, Wild aufzuspüren oder ein paar Franzosen auf einer ihrer seltsamen Expeditionen zu begleiten, wenn sie nach Spuren aus der Zeit seiner Vorfahren suchten...
Als Mubarrak-ben-Sad an jenem Morgen die Augen aufschlug, lief ihm ein kalter Schauer über den Rücken. Seit längerem schon überfiel ihn das Grauen im Schlaf, aber jetzt suchte es ihn sogar im wachen Zustand heim. Instinktiv wandte er sein Gesicht dem Eingang der seriba zu, als ahnte er, daß er dort den Menschen erblicken würde, vor dem er sich so sehr fürchtete. Und tatsächlich: Keine dreißig Schritte entfernt stand, auf den Knauf seiner langen, in die Erde gerammten takuba gestützt, Gacel Sayah, der edle amahar vom Kel-Tagelmust. Er war gekommen, um Rechenschaft zu fordern.
Mubarrak ergriff seinerseits sein Schwert und trat aufrecht, würdevoll und ohne Hast vor. Fünf Schritte von Gacel entfernt blieb er stehen.
»Assalamu aleikum!« grüßte er mit der von den Tuareg bevorzugten Formel. .
Er erhielt keine Antwort und hatte eigentlich auch keine erwartet. Auf die Frage:
»Warum hast du das getan?« hingegen war er innerlich vorbereitet.
»Der Oberst in der Garnison von Adoras hat mich gezwungen.«
»Niemand kann einen Targi zu etwas zwingen, das er nicht will...«
»Ich arbeite schon seit drei Jahren für sie. Ich stehe offiziell als Führer im Dienst
der Regierung und konnte mich nicht weigern.«
»Aber du hattest wie ich geschworen, nie für die Franzosen zu arbeiten!«
»Die Franzosen sind fort. Jetzt sind wir ein freies Land.«
Innerhalb von wenigen Tagen hatten Gacel zwei verschiedene Menschen dasselbe gesagt. Plötzlich erinnerte er sich, daß weder die Soldaten noch der Offizier die Uniformen der verhaßten Kolonialmacht getragen hatten. Unter ihnen war kein Europäer gewesen, und keiner hatte mit dem für die Franzosen typischen harten Akzent gesprochen. An ihrem Lastwagen hatte auch die sonst unvermeidliche blauweiß- rote Fahne gefehlt.
»Die Franzosen haben immer unsere Traditionen geachtet«, murmelte Gacel schließlich, als spräche er zu sich selbst. »Warum sollten sie jetzt nicht mehr respektiert werden, wo wir angeblich frei sind?«
Mubarrak zuckte mit den Achseln. »Die Zeiten ändern sich«, sagte er.
»Nicht für mich!« war die Antwort. »Erst wenn die Wüste eine einzige Oase geworden ist, erst wenn das Wasser in Strömen durch die seguias fließt und der Regen so reichlich auf unsere Köpfe fällt, wie wir es uns wünschen - erst dann werden sich die Sitten und Gebräuche der Tuareg ändern. Vorher nicht!«
Mubarrak wirkte äußerlich ruhig, als er fragte: »Soll das heißen, daß du gekommen bist, um mich zu töten?«
»Ja, deshalb bin ich hier.«
Mubarrak nickte schweigend. Er hatte verstanden. Mit einem langen Blick umfaßte er alles, was ihn umgab. Er betrachtete die noch feuchte Erde und die winzigen Knospen der achab, die zwischen Steinen und Geröll zum Licht strebten.
»Der Regen war schön«, sagte er schließlich.
»Sehr schön.«
»Bald wird die ganze Ebene blühen, aber einer von uns beiden wird es nicht mehr sehen.«
»Daran hättest du denken müssen, bevor du die Fremdlinge zu meinem Zeltlager führtest.«
Unter dem Schleier verzogen sich Mubarraks Lippen zu einem kleinen Lächeln.
»Da hatte es noch nicht geregnet«, erwiderte er. Dann griff er nach seiner takuba und zog den geschmiedeten Stahl ganz langsam aus der Lederscheide. »Ich hoffe von ganzem Herzen, daß dein Tod keinen Krieg zwischen unseren Stämmen auslöst«, fuhr er fort.« Niemand außer uns selbst soll für unsere Fehler bezahlen.«
»So sei es!« bestätigte Gacel. Er beugte sich vor und wartete auf den Angriff des anderen.
Der ließ jedoch auf sich warten, denn sowohl Mubarrak als auch Gacel waren keine Krieger mehr, die mit Schwert und Lanze fochten, sondern Männer, die sich an Feuerwaffen gewöhnt hatten. Im Lauf der Zeit waren die langen takubas zur reinen Zierde verkümmert. Sie wurden nur noch bei Feiern, an Festtagen und anläßlich von unblutigen Schaukämpfen eingesetzt. Bei solchen Kämpfen ging es mehr um den äußeren Effekt als um die Absicht, den Gegner zu verwunden: Die Schwerthiebe prallten von ledernen Schutzschilden ab wurden geschickt pariert.
Doch jetzt gab es keine Schilde und auch keine Zuschauer, die die Zweikämpfer bewunderten, welche aufeinander einschlugen, daß die Funken sprühten, zugleich jedoch darauf bedacht waren, sich gegenseitig nicht zu verletzen. Nein, diesmal standen sich zwei Feinde mit der Waffe in der Hand gegenüber, und jeder der beiden war entschlossen, den anderen zu töten, um nicht selbst getötet zu werden.
Wie konnte ein Schlag ohne Schild pariert werden? Wie konnte man aufeinander losgehen oder einen Sprung rückwärts machen, ohne sich eine Blöße zu geben, wenn der Gegner einem keine Zeit ließ, auf die eigene Deckung zu achten?
Die beiden Tuareg blickten sich in die Augen, jeder versuchte, die Absicht des anderen zu erraten. Langsam und vorsichtig umkreisten sie sich, während aus den khaimas Männer, Frauen und Kinder traten, um ihnen sprachlos vor Staunen zuzusehen. Es wollte ihnen nicht in den Kopf, daß es sich hier nicht um ein spielerisches Duell, sondern um einen Kampf auf Leben und Tod handelte.
Schließlich wagte Mubarrak den ersten Ausfall, der eher wie eine schüchterne Frage wirkte, als wollte er herausfinden, ob es bei diesem Zweikampf wirklich um Sein oder Nichtsein ging.
Die Erwiderung - sie zwang ihn, einen Satz rückwärts zu machen, um der wütenden Klinge seines Gegners um Haaresbreite zu entgehen - ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Gacel Sayah, amahar des gefürchteten Volkes vom Kel- Tagelmust, trachtete ihm nach dem Leben, daran war nicht zu zweifeln. In dem beidhändig geführten Schlag, den er soeben ausgeteilt hatte, hatte soviel Rachsucht und Haß gelegen, als wären jene beiden Unbekannten, denen er vor nicht allzulanger Zeit Schutz gewährt hatte, seine Lieblingssöhne gewesen und als hätte Mubar-rak-ben-Sad die beiden eigenhändig ermordet.
Gacel empfand jedoch keinen echten Haß. Er war nur darauf aus, die Gerechtigkeit wiederherzustellen, und es wäre ihm nicht edelmütig erschienen, einen anderen Targi zu hassen, nur weil er seine Arbeit verrichtet hatte, mochte diese Arbeit auch falsch und verächtlich sein. Außerdem wußte Gacel, daß Haß genau wie Angst, Unbesonnenheit, Liebe oder jedes andere tief empfundene Gefühl ein schlechter Begleiter für einen Mann der Wüste war. Um in diesem Land, das das Schicksal ihm zur Heimat bestimmt hatte, zu überleben, bedurfte es großer Ruhe und Gelassenheit. Hier brauchte man Kaltblütigkeit und Selbstbeherrschung. Diese Eigenschaften mußten stets stärker sein als jedes Gefühl, das einen Mann dazu verleiten konnte, Fehler zu machen, denn die meisten Fehler waren nicht wieder gutzumachen.
Gacel fühlte sich in diesem Augenblick als Richter, vielleicht auch als Scharfrichter, aber weder der eine noch der andere hatte Veranlassung, sein Opferzu hassen. Die Wucht des doppelhändigen Schwerthiebes und der Ingrimm, mit dem er geführt worden war, stellten in Wirklichkeit nur eine Warnung dar. Er war eine klare Antwort auf eine unzweideutige Frage des Gegners gewesen. Wieder griff Gacel an, und dabei wurde ihm schlagartig bewußt, wie unangemessen sein langes Gewand, der voluminöse Turban und der breite Schleier für einen solchen Kampf waren. Die gandura wickelte sich um Arme und Beine, die nails mit ihrer dicken Sohle und den dünnen Riemen aus Antilopenleder rutschten auf dem von scharfkantigen Steinen übersäten Boden, und der litham hinderte ihn daran, die Lage deutlich zu überblicken und seine Lungen mit soviel Sauerstoff zu füllen, wie er ihn gerade jetzt benötigte.
Mubarrak war jedoch genauso gekleidet, und folglich bewegte er sich ebenso unsicher.
Die stählernen Klingen teilten die Luft, ihr böses Zischen erfüllte die Stille des Morgens. Eine zahnlose Alte schrie entsetzt auf und flehte die Umstehenden an, jemand möge doch diesen räudigen Schakal umbringen, der im Begriff sei, ihren Sohn zu ermorden.
Mubarrak hob mit einer gebieterischen Geste den Arm. Niemand rührte sich. Der Ehrbegriff der »Söhne des Windes«, der sich so sehr von dem der Beduinen unterschied -diese waren »Söhne der Wolken« und lebten in einer Welt aus Niedrigkeit und Verrat -, dieser Ehrbegriff forderte, daß ein Kampf zwischen zwei Kriegern mit Würde und Edelmut ausgetragen wurde, mochte er auch für einen der beiden den Tod bringen.
Gacel war auf unverzeihliche Weise beleidigt worden. Deshalb mußte er den Beleidiger töten. Er vergewisserte sich, daß er einen festen Stand hatte, holte tief Luft, stieß einen Schrei aus und stürzte vor. Seine Waffe zielte auf die Brust des Gegners, doch dieser schlug sie mit einem harten, trockenen Schlag seines eigenen Schwertes beiseite.
Wieder standen sie sich reglos gegenüber und blickten sich an. Dann hob Gacel seine takuba hoch über den Kopf, als wäre sie ein großer Hammer. Mit beiden Händen führte er den Schlag von oben nach unten und drehte sich dabei einmal um die eigene Achse. Jeder Anfänger in der Kunst des Fechtens hätte diese Unvorsichtigkeit ausgenutzt, um ihn mit einem gerade geführten Stoß zu erledigen, doch Mubarrak begnügte sich damit, rasch auszuweichen und abzuwarten. Er verließ sich mehr auf seine Kraft als auf seine Geschicklichkeit. Er packte seine Waffe mit beiden Händen und führte einen seitlichen Schlag, der so wuchtig war, daß er die Taille eines stärkeren Mannes als Gacel durchtrennt hätte, doch Gacel stand nicht mehr an der Stelle, an der er soeben noch gestanden hatte. Schon brannte die Sonne heiß vom Himmel herab. Die beiden Kämpfer waren schweißüberströmt, ihre feuchten Hände umschlossen mit unsicherem Griff die metallenen Knäufe der Schwerter, die sie erneut gegeneinander erhoben. Sie betrachteten sich abschätzend, und dann gingen sie wie auf Kommando aufeinander los. Im letzten Augenblick wich Gacel jedoch zurück. Es kümmerte ihn nicht, daß die Spitze von Mubarraks Waffe den Stoff seiner gandura durchtrennte und die Haut seiner Brust ritzte. Blitzschnell stach er zu und durchbohrte den Bauch seines Gegners, so daß das Schwert am Rücken herausragte.
Mubarrak hielt sich noch einige Augenblicke lang auf den Beinen, aber es waren Gacels Schwert und dessen stützender Arm, die ihn am Fallen hinderten. Als Gacel die Waffe herauszog und dabei das Gedärm des Gegners zerfetzte, brach jener zusammen und blieb zusammengekrümmt im Sand liegen. Schweigend, ohne ein Wort der Klage wollte er das langsame Sterben erdulden, das ihm vom Schicksal zugedacht war.
Wenige Augenblicke später, als der Rächer ohne ein Gefühl des Stolzes und des Glücks zu seinem wartenden Kamel schritt, ging die zahnlose Alte in die größte der khaimas, packte ein Gewehr, lud es und ging zu der Stelle zurück, wo sich ihr Sohn lautlos im Staub krümmte. Die Alte zielte auf seinen Kopf.
Mubarrak öffnete die Augen, und die alte Frau las in seinem Blick die grenzenlose Dankbarkeit eines Mannes, der wußte, daß sie gekommen war, um ihn vor langen Stunden hoffnungslosen Leidens zu bewahren.
Gacel hörte den Knall des Schusses im selben Augenblick, als sich sein Kamel in Bewegung setzte. Er blickte sich nicht um..