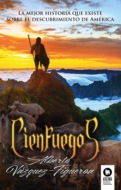Kitabı oku: «Tuareg», sayfa 4
Es war, als hätte er die Antilopenherde schon von weitem gespürt, lange bevor er sie sah. Plötzlich wurde er sich seines Hungers bewußt. Die beiden letzten Tage hatte er sich von ein paar Handvoll Hirsemehl und Datteln ernährt, während er sorgenvoll der Auseinandersetzung mit Mubarrak entgegensah. Aber jetzt knurrte ihm allein schon beim Gedanken an ein gutes Stück Fleisch der Magen.
Langsam näherte sich Gacel dem Rand der gam, einem niedrigen Tafelberg. Sein Kamel führte er am Zügel und achtete darauf, daß der Wind immer gegen ihn stand, damit die Antilopen keine Witterung aufnehmen konnten. Die Herde graste in der von kurzem, spärlichem Gestrüpp bewachsenen Niederung, die in grauer Vorzeit einmal eine Art Lagune oder die besonders breite Stelle eines Flußbettes gewesen sein mußte. Hier hatte der Schoß der Erde noch immer ein wenig Feuchtigkeit bewahrt. Vereinzelte Tamarisken und ein halbes Dutzend Zwergakazien ragten in den Himmel. Gacel stellte zufrieden fest, daß sein Jagdinstinkt ihn auch diesmal nicht im Stich gelassen hatte. Dort hinten nämlich, im Licht der Nachmittagssonne, grasten oder schliefen die Mitglieder einer großen Familie jener schönen Tiere, deren langes Gehörn und rötliches Fell ihn, Gacel, geradezu aufzufordern schienen, eines von ihnen zu erlegen.
Er lud sein Gewehr mit einer einzigen Kugel, denn so konnte er der Versuchung widerstehen, für den Fall, daß der erste Schuß danebenging, ein zweites Mal aufs Geratewohl zu feuern, während das scheue Wild schon mit langen Sätzen die Flucht ergriff. Gacel wußte aus Erfahrung, daß ein zweiter, fast auf gut Glück abgefeuerter Schuß selten ins Schwarze traf und nur eine Verschwendung dargestellt hätte, zumal Munition in der Wüste so selten war wie Wasser. Er ließ sein Mehari frei, das sich unverzüglich ans Grasen machte, wobei es mit sicherem Instinkt nur die nahrhaftesten und saftigsten der Pflanzen fraß, die nach dem Regen überall zu sprießen begonnen hatten. Gacel bewegte sich lautlos vorwärts; geduckt huschte er von einem großen Stein zu einem vom Wind zerzausten Busch, von einer kleinen Düne zu einem Strauch, bis er schließlich an einer geeigneten Stelle innehielt. Von einem niedrigen, steinigen Hügel aus erblickte er in dreihundert Schritt Entfernung deutlich die schlanke Silhouette eines großen Bockes, der die Herde anführte. »Wenn du ein Männchen erlegst, tritt bald ein anderes, jüngeres an seine Stelle und deckt die Weibchen«, hatte ihm einst sein Vater erklärt. »Aber wenn du ein Weibchen tötest, dann tötest du auch die Jungtiere und die Kinder dieser Jungtiere, von denen sich deine Söhne und die Söhne deiner Söhne hätten ernähren können.«
Gacel legte an und zielte sorgfältig, um den Bock mit einem Blattschuß ins Herz zu treffen. Aus dieser Entfernung wäre ein Kopfschuß zweifellos wirksamer gewesen, aber als gläubiger Moslem konnte Gacel nicht das Fleisch eines Tieres essen, dem er nicht selbst die Kehle durchschnitten hatte, betend und das Gesicht nach Mekka gerichtet, wie der Prophet es befohlen hatte. Durch einen sofortigen Tod wäre die Antilope für ihn ungenießbar geworden. Deshalb ging er lieber das Risiko ein, daß das verletzte Tier zu fliehen versuchte. Er wußte, daß es mit einer Kugel in der Lunge nicht weit kommen würde.
Plötzlich hob der Bock den Kopf und witterte, wobei er sich scheu umblickte.
Dann, nach einer kleinen Ewigkeit, die in Wahrheit wohl nur ein paar Minuten dauerte, ließ er den Blick über die Herde schweifen, um sich zu vergewissern, daß keine Gefahr drohte. Schließlich machte er sich wieder daran, an einer Tamariske zu knabbern.
Erst als Gacel ganz sicher war, daß der Schuß nicht danebengehen würde und daß das Wild nicht unvermutet einen Sprung oder sonst eine unerwartete Bewegung machen würde, zog er ganz langsam den Abzug durch. Zischend zerteilte die Kugel die Luft, und gleich darauf brach der Bock in die Knie, als wären ihm mit einem einzigen Sensenhieb alle vier Beine abgesäbelt worden oder als hätte sich unter ihm urplötzlich wie durch Zauberei der Wüstenboden aufgetan.
Die weiblichen Tiere schauten ungerührt und ohne Angst zu ihrem Anführer hinüber, denn der Knall des Schusses hatte in der Stille zwar wie ein Donnerschlag geklungen, war für sie jedoch nicht mit dem Bild von Gefahr und Tod verbunden. Erst als sie einen Mann mit wehenden Gewändern und einem Dolch in der Faust auf sich zulaufen sahen, rannten sie davon und verloren sich bald in den Weiten des flachen Landes.
Gacel trat zu dem sterbenden Bock, der eine letzte Anstrengung machte, sich zu erheben und seiner Herde zu folgen. Doch etwas in ihm war zerbrochen. Nichts gehorchte mehr seinem Willen. Nur seine großen, unschuldigen Augen spiegelten das Ausmaß seiner Angst, als der Targi ihn am Gehörn packte, seinen Kopf nach Mekka drehte und ihm mit einem raschen Schnitt seines rasiermesserscharfen Dolches die Kehle durchschnitt. Das Blut schoß pulsierend aus der Wunde, es bespritzte die Sandalen und den Saum der gandura, aber Gacel achtete nicht darauf. Er war zufrieden, daß er wieder einmal seine Schießkunst unter Beweis gestellt und das Wild genau an der richtigen Stelle getroffen hatte. Als sich die Nacht herabsenkte, saß er noch immer da und aß. Die ersten Sternbilder waren noch nicht am Himmel erschienen, da schlief er schon, von einem Strauch gegen den Wind geschützt und vom erlöschenden Feuer gewärmt.
Das Lachen der Hyänen weckte ihn. Der Geruch der Antilope hatte sie herbeigelockt. Auch die Schakale trieben sich in der Nähe herum. Deshalb schürte Gacel das Feuer und scheuchte die Aasfresser möglichst weit in die Finsternis zurück. Er legte sich auf den Rücken, blickte zum Himmel auf, lauschte dem Rauschen des Windes und dachte darüber nach, daß er am Tag zuvor einen Mann getötet hatte. Zum ersten Mal im Leben hatte er einen anderen Menschen umgebracht, und das bedeutete, daß sein Leben künftig nie wieder so sein würde wie früher. Er fühlte sich nicht schuldig, denn er hielt seine Sache für gerecht, doch war er besorgt über die Möglichkeit, daß er einen jener Stammeskriege ausgelöst hatte, von denen die Alten soviel erzählten. Bei diesen Fehden kam immer irgendwann der Augenblick, an dem niemand mehr so recht zu sagen wußte, aus welchem Grund all das Blut vergossen wurde und wer damit angefangen hatte.
Dabei konnten es sich gerade die Tuareg, die wenigen imohar, die noch durch die Wüste zogen und die ihren Traditionen und Gesetzen treu waren, überhaupt nicht leisten, sich gegenseitig auszurotten, denn sie hatten schon alle Hände voll damit zu tun, sich gegen das Vordringen der Zivilisation zu behaupten.
Gacel rief sich die seltsame Empfindung ins Gedächtnis zurück, die seinen ganzen Körper durchzuckt hatte, als er fast ohne Anstrengung das weiche Fleisch von Mubarraks Unterleib mit dem Schwert durchbohrt hatte. Fast glaubte er noch einmal den heiseren Laut zu vernehmen, der sich in jenem Augenblick der Kehle seines Gegners entrungen hatte. Beim Herausziehen der Klinge war es Gacel vorgekommen, als hafte an der Spitze seiner takuba das Leben des besiegten Feindes. Beklommen dachte er an die Möglichkeit, daß er die Waffe vielleicht wieder eines Tages gegen einen Menschen richten müßte. Aber dann erinnerte er sich an den trockenen Knall des Schusses, der seinen schlafenden Gast das Leben gekostet hatte, und er tröstete sich damit, daß die Schuldigen eines solchen Verbrechens nicht auf Vergebung hoffen konnten.
Gacel hatte erfahren, wie bitter Ungerechtigkeit schmeckte, und genauso bitter war es, Unrecht zu sühnen. Mubarrak zu töten hatte ihm nicht das geringste Vergnügen bedeutet, sondern nur ein Gefühl tiefer Niedergeschlagenheit und Leere in ihm zurückgelassen. Der alte Suilem hatte recht: Rache konnte die Toten nicht zum Leben erwecken.
Irgendwann stellte sich Gacel die Frage, warum das ungeschriebene Gesetz der Gastfreundschaft für die Tuareg schon immer so wichtig gewesen war, daß es vor allen anderen Gesetzen, sogar denen des Koran, Vorrang hatte. Er versuchte sich vorzustellen, wie das Leben in der Wüste wäre, wenn ein Reisender nicht mehr die unerschütterliche Gewißheit
haben konnte, daß man ihn jederzeit in einer menschlichen Siedlung willkommen hieß, ihm Hilfe zukommen ließ und Achtung entgegenbrachte.
In einer der alten Geschichten war die Rede von zwei Männern, die sich einst so sehr haßten, daß einer der beiden - es war der Schwächere - sich eines Tages vor der khaima seines Feindes einfand und diesen um Gastfreundschaft ersuchte. Auf die Wahrung der Überlieferung bedacht, nahm der Targi den Gast auf und bot ihm seinen Schutz, doch nach zwei Monaten hatte er es derartig satt, die Gesellschaft des anderen ertragen und ihn durchfüttern zu müssen, daß er ihm versprach, ihn in Frieden ziehen zu lassen und ihm nie wieder nach dem Leben zu trachten. Das mußte sich vor vielen, vielen Jahren zugetragen haben, aber seither hatte sich aus jener Begebenheit bei den Tuareg ein Brauch entwickelt, mittels dessen sie ihre Streitigkeiten und Fehden beilegten.
Wie hätte er, Gacel, reagiert, wenn Mubarrak in seinem Zeltlager erschienen wäre, um ihn um Gastfreundschaft und Vergebung für seine Verfehlung zu bitten? Er wußte es nicht zu sagen, aber wahrscheinlich hätte er sich wie jener Targi in der alten Legende verhalten. Es wäre ihm widersinnig erschienen, eine schlimme Tat zu begehen, um jemanden zu bestrafen, der sich derselben Tat schuldig gemacht hatte.
Damals, als die Düsenflugzeuge anfingen, in großer Höhe die Wüste zu überqueren, und als Lastwagen begannen, die bekannteren Pisten zu befahren, so daß sich Ga-cels Volk immer weiter in die schwer zugänglichen Einöden der Wüste zurückziehen mußte, hätte niemand vorhersagen können, wie lange dieses Volk noch im Flachland sein Leben würde befristen können. Für Gacel jedoch stand fest, daß das Gesetz der Gastfreundschaft so lange als heilig betrachtet werden mußte, wie noch einer der Seinen in der Endlosigkeit der menschenleeren, von Sand und Geröll bedeckten hammada lebte, denn andernfalls würde kein Reisender mehr das Wagnis eingehen, die Wüste zu durchqueren.
Nein, Mubarraks Verfehlung war durch nichts zu rechtfertigen. Er, Gacel Sayah, wollte anderen Menschen, die keine Tuareg waren, vor Augen führen, daß die Gesetze und Bräuche seines Volkes in der Sahara auch künftig respektiert werden mußten, denn diese Gesetze und Bräuche gehörten untrennbar zu seiner Welt.
Ohne sie gab es keine Hoffnung auf ein Überleben.
Der Wind frischte auf, und mit ihm kam der Tag. Die Hyänen und Schakale begriffen, daß die Hoffnung auf ein Stück Antilopenfleisch sich zerschlagen hatte. Knurrend und jaulend machten sie sich davon, um, wie alle Tiere der Nacht, ihren dunklen Bau unter der Erde aufzusuchen. Da gab es den fennek, den Wüstenfuchs mit seinen langen Ohren, aber auch die Wüstenratte, die Schlange, den Hasen und den gewöhnlichen Fuchs. Sie alle würden schon schlafen, wenn die Sonne auf die Wüste herabzubrennen begann. Sie schonten ihre Kräfte, bis die Schatten der Nacht das Leben wiederum erträglich machten in dieser trostlosesten Gegend des Planeten Erde. Anders als in anderen Teilen der Welt entfaltete sich hier nachts die regste Tätigkeit, und der Tag diente der Ruhe.
Einzig der Mensch hatte es in all den Jahrhunderten nicht vollbracht, sich gänzlich an die Nacht anzupassen: Bei Anbruch des Tages machte sich Gacel also auf die Suche nach seinem Kamel, das in einer Entfernung von etwas mehr als einem Kilometer auf dem Boden lag und wiederkäute. Er ergriff die Zügel und setzte ohne Hast seine Reise nach Westen fort.
Der militärische Außenposten von Adoras umfaßte eine Oase, die fast die Form eines Dreiecks hatte. Dort gab es ungefähr hundert Palmen und vier Brunnen. Die Oase lag mitten in einem riesigen, von Dünen bedeckten Gebiet und war ständig vom Wüstensand bedroht, der sie völlig umzingelt hatte.
Tatsächlich war es ein Wunder, daß es sie überhaupt noch gab, denn der Sand schützte sie zwar einerseits vor dem Wind, verwandelte sie aber andererseits in einen Backofen, in dem das Thermometer um die Mittagszeit nicht selten auf siebzig Grad kletterte.
Die drei Dutzend Soldaten, aus denen die Garnison bestand, verbrachten die Hälfte ihrer Zeit damit, im Schatten der Palmen ihr Schicksal zu verfluchen. Ansonsten waren sie damit beschäftigt, Sand zu schaufeln - ein verzweifelter Versuch, die Wüste zurückzudrängen und den schmalen, ungepflasterten Weg freizuhalten, der die einzige Verbindung zur Außenwelt darstellte. Über ihn wurde die Garnison alle zwei Monate mit Proviant und Post beliefert. Seit vor dreißig Jahren ein halbirrer Oberst auf die absurde Idee gekommen war, die Armee müsse unbedingt jene vier Brunnen unter ihre Kontrolle bringen, galt Adoras zuerst bei den Kolonialtruppen und später, nach der Unabhängigkeit, bei den eigenen Streitkräften des Landes als eine Art »Himmelfahrtskommando«. Von den Männern, die am Rand des Palmenhaines begraben lagen, waren neun eines »natürlichen« Todes gestorben, und sechs hatten sich selbst das Leben genommen, weil sie sich nicht damit abfinden konnten, in dieser Hölle ihr Dasein fristen zu müssen.
Wenn ein Richter einen zum Galgen oder zu lebenslänglicher Haft verurteilten Verbrecher zu fünfzehn Jahren Zwangsarbeit in Adoras begnadigte, dann wußte er genau, was er tat, mochte der »Begnadigte« anfänglich auch glauben, man habe ihm tatsächlich eine Gunst erweisen wollen.
Kommandant der Garnison und zugleich Oberbefehlshaber über ein Gebiet von der halben Größe Italiens, in dem allerdings höchstens achthundert Menschen lebten, war ein Hauptmann namens Kaleb-el-Fasi. Er war seit sieben Jahren in Adoras und büßte hier dafür, daß er einen jungen Leutnant umgebracht hatte, nachdem jener damit gedroht hatte, gewisse Unregelmäßigkeiten bei der Verwaltung der Regimentskasse aufzudecken. Kaleb-el-Fasi war zum Tod verurteilt worden, aber sein Onkel, der berühmte General Obeid-el-Fasi, ein Held des Unabhängigkeitskrieges, hatte durchgesetzt, daß sein Neffe, der während des Freiheitskampfes sein Adjutant und Vertrauter gewesen war, zur Bewährung auf einen Außenposten versetzt wurde, den kein anderer Berufsoffizier freiwillig übernommen hätte, es sei denn, er hätte sich in einer ähnlichen Lage wie Kaleb-el-Fasi befunden.
Vor drei Jahren hatte Hauptmann Kaleb einmal anhand der Personalakten ausgerechnet, daß die Soldaten seines Regimentes den Tod von insgesamt zwanzig Menschen, fünfzehn Vergewaltigungen, sechzig bewaffnete Raubüberfälle sowie eine Unzahl von Diebstählen, Betrügereien und geringeren Vergehen auf dem Gewissen hatten. Um eine solche »Streitmacht« zu befehligen, hatte Kaleb deshalb all seine Erfahrung, Schlauheit und Brutalität aufbieten müssen. Nur ein Mann wurde noch mehr gefürchtet als er: seine rechte Hand Malik-el-Haideri, ein dünner, ziemlich kleiner Kerl, der irgendwie schwächlich und krank wirkte, jedoch so grausam, hinterlistig und tollkühn war, daß er es geschafft hatte, diesen Haufen wilder Tiere unter seine Kontrolle zu bringen. Er hatte schon fünf Mordanschläge und zwei Messerstechereien überlebt. Malik war die natürlichste aller »natürlichen Todesursachen« in Adoras: Zwei der Selbstmörder hatten sich eine Kugel in den Kopf geschossen, weil sie es nicht ertrugen, wie er mit ihnen umsprang.
Jetzt saß Malik gerade auf dem Kamm der höchsten Düne, die sich im Osten der Oase auftürmte. Es war eine alte ghourds von mehr als hundert Metern Höhe.
Außen hatte sie im Lauf der Zeit eine goldgelbe Färbung angenommen, und im Inneren war sie so hart geworden, als bestünde sie nicht aus Sand, sondern aus Stein. Sergeant Malik beobachtete gleichgültig, wie seine Männer den Sand »junger« Dünen fortschaufelten, die den Brunnen am Rand der Oase zu verschütten drohten. Plötzlich richtete er sein Fernglas auf einen einzelnen Reiter, der unversehens aufgetaucht war, auf einem weißen Mehari saß und ohne Eile geradewegs auf die Oase zuritt. Malik fragte sich verwundert, was wohl ein Targi in dieser Gegend zu suchen hatte. Schon seit sechs Jahren kamen die Tuareg nicht mehr zu den Brunnen von Adoras, sondern machten einen weiten Bogen um die Garnison und deren Besatzung. Auch die Karawanen der Beduinen machten hier immer seltener Rast, um ihre Wasservorräte aufzufüllen und ein paar Tage auszuruhen. Sie hielten sich dann stets so weit abseits wie möglich, versteckten ihre Frauen und vermieden jeden Kontakt mit den Soldaten. Beim Aufbruch zeigten sie sich jedesmal erleichtert, wenn es zu keinen Zwischenfällen gekommen war. Die Tuareg hingegen verhielten sich ganz anders. Früher, als sie noch an den Wasserstellen haltmachten, taten sie dies erhobenen Hauptes, wirkten stolz und trotzig, und sie erlaubten ihren Frauen sogar, unverschleiert, mit nackten Armen und Beinen zwischen den Palmen herumzulaufen. Es kümmerte sie nicht, daß die Soldaten seit Jahren keine Frau gehabt hatten. Wenn sich einer der Kerle eine Frechheit herausnahm, griffen die Tuareg sofort zu ihrem scharfen Dolch oder zum Gewehr.
Seitdem vor Jahren bei einer Auseinandersetzung zwei Tuaregkrieger und drei Soldaten umgekommen waren, zogen die »Söhne des Windes« es vor, einen Bogen um die Garnison zu machen. Doch nun kam jener einsame Reiter unbeirrt näher. Gerade überquerte er den Kamm der letzten Düne und hob sich deutlich mit seinen flatternden Gewändern vom Abendhimmel ab. Wenig später verschwand er zwischen den Palmen. Am nördlichen Brunnen hielt er an, kaum hundert Meter von den ersten Baracken entfernt.
Malik hatte es nicht eilig. Er rutschte den Abhang der Düne hinab, ging quer durch das Lager und trat zu dem Targi, der gerade sein Mehari tränkte. Manche dieser Tiere konnten bis zu hundert Liter Wasser auf einmal zu sich nehmen.
»Assalamu aleikum!« grüßte Malik. »Assalam!« erwiderte Gacel.
»Ein schönes Kamel hast du da - und ein sehr durstiges.«
»Wir kommen von weit her.« »Woher?« »Von Norden.«
Sergeant Malik-el-Haideri haßte den Gesichtsschleier der Tuareg, denn er wollte immer wissen, mit wem er es zu tun hatte, und versuchte stets, vom Gesichtsausdruck anderer Menschen abzulesen, ob sie die Wahrheit sagten oder schwindelten. Bei den Tuareg war dies jedoch nie möglich, denn ihr Gesichtsschleier hatte nur einen schmalen Spalt für die Augen - und diese Augen kniffen sie außerdem beim Reden zusammen oder schlössen sie sogar ganz. Auch der Klang ihrer Stimme wurde durch den Schleier entstellt. Malik mußte sich deshalb mit der Antwort zufriedengeben, zumal er selbst gesehen hatte, daß der Targi von Norden her gekommen war. Wie hätte er auch ahnen können, daß Gacel in einem großen Bogen um die Oase herumgeritten und in Wirklichkeit aus Süden gekommen war?
»Wohin willst du?«
»Nach Süden.« Gacels Mehari hatte sich inzwischen zufrieden und mit prall gefülltem Bauch hingelegt. Er selbst machte sich daran, ein wenig Reisig für ein kleines Lagerfeuer zu sammeln.
»Du kannst mit den Soldaten essen«, meinte Malik. Gacel schlug eine Decke zurück, und eine halbe Antilope kam zum Vorschein. Sie war mit geronnenem Blut überkrustet, aber das Fleisch war noch saftig. »Wenn du willst, kannst du mit mir essen - als Gegenleistung für dein Wasser.«
Sergeant Malik spürte, wie ihm das Wasser im Mund zusammenlief. Seit zwei Wochen hatten seine Männer kein einziges Stück Wild erlegt, denn im Lauf der Jahre waren die wilden Tiere immer weiter in die Wüste zurückgedrängt worden, und unter den Soldaten gab es keinen einzigen echten Beduinen, der mit der Wüste und deren Bewohnern vertraut war.
»Das Wasser gehört allen«, erwiderte Malik. »Aber deine Einladung nehme ich gerne an. Wo hast du die Antilope geschossen?«
Gacel lächelte innerlich über die plumpe Falle. »Im Norden«, antwortete er.
Als er genügend Zweige gesammelt hatte, setzte er sich auf die Decke. Er nahm Feuerstein und Lunte zur Hand, aber Malik hielt ihm eine Schachtel Streichhölzer hin.
»Nimm die hier«, sagte er. »Damit geht es viel leichter.«
Wenig später, als Gacel ihm die Streichhölzer zurückgeben wollte, wies er sie zurück: »Behalte sie! Im Lagerschuppen gibt es jede Menge davon.«
Malik hatte sich Gacel gegenüber niedergelassen und schaute zu, wie dieser die Keulen der Antilope auf den Ladestock seines alten Gewehres spießte, um sie langsam über dem kleinen Feuer zu braten.
»Suchst du im Süden Arbeit?«
»Nein, ich suche eine Karawane.«
»Um diese Zeit kommen hier keine Karawanen durch. Die letzte hat vor einem Monat bei uns haltgemacht.«
»Meine Karawane wartet auf mich«, war die rätselhafte Antwort. Und da der Sergeant ihn verständnislos anstarrte, fügte Gacel im selben Tonfall hinzu: »Sie wartet schon seit fünfzig Jahren auf mich.«
Jetzt schien Malik zu begreifen. Er betrachtete den Targi eingehender. »Die Große Karawane!« rief er schließlich aus. »Suchst du etwa nach der sagenumwobenen Großen Karawane? Du bist verrückt!«
»Es ist keine Sage. Mein Onkel war mit dabei. Außerdem bin ich nicht verrückt!
Mein Vetter Suleiman, der für einen Hungerlohn Ziegelsteine schleppt - der ist verrückt!«
»Viele haben schon nach der Karawane gesucht, aber kein einziger ist lebend zurückgekehrt.«
Gacel wies mit einer Kopfbewegung auf die mit Steinen bedeckten Gräber, die zwischen den spärlichen Palmen hindurch am anderen Ende der Oase zu erkennen waren. »Sie sind bestimmt nicht toter als die dort drüben, aber wenn sie die Karawane gefunden hätten, wären sie steinreich geworden.«
»Das >Land der Leere< kennt keine Gnade, dort gibt es kein Wasser und keine einzige Pflanze, von der sich dein Kamel ernähren könnte. Nirgends findest du Schatten oder einen Orientierungspunkt, an den du dich halten könntest. Es ist die Hölle!«
»Das weiß ich«, bestätigte der Targi. »Ich war schon zweimal dort.«
»Du warst im >Land der Leere<?« fragte Malik ungläubig.
»Ja, zweimal.«
Der Sergeant brauchte Gacels Gesicht nicht zu sehen, um zu begreifen, daß er die Wahrheit gesagt hatte. Maliks Interesse war erwacht, denn er lebte schon lange genug in der Sahara, um vor einem Mann Hochachtung zu empfinden, der sich ins »Land der Leere« begeben hatte und heil zurückgekehrt war. Solche Männer konnte man zwischen Marokko und Ägypten an den Fingern einer einzigen Hand abzählen. Nicht einmal Mubarrak-ben-Sad, der der Garnison offiziell als Führer in der Wüste diente und der als einer der besten Kenner dieses von Geröll und Sand bedeckten Landes galt, konnte sich einer solchen Leistung rühmen.
»Aber ich kenne einen, der es geschafft hat«, hatte Mu-barrak dem Sergeanten irgendwann einmal während einer ausgedehnten Expedition zum Huaila-Massiv versichert. »Ich kenne einen amahar vom Kel-Tagelmust, der war dort und ist sogar wieder zurückgekehrt...«
»Was fühlt man, wenn man mittendrin ist?« wollte Malik wissen.
Gacel warf ihm einen langen Blick zu, dann antwortete er achselzuckend: »Nichts.
Man muß alle Gefühle draußen lassen. Auch alle Ideen und Vorstellungen muß man draußen lassen. Es kommt darauf an, wie ein Stein zu leben, und man darf keine einzige überflüssige Bewegung machen, die den Wasserverbrauch erhöht.
Sogar nachts muß man sich so langsam bewegen wie ein Chamäleon. Nur wenn es dir gelingt, dich gegen Hitze und Durst unempfindlich zu machen, hast du eine winzige Überlebenschance. Aber vor allem muß man die Todesangst überwinden und ruhig bleiben.«
»Warum hast du das getan? Warst du auf der Suche nach der Großen Karawane?«
»Nein, ich suchte in mir nach den Spuren meiner Vorfahren. Sie haben das >Land der Leere< besiegt.«
Malik schüttelte abwehrend den Kopf. »Niemand besiegt das >Land der Leere<«, sagte er voller Überzeugung. »Der Beweis dafür ist, daß alle deine Vorfahren tot sind, aber das >Land der Leere< ist noch genauso unerforscht wie an dem Tag, als Allah es schuf.« Er machte eine Pause, schüttelte erneut den Kopf und stellte sich wie im Selbstgespräch die Frage: »Warum hat Allah das wohl getan? Warum hat er, der so große Wunder vollbringen konnte, auch diese Wüste geschaffen?«
Die Antwort klang ebenso vermessen wie die Frage selbst: »Damit er hinterher die imohar schaffen konnte.«
Malik lächelte belustigt. »So wird es wohl sein«, meinte er. Und mit einem Blick auf die Antilopenkeule fuhr er fort: »Ich mag es nicht, wenn das Fleisch zu stark gebraten ist.« Gacel zog den Ladestock aus dem Fleisch, reichte Malik eines der beiden Stücke und machte sich daran, mit seinem scharfen Dolch dicke Scheiben von dem anderen abzuschneiden. »Falls du jemals in Not gerätst, koche oder brate das Fleisch nicht, sondern iß es roh. Verzehre jedes Tier, das dir in die Quere kommt, und trinke sein Blut! Aber beweg dich dabei nicht, bewege dich überhaupt nicht!«
»Ich werde daran denken«, meinte der Sergeant. »Ich werde daran denken, aber ich bete zu Allah, daß er mich vor einer solchen Notlage behütet.«
Schweigend beendeten sie die Mahlzeit. Sie tranken einen Schluck frisches Wasser aus dem Brunnen, dann erhob sich Malik und reckte sich zufrieden. »Ich muß jetzt gehen«, sagte er. »Der Hauptmann erwartet meinen Bericht, und ich muß noch meinen Kontrollgang machen. Wie lange wirst du hierbleiben?«
Gacel hob die Schultern zum Zeichen, daß er es nicht wußte.
»Ich verstehe. Bleib, solange du willst, aber halte dich von den Baracken fern! Die Wachen haben Befehl, ohne Vorwarnung zu schießen.«
»Warum?«
Sergeant Malik-el-Haideri lächelte vielsagend, dann wies er mit einer Kopfbewegung auf ein Holzhäuschen, das abseits der anderen stand. »Der Hauptmann hat keine Freunde«, erläuterte er. »Er hat keine, und ich habe auch keine, aber ich kann mich um mich selbst kümmern.« Mit diesen Worten ließ er Gacel stehen.
Schon vertieften sich die Schatten zwischen den Palmen der Oase. Die Stimmen der Soldaten, die mit geschulterten Schaufeln müde und verschwitzt zurückkehrten, waren klar und deutlich zu vernehmen. Die Männer sehnten sich nach einer Mahlzeit und dem Strohsack, auf dem sie sich für ein paar Stunden ins Reich der Träume flüchten konnten, weit fort von Adoras, dieser Hölle auf Erden.
Fast ohne Abenddämmerung färbte sich der Himmel zuerst rot und wurde dann schwarz. Überall in den Hütten wurden Karbidlampen angezündet. Einzig das Häuschen des Hauptmanns hatte Fensterläden, so daß niemand sehen konnte, was im Inneren vor sich ging. Bei Anbrach der Dunkelheit bezog ein Wachtposten keine zwanzig Schritte von der Haustür entfernt Stellung, das Gewehr im Anschlag.
Eine halbe Stunde später ging die Tür auf, und eine hochgewachsene, schlanke Gestalt zeichnete sich im Türrahmen ab. Auch ohne die Sterne an der Uniform hätte Gacel den Mann wiedererkannt, der seinen Gast getötet hatte. Der Mann blieb ein paar Augenblicke lang ruhig stehen, atmete in vollen Zügen die Nachtluft ein und zündete sich eine Zigarette an. Im Schein der kleinen Flamme sah Gacel wieder in allen Einzelheiten dieses Gesicht und die stahlharten Augen, die so verächtlich geblitzt hatten, als jener Mann behauptet hatte, sei das Gesetz. Gacel fühlte sich versucht, zum Gewehr zu greifen und den Kerl mit einem einzigen Schuß zu erledigen, tat jedoch nichts dergleichen, sondern beschränkte sich darauf, den Mann zu beobachten. Dabei malte er sich aus, wie sich der Hauptmann wohl fühlen würde, wenn er wüßte, daß der von ihm erniedrigte und beleidigte Targi neben einem erlöschenden Lagerfeuer an einer Palme lehnte und darüber nachsann, ob er ihn, den Hauptmann, sofort umbringen oder ob er die Tat auf später verschieben sollte.
Für all die Männer aus der Stadt, die es in die Wüste verschlagen hatte, eine Wüste, die zu lieben sie nie lernen würden, sondern die sie haßten und aus der sie gern um jeden Preis geflohen wären - für diese Leute waren die Tuareg nichts weiter als ein Bestandteil der Landschaft. Sie konnten nicht nur keinen Targi vom anderen unterscheiden, sondern waren auch nicht in der Lage, zwei langgestreckte Dünen mit ihren Wellenkämmen aus Sand voneinander zu unterscheiden, selbst wenn eine halbe Tagesreise zwischen diesen Dünen lag.
Als Stadtmenschen hatten sie keinen Sinn für die Zeit, den Raum, die Gerüche und die Farben der Wüste. Genausowenig begriffen sie den Unterschied zwischen einem Krieger aus dem »Volk des Schleiers« und einem amahar vom »Volk des Schwertes«, oder den Unterschied zwischen einem amahar und einem Sklaven, oder den Unterschied zwischen einer echten, freien und starken targia und einer armen beduinischen Haremsklavin.
Gacel hätte zu dem Hauptmann gehen und sich mit ihm eine halbe Stunde lang über die Nacht, die Sterne, den Wind und die Tiere der Wüste unterhalten können, ohne daß der Mann in ihm den »verfluchten, stinkenden Bettler« wiedererkannt hätte, der vor fünf Tagen versucht hatte, sich ihm zu widersetzen. Viele Jahre lang hatten die Franzosen vergeblich versucht, die Tuareg zum Ablegen des Gesichtsschleiers zu bewegen. Am Ende hatten sie sich eingestehen müssen, daß sie gescheitert waren und daß es ihnen nie gelingen würde, einen Targi vom anderen allein aufgrund der Stimme und der Gesten zu unterscheiden.
Weder Malik noch der Hauptmann oder all die zum Sandschaufeln verurteilten Soldaten waren Franzosen, aber eines hatten sie gemeinsam: Sie kannten die Wüste nicht und verachteten ihre Bewohner.
Als der Hauptmann seine Zigarette zu Ende geraucht hatte, ließ er den Stummel in den Sand fallen, grüßte lustlos den Wachtposten und schloß die Tür. Geräuschvoll schob er den schweren Riegel vor. Im Lager gingen nach und nach die Lichter aus.
Bald lag die Oase in tiefem Schweigen da. Nur das Rauschen der Palmwedel in der leichten Brise war zu vernehmen; dann und wann heulte in der Ferne ein hungriger Schakal. Gacel wickelte sich in seine Decke, legte den Kopf auf den Sattel und warf einen letzten Blick auf die Baracken und die unter einem roh zusammengezimmerten Sonnendach aufgereihten Militärfahrzeuge. Wenig später war er eingeschlafen.
Im Morgengrauen erkletterte er die fruchtbarste der Palmen und warf von oben büschelweise reife Datteln hinab. Er verstaute sie in einem Sack, füllte seine gerbas mit Wasser und sattelte sein Mehari, das geräuschvoll protestierte, denn gern wäre es noch länger am schattigen Brunnen geblieben.