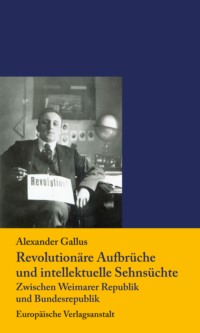Kitabı oku: «Revolutionäre Aufbrüche und intellektuelle Sehnsüchte», sayfa 5
2. Akteure der Gewalt und zivil-militärische Balance
Eine weitere wichtige Frage zur Einschätzung der Gewaltproblematik gilt dem Verhältnis von zivilen politischen und militärischen Akteuren in den Übergangsjahren zwischen Revolution und Kapp-Putsch, wie sie in den zurückliegenden Jahren insbesondere Peter Keller und Rüdiger Bergien zu beantworten gesucht haben.67 Schon Ernst-Heinrich Schmidt gelangte in seiner Pionierstudie Heimatheer und Revolution 1918 aus dem Jahr 1981 zu der Einschätzung, dass die Zusammenarbeit zwischen der Übergangsregierung und dem für das Heimatheer zuständigen Preußischen Kriegsministerium einen „realpolitischen Charakter im Sinne einer Anpassung an die revolutionären Machtverhältnisse“ besaß.68 Die Bereitschaft und die Maßnahmen Kriegsminister Scheuchs zur Sicherung der Regierung Ebert stellten einen wesentlichen Beitrag dar, um „ihr Zustandekommen und ihr Überleben zu ermöglichen“.69 Schmidt erkennt ein Handeln „in dienender Funktion“70, spricht sogar von „militärischen Steigbügelhalter[n]“71 und bewertet die zivil-militärische Zusammenarbeit in der Frühphase der Revolution positiv: auch als Chance „zu einer auf Dauer tragfähigen Kooperation“, die erst später verspielt worden sei.72
Ungeachtet der empirisch dichten Analyse Schmidts dominierte weiterhin ein höchst schemenhaftes Bild von der frühen republikanischen Wehrpolitik. Es folgte einer binären oder gar dichotomischen Gestaltungslogik: aufgeteilt zum einen zwischen überforderten Politikern und eigenständig handelnden Militärs, zum anderen – so eine weitere manichäische Sichtweise – zwischen einem verräterischen, gelegentlich sogar als „rechtsextrem“ rubrizierten Kurs der Mehrheitssozialdemokratie hier und einem leichtfertig eingesetzten, bald außer Kontrolle geratenen „weißen Terror“ dort. Von einem totalen politischen Kontrollverlust gegenüber den bewaffneten Kräften, die in Form von wild entstandenen marodierenden Freikorps schalteten und walteten, kann indes nach Bergien und Keller nicht die Rede sein. Stattdessen betonen sie in ihren von der Revolutionsforschung kaum beachteten Studien73 einen Willen zur republikanischen Wehrhaftigkeit durch den Einsatz staatlich organisierter und kontrollierter, mindestens „leidlich loyaler“ Regierungstruppen.74 Es existierte ein „Wehrkonsens unter dem Primat des Republikschutzes“75, beruhend auf einer „engen Kooperation von ziviler Exekutive und der militärischen Elite“. Damit sei die Bereitschaft verbunden gewesen, insbesondere gegen die Gegner der parlamentarischen Demokratie von links „radikale Mittel“ einzusetzen.76 Anders habe „das Überleben“ der „neuen Ordnung in ihren kritischsten Monaten“ nicht gesichert werden können.77
Bis in den Sommer 1919 konnte im Übrigen keineswegs von einem eigenmächtigen „gegenrevolutionären“ Agieren der verschiedenen militärischen Formationen gesprochen werden, standen diese doch „in einem zumindest formalen Loyalitätsverhältnis zur neuen Regierung“.78 Ebert und Scheidemann strebten demzufolge ganz bewusst und „mit aller Kraft nach dem Gewaltmonopol“ und einer zum Selbstschutz befähigten „wehrhaften“ Republik. Ihr Handeln sei auf eine bewusste Entscheidung zurückzuführen und keineswegs mit Überforderung, einem bloßen Drang nach Machterhalt oder gar einem reaktionären Machtstreben zu erklären.79 Diese Politik einer Kombination von starkem Staat und Republikschutz habe mindestens anfänglich Erfolge erzielt und zugleich ein gesellschaftliches Integrationsangebot „bis in das nationale Lager hinein“ eröffnet.80 Darin sei auch der Versuch zu erkennen gewesen, die nach innen wie außen gerichtete sicherheitspolitische Verlässlichkeit der Sozialdemokratie in einer „bellizistisch“ gestimmten Gesellschaft zu unterstreichen und den Vorwürfen der „Wehrfeindlichkeit“ oder gar des „Landesverrats“ zu begegnen.81
Das Scheitern des republikanischen Wehr- oder Sicherheitskonsenses – angetrieben von Versailles-Trauma, Dolchstoßlegende und Kapp-Putsch – war nicht von vornherein festgelegt. Es wäre „eine andere Entwicklung möglich gewesen“, so lautet die Quintessenz von Peter Kellers Forschung.82 Auch er zeichnet ein differenziertes Bild militärisch-politischer Kooperation während der Transformationsperiode 1918/19 und hebt hervor, wie sehr „prinzipiell die Möglichkeit“ zu einem „dauerhaften Zweckbündnis“ bestanden habe.83 Die Chance auf alternative historische Verläufe verdeutlicht er anhand von drei unterschiedlichen Idealtypen damals agierender militärischer Führungsgruppen – pragmatisch-technokratisch, verfassungsloyal-attentistisch, restaurativ-militaristisch84 – und dem vielschichtigen Charakter der zum Einsatz gelangten militärischen Verbände. „Formationen, deren Führung tatsächlich in den Kategorien einer […] entgrenzten Kriegführung dachten, standen auch 1918/19 noch immer Befehlshaber gegenüber, die ihre Truppe gezielt zur Mäßigung aufriefen, ja tendenziell ein unblutiges Vorgehen bevorzugten.“85 Momente der Deeskalation ebenso wie der bewusste Einsatz lediglich symbolischer Gewalt während der Kämpfe im Jahr 1919 würden häufig nur unzureichend gewürdigt.86
Keller kritisiert außerdem das ebenso dominante wie simplifizierende Bild von den Soldaten der Freikorps als ausnahmslos brutalen, vor sich hinmetzelnden, regellosen, rechtsradikalen und republikfeindlichen Gewaltmenschen. Pikanterweise habe sich in der Historiografie eine Sicht verfestigt, die vielfach auf den Überzeichnungen und Selbstheroisierungen der während der NS-Zeit entstandenen Freikorpsliteratur beruhe. Der Sammelbegriff „Freikorps“ sei in typologisch-analytischer Perspektive verfehlt, es erscheine angebrachter von „Regierungstruppen“ oder zumindest „militärischen Notbehelfen“ zu sprechen, da sie, in organisationsgeschichtlicher Hinsicht, eher regulär und geordnet gebildet worden seien und nicht dem Bild „paramilitärischer Freischärler“ entsprochen hätten (die es freilich auch gab, aber nicht nur und nicht mehrheitlich – so Keller).87 Der „staatliche Faktor bei Aufstellung und Einsatz der Formationen“ sei hoch gewesen, wenngleich Keller ebenfalls deren Unübersichtlichkeit im Frühjahr 1919 betont.88 Auch Bergien begegnet der These von der Unterlegenheit und dem hilflosen Getrieben- und Ausgeliefertsein der zivilen politischen Kräfte gegenüber dem Militär reserviert, würde dies doch „jene Mobilisierungen“ ausblenden, „die nicht ohne oder gar: gegen, sondern mit und durch die republikanischen Regierungen stattfanden“ – insbesondere die Einwohnerwehren. Hierin sei weniger ein reaktionäres als ein republikanisches Projekt erkennbar gewesen.89
3. Zeitgenössische Wahrnehmung und Würdigung von Gewalt im liberal-bürgerlichen Spektrum
Es ist eine Stärke von Mark Jones’ Revolutionsgeschichte der Gewalt, viele Zeitgenossen zu Wort kommen zu lassen: von Ernst Troeltsch und Theodor Wolff über Harry Graf Kessler bis zu den Historikern Karl Hampe und Gustav Mayer. Diese Kronzeugen werden jedoch meist so zitiert, dass ihre Beobachtungen zu jenem „Crescendo der Gewalt“ passen, von dem Jones ausdrücklich spricht und das eine ständig ansteigende Gewaltdynamik suggeriert.90
An einer Stelle kommt indes auch bei Jones eine andersgeartete Episode zur Sprache: ein Spaziergang Ernst Troeltschs im Berliner Grunewald, den er auf Anraten seiner besorgten Frau nur mit einem Revolver bewaffnet wagen sollte. Einigermaßen verblüfft stellte Troeltsch im Nachhinein fest, wie überflüssig dies angesichts der friedlichen Stimmung gewesen sei. Einen Monat nach den Januarunruhen wunderte er sich erneut, wie unbeeindruckt das Berliner Großstadtleben trotz aller Gräuel und Gewehrsalven weiterlief. „Musiker und Histrionen bieten sich an allen Plakatsäulen in Massen an“, notierte er in einem seiner berühmten Spectator-Briefe, „die Theater spielen weiter und versammeln ihr an Gewehrschüssen vorbeieilendes Publikum in gewohnter Masse, vor allem wird, wo irgend möglich, getanzt – ohne Rücksicht auf die Kohlen- und Lichtnot“.91
Am 17. Januar 1919, erst zwei Tage nach dem Luxemburg-Liebknecht-Mord, hielt Harry Graf Kessler nach einem Kabarett-Besuch Vergleichbares in seinem Tagebuch fest: „Rassige spanische Tänzerin. In ihre Nummer krachte ein Schuß hinein. Niemand achtete darauf. Geringer Eindruck der Revolution auf das großstädtische Leben. Dieses Leben ist so elementar, daß selbst eine weltgeschichtliche Revolution wie die jetzige wesentliche Störungen darin nicht verursacht. Das Babylonische, unermeßlich Tiefe, Chaotische und Gewaltige von Berlin ist mir erst durch die Revolution klargeworden, als sich zeigte, daß diese ungeheure Bewegung in dem noch viel ungeheureren Hin und Her von Berlin nur kleine örtliche Störungen verursachte, wie wenn ein Elefant einen Stich mit einem Taschenmesser bekommt. Er schüttelt sich, aber schreitet weiter, als ob nichts geschehen wäre.“92
Diese Erfahrungsgeschichte der Beruhigung und des Gleichmuts tritt bei Jones ganz hinter die Nervosität und Hypersensibilität der Zeit zurück, so als ob – zumindest im Geiste einer ganzen Bevölkerung – der Finger stets am Abzug gewesen wäre. Dazu passt die Rede von einer „Nachkriegsgeschichte des Maschinengewehrs“.93 Es gilt, gegen diese Deutung stärker die Paradoxien der zeitgenössischen Wahrnehmung zu erfassen, die sich aus den Eindrücken von alltagsweltlicher Normalität einerseits und aus außergewöhnlichen Taten politischer Gewalt andererseits speisten. Aber auch jenseits solcher ebenso kontingent wie bisweilen bizarr erscheinender Konstellationen ließe sich der These einer Radikalisierung der politischen Kultur im Zeichen von Bolschewismusfurcht und ostentativ eingesetzter militärischer Gewalt jene einer gezielten Mäßigung entgegenhalten. Politisch beruhte sie auf dem innerlinken Schisma zwischen moderaten und extremen Kräften ebenso wie auf einer bürgerlich-sozialdemokratischen Übereinkunft und dem Bemühen, vielfältige Ideen zur weiteren Ausgestaltung der liberalen und sozialen Demokratie zu integrieren.94
Gleichwohl steht fest: Die von Noske implementierte Regierungsgewalt verstärkte die Spaltung der Linken massiv. Clara Zetkin wies im Januar 1920 den Mehrheitssozialdemokraten die alleinige Schuld für den „breiten Blutstrom“ während der Kämpfe des Vorjahres zu. Dies sei ein Blutstrom, der fortan „nicht überbrückt werden“ könne.95 Wer sich ganz auf die Geschichte der Arbeiterbewegung kapriziert, wird dieser zeitgenössischen Einschätzung einiges abgewinnen können. Wer den milieufixierten Blick indes weitet, wird nicht nur das blutige Fanal des Luxemburg-Liebknecht-Mordes vom 15. Januar, sondern auch das Ergebnis der Wahlen zur Nationalversammlung vom 19. Januar 1919 zu würdigen haben. Bei diesen Wahlen, an denen erstmals in der deutschen Geschichte Frauen wählen und gewählt werden durften, errang die MSPD 37,9 Prozent der Stimmen vor dem Zentrum mit 19,7 und der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) mit 18,5 Prozent. Mit einer Dreiviertelmehrheit begründeten diese drei Parteien bekanntlich die sogenannte Weimarer Koalition. Schon die Regierungsbildung unterstrich den Grundcharakter der Republikgründung: Sie war ein Basiskonsens zwischen gemäßigtsozialdemokratischen und liberal-bürgerlichen Kräften.
Vor dem Hintergrund einer so ausgedehnten Perspektive mag man Heinrich August Winklers Kompromissformel einiges abgewinnen, bei der Spaltung der Arbeiterbewegung habe es sich um „eine schwere Vorbelastung und eine Vorbedingung der ersten deutschen Demokratie“ gehandelt.96 Ein solches Urteil begegnet zugleich einer gelegentlich verzerrenden Sichtweise in der Revolutionsforschung, die zumal in der kontrafaktischen Debatte über unerfüllte Möglichkeiten bisweilen suggeriert,97 Deutschland habe 1918/19 ausschließlich aus der Arbeiterbewegung und ihren unerfüllt gebliebenen Zielen bestanden. Um das Bild von der revolutionären Umbruchsperiode zu vervollständigen, sind die Bedrohungswahrnehmungen in bürgerlichen, liberalen und konservativen Kreisen sowie deren Erwartungen gegenüber der tonangebenden regierenden Sozialdemokratie ebenfalls zu berücksichtigen.
Diese Erwartungshaltungen sollen anhand einiger Beispiele illustriert werden: Ein „Vernunftrepublikaner“ wie Friedrich Meinecke forderte Mitte März 1919 eine „starke, straffe und einheitliche Zentralgewalt“ zur Rettung vor der „Diktatur des Proletariats“.98 Der Heidelberger Mediävist Karl Hampe, der der Monarchie nachtrauerte, sich aber fortan Stück für Stück mit der Republik arrangieren sollte, hielt es am 25. Dezember 1918 für den gravierenden Fehler der regierenden Sozialdemokratie, vor dem Einsatz physischer Zwangsgewalt im Innern zurückzuschrecken. Kurz nach Ausbruch der Weihnachtskämpfe kennzeichnete er diese Haltung als „Humanitätsdusel“, der „geradezu zum Verbrechen“ werde, „weil er bewirkt, daß Aufruhr, der anfangs mit wenig Blut erstickt werden könnte, lawinenartig wächst und schließlich ganze Ströme fordert“.99 Das rigorose Handeln seitens der Regierung in den Januarkämpfen begrüßte er und hoffte Anfang Februar 1919, dass sie „rücksichtslos durchgreifend“ bleibe.100
Der mit der Republik sympathisierende Ernst Troeltsch beobachtete im April 1919, dass sich viele Zeitgenossen ein resoluteres Vorgehen der Sozialdemokratie zur Wiederherstellung und Sicherung der Staatsgewalt wünschten. Die von ihm diagnostizierte Gewalt-Skepsis der MSPD wertete er als „Schlappheit“ und „mangelnde nationale Gesinnung“.101 Noch im Februar 1920 war Troeltsch voll des Lobes für Gustav Noske: „Regierung bedeutet Ordnung und Recht überhaupt. Daß beides wieder gewonnen worden ist, das ist das immerhin nicht zu verachtende Werk des Parlaments und Noskes. Noske, der die Furchtlosigkeit eines nie versagenden Tierbändigers an sich hat, ist der Retter des Deutschen Reiches.“102 In dieselbe Richtung weisen Notizen von Troeltschs DDP-Parteifreund Theodor Wolff. Der liberale Journalist bemerkte im Februar 1919 anerkennend, wie sehr sich Noske „gegen die Unruhestörer“ und „in der Berührung mit den harten Tatsachen“ entwickelt habe – wenngleich bisweilen etwas „merkwürdig“.103 Auch ein späterer Historiker wie Rüdiger Bergien konnte „Noskes Politik“ insofern etwas abgewinnen, als sie klar signalisierte, „dass auch Sozialdemokraten fähig waren, Sicherheit herzustellen und damit den Erwartungen gerecht zu werden, die sich traditionell an die Inhaber der Regierungsgewalt richteten“.104 Es waren solche mit großer Skepsis gegenüber der sozialdemokratischen Regierungsfähigkeit gepaarte Erwartungen, die im bürgerlich-liberalen Spektrum dominierten.
Dieses Wechselspiel aus Erwartung und Erfahrung sorgte für eine durchaus fragile Konstellation. So notierte Theodor Wolff schon rund einen Monat nach seinem Noske-Lob – Mitte März 1919 – ebenfalls, dass sich „auch in der nicht-radikalen Bevölkerung vielfach Mißstimmung über das Auftreten u. Verfahren eines Teils der Freiwilligen-Offiziere“ breitmache. Denn diese Militärs würden „schon wieder die alten Manieren annehmen“.105 Darin deutete sich zusammengenommen eine differenzierte, von Ambivalenzen durchzogene Haltung zur Gewalt an. Vergleichbare Positionen finden sich auch beim „roten Grafen“ Kessler106 oder bei der eindeutig linken, nach Parteiaffinität aber nicht leicht einzusortierenden Käthe Kollwitz. Anfang des Jahres 1919 tat Harry Graf Kessler sein Unbehagen gegenüber einer ganz ohnmächtigen Staatsgewalt kund. Es schien ihm, als seien „die Zeiten des Faustrechts zurück“.107 Noch Mitte Januar 1919 fürchtete er eine „Entwicklung wie in Rußland“ und sogar ein „Verduften des Staates“.108 Zugleich erkannte er in der „Verbrüderung mit der Gewalt“ die Entwertung eines genuin politischen Denkens und Handelns.109 Nun machte er eine „leichtsinnig und frech mit dem Leben ihrer Mitbürger spielende Regierung“ dafür verantwortlich, „einen in Jahrzehnten nicht wieder zu heilenden Riß in das deutsche Volk gebracht“ zu haben.110
Kollwitz schließlich notierte an der Jahreswende 1918/19 zunächst erleichtert, dass bei allen Widrigkeiten und Kämpfen endlich kein Krieg mehr sei. „Der entsetzliche, immer unerträglichere Kriegsdruck ist fort und das Atmen ist wieder leichter. Daß wir damit gleich gute Zeiten bekämen, glaubte kein Mensch, aber der enge Schacht in dem wir staken, in dem wir uns nicht rühren konnten, ist durchkrochen, wir sehen Licht und atmen Luft.“111 Was die Kämpfe zwischen mehrheitssozialdemokratischer Regierung und Spartakus betraf, zeigte sie sich zwiegespalten. Bei aller Sympathie für den linken Radikalismus war sie mit der Zurückdrängung der Spartakus-Anhänger doch einverstanden. Für so notwendig sie ein solches Vorgehen grundsätzlich hielt, nannte sie die „rohe Gewaltanwendung“ gleichwohl „entsetzlich“. Sie brachte Verständnis für den Ruf nach dem Militär auf, fürchtete im selben Atemzug aber, dass dies der Beginn einer marschierenden „Reaktion“ sein könnte.112
Diese Stimmen vermitteln einen Eindruck davon, wie komplex und ambivalent das Gewalthandeln während des „langen Novembers“ der Revolution in bürgerlich-intellektuellen, vorwiegend linksliberalen Kreisen bewertet wurde, als wie notwendig und fragwürdig zugleich es erschien. Es wäre angesichts dieser Stimmen irreführend, selbst das ausdrückliche Lob für Noske als Zeichen von kruder Gewaltverherrlichung zu interpretieren. Dies würde das vorrangige Anliegen dieser liberalbürgerlichen Zeitzeugen verkennen: nämlich die staatliche Ordnung und das Gewaltmonopol wiederherzustellen. Insofern sind diese Quellen nicht als Ursprung und Akzeptanz extralegaler und illegitimer Gewalteinsätze zu werten, wie sie später unter den Nationalsozialisten zur Regel werden sollten. Im Gegenteil: Die Äußerungen zielten auf die Legalisierung und Konzentrierung der Gewalt, sie spiegeln ein Bedürfnis nach bürgerlicher Sekurität.
4. Interregionale und transnationale Vergleichsüberlegungen
Ein weiterer Kritikpunkt gegenüber der These, es habe sich bei der Novemberrevolution um einen Wendepunkt der Gewalt gehandelt, ergibt sich aus dem interregionalen und transnationalen Vergleich. Im Kern orientieren sich die gewaltgeschichtlichen Studien zur Revolutionszeit an den Szenarien in Berlin und München, darüber hinaus auch an den Industrieregionen in Mitteldeutschland und im Ruhrgebiet. Aus vergleichend regionalgeschichtlicher Sicht besteht noch großer Forschungsbedarf.113
Insbesondere Dirk Schumanns Habilitationsschrift Politische Gewalt in der Weimarer Republik setzte in dieser Hinsicht schon im Jahr 2001 einen wichtigen Markstein.114 Seine Studie ist insgesamt ein Beleg für die Militarisierung und Gewaltaffinität der politischen Kultur Weimars, und doch argumentierte Schumann insofern in eine ähnliche Richtung wie später Bergien und Keller, als er quellengestützte Befunde zu einem insgesamt „maßvollen Verhalten des Landesjägerkorps, der Einwohnerwehren, der Reichswehr und der Schutzpolizei zwischen 1919 und 1921“ zusammentrug.115 Damit wies er auch die häufig den Einwohnerwehren „zugeschriebene Schlüsselrolle“ zurück, „weite Teile des Bürgertums an die Anwendung auch extralegaler Gewalt gegen die Linke“ gewöhnt zu haben.116 Schumanns empirische Analyse stützte sich vorrangig auf Material mit Aussagekraft für die preußische Provinz Sachsen, die von weniger politischer Gewalt als Berlin, München oder das Ruhrgebiet geprägt war. Diese Vergleichskonstellation sensibilisiert zugleich dafür, nicht leichtfertig einen Teil (eine regionale Ausprägung) für das Ganze (das gesamte Deutsche Reich) zu nehmen.
Schumann strich zudem heraus, dass für die Gräueltaten Anfang der 1920er Jahre vor allem zurückgekehrte ehemalige Baltikumkämpfer die Verantwortung trugen.117 Es ist unstrittig, dass es am Ende des Ersten Weltkriegs in den Randbereichen der alten Reiche der Hohenzollern, Habsburger und Romanovs – beispielsweise im Baltikum – zu besonders vielen und besonders heftigen Gewaltexzessen kam. Staatliche Kontrolle und das Gewaltmonopol existierten dort kaum noch, multi-ethnisches Zusammenleben, das zu imperialer Zeit durchaus funktionierte, galt nunmehr als Bedrohung. Nationale „Reinheit“ kam gleichsam als Kehrseite des Drangs nach „Selbstbestimmung“ und als düster in die Zukunft weisende Losung auf.118
Das Wirken der marodierenden Freischärler im Baltikum war von blutiger Brutalität und Unbedingtheit gekennzeichnet.119 Eine andere Frage ist indes, ob sich die Erkenntnisse über Gewalthandlungen in den Bruchzonen des alten Imperiums ohne weiteres auf die Verhältnisse in den Zentren des Deutschen Reichs während der Revolutionsperiode 1918/19 übertragen lassen. „Eine bewusst brutale und regellose Kriegführung, wie sie vor allem im Baltikum nicht selten anzutreffen war“, taxiert Keller das Verhältnis skeptisch, „konkurrierte insbesondere im Reichsgebiet oftmals mit einer Strategie der kontrollierten militärischen Abschreckung, durch die Gewaltanwendung möglichst vollständig vermieden werden sollte.“120
Diese interregionalen Überlegungen leiten unmittelbar zu transnational vergleichenden Betrachtungen über.121 Sie rücken die deutsche Entwicklung in ein milderes Licht: Die Auswüchse brutaler physischer Gewalt erscheinen verglichen mit anderen Verliererstaaten des Ersten Weltkriegs gering ausgeprägt. Auch widerstand die Weimarer Demokratie trotz des Versailles-Traumas besonders lange einer autoritären Kehre, die sich in vielen Ländern früher vollziehen sollte.122 Wer über die Binnenperspektive der insoweit gemäßigten deutschen Revolution hinausblickt, wird ihre Errungenschaften deutlicher sehen und ihre Versäumnisse weniger stark ins Gewicht fallen lassen.123
Aus dieser vergleichenden Sicht lässt sich ein deutscher Sonderweg der Gewalt von 1918/19 hinein ins „Dritte Reich“ kaum überzeugend konstruieren – einerseits. Andererseits eröffneten sich – auf der Transfer- und Verflechtungsebene – für das länderübergreifende Agieren nationalistischer Paramilitärs neue Möglichkeiten. So paradox dies auf den ersten Blick anmutet, strebten sie nach grenzüberschreitenden Gewaltgemeinschaften mit internationalistischem Anspruch. Dies zeigte sich in besonders eindrücklicher Weise am berühmtesten deutschen Gewaltexekutor der Novemberrevolution: Waldemar Pabst.124 Nach dem Mord an Luxemburg-Liebknecht und dem gescheiterten Kapp-Lüttwitz-Putsch führte ihn sein Weg ins aufgelöste Habsburgerreich zur Stärkung der österreichischen „Heimwehrbewegung“, bevor er Pläne für eine von Antisemitismus und Antibolschewismus angetriebene „Weiße Internationale“ schmiedete.125 Pabsts Erfahrung der Niederlage im Ersten Weltkrieg wirkte als Auslöser einer politischen Radikalisierung, die zunehmend in einer expansiven, nationale Grenzen überwölbenden Erwartungshaltung mündete. Sie verband letztlich eine ganze Reihe deutscher, österreichischer und ungarischer Nationalsozialisten miteinander. Hierin lässt sich in der Tat ein Traditionsstrang erkennen, der von den Freikorps zum Faschismus reichte.126