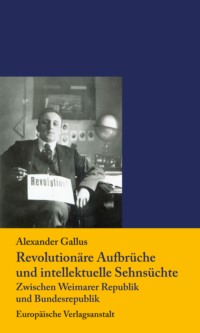Kitabı oku: «Revolutionäre Aufbrüche und intellektuelle Sehnsüchte», sayfa 4
II. Zwei Interpretationslinien
1. Schwierige, letztlich aber erfolgreiche Demokratiebegründung
Für die erste Interpretationsrichtung, das Paradigma der Demokratie, stehen insbesondere die Gesamtdarstellungen von Wolfgang Niess, Robert Gerwarth und jene des Autorenduos Keil/Kellerhoff.22 Niess markiert den Fluchtpunkt seiner Argumentation schon im Untertitel seiner Revolutionsgeschichte deutlich: Der wahre Beginn unserer Demokratie. Nach Keil und Kellerhoff könne man die „Bedeutung der demokratischen Revolution von 1918/19 kaum überschätzen“. Daraus leiten sie gleichsam einen – wenngleich ohne Ausrufungszeichen – interpretatorischen Imperativ ab: „Sie verdient statt Verachtung Lob.“23 Auch Robert Gerwarth stimmt grundsätzlich in diesen Tenor ein, indem er Theodor Wolffs berühmtes Wort von der „größten aller Revolutionen“ für den Titel seiner Synthese aufgreift. Er wahrt Abstand gegenüber dem zeitgenössischen Pathos, hält den Umbruch von 1918/19 gleichwohl für bedeutend. Zur Begründung nennt er das hohe politische wie auch ein beachtliches soziales und kulturelles Veränderungspotenzial sowie das im grenzüberschreitenden Vergleich geringe Niveau der Gewalt. Ihre Ausprägung in den Verliererstaaten des Ersten Weltkriegs ist seit vielen Jahren Gerwarths Leitthema.24 Er sensibilisiert dafür, Revolution in modernen Gesellschaften nicht vorrangig über bewaffnete Aufstände und Barrikadenkämpfe im Sinne performativer Akte zu definieren. Eigentlich revolutionär erscheine die Einführung und Durchsetzung neuer politischer Prinzipien sowie erweiterter Partizipations- und Bürgerrechte.25
In diesem Zusammenhang verdiene Friedrich Ebert als zentraler Akteur besondere Anerkennung. An der Spitze einer unerfahrenen Regierung und unter denkbar ungünstigen Ausgangsbedingungen habe er Beachtliches geleistet. Ihm sei das „Kunststück“ geglückt, die „revolutionäre Energie zu kanalisieren“ und Deutschland in eine parlamentarisch-demokratische Ordnung mit einer liberalen Verfassung zu überführen.26 Ebert bevorzugte den Weg der Reform gegenüber einer grundstürzenden Revolution, die ihn Unordnung und Chaos, gar „russische Verhältnisse“ befürchten ließen. Diese waren seit dem Epochenjahr 1917, als die USA in den Krieg eintraten und eine Avantgarde von Berufsrevolutionären in Russland den Bolschewismus an die Macht beförderte, kein Hirngespinst, sondern eine reale Gefahr. Vor diesem Hintergrund interpretiert Gerwarth das oft zitierte Diktum Eberts von der Revolution, die er wie die Sünde hasse, nicht als Ausdruck konservativer Beharrlichkeit, sondern als Ablehnung einer „kommunistischen Revolution“, die auf Gewalt und die Herrschaft einer Minderheit setzte.27
Eine verzerrende Sichtweise sei auch in der These zu erkennen, Ebert habe mit seiner Begrüßung der Frontsoldaten vor dem Brandenburger Tor am 10. Dezember 1918 mit den Worten „kein Feind hat Euch überwunden“ die „Dolchstoßlegende“ befördert. Eberts Worte seien weder von übersteigertem Nationalismus noch von „Realitätsverlust“ bestimmt gewesen, sondern „Ausdruck seines Bemühens, die Veteranen der Armee für das neue Regime zu gewinnen, was verständlich war angesichts der Gefahren, die von der rechtsnationalen Opposition wie von jenen Linken drohten, die radikale Umwälzungen forderten“.28 Schließlich sei es abwegig, in Absprachen zwischen der Übergangsregierung und der Obersten Heeresleitung – in einem Telefonat zwischen Ebert und dem Ersten Generalquartiermeister Wilhelm Groener am 10. November 1918 – einen „faustischen Pakt“ auszumachen. Dieser Vorgang habe vielmehr einer „pragmatische[n] Übereinkunft“ aus beiderseitig nachvollziehbaren Gründen geglichen.29
Keils/Kellerhoffs Lob der Revolution gründet auf ähnlichen Erwägungen zur Mehrheitssozialdemokratie unter Friedrich Ebert. Ohne sein umsichtiges Agieren wäre in ihren Augen die Geburt der Demokratie in Deutschland von vornherein missglückt. Keine der drei Studien, die in das Zentrum ihrer Interpretation die Begründung der parlamentarischen Demokratie stellen, blendet Gewalthandlungen innerhalb der Novemberrevolution aus. Harte Kritik erfährt insbesondere Gustav Noske, der während der blutigen ersten Jahreshälfte 1919 zum Teil mit unverhältnismäßiger Schärfe gehandelt habe. Mit dem Einsatz von Freikorps zur Abwehr der radikal-linken Bedrohung habe er den überwiegend antirevolutionären und republikfeindlichen Charakter dieser Verbände unterschätzt und durch das brutale Vorgehen das Ziel einer nachhaltigen Befriedung letztlich konterkariert.30
Von der Warte des Jahres 1923 aus, als die Weimarer Republik eine verschärfte Krise zu überstehen hatte, bevor eine Phase relativer Stabilität einsetzte, zieht Gerwarth ein Resümee, in dem er nochmals die dominierende Blickrichtung der ersten Interpretationslinie bündelt: „Von einer ‚gescheiterten‘ oder auch nur ‚halbherzigen‘ Revolution zu sprechen, erscheint aus der Perspektive am Ende dieses Jahres unangemessen: Deutschland hatte […] eine demokratisch legitimierte Regierung, eine liberale Verfassung, die seinen Bürgern weitreichende politische und soziale Grundrechte garantierte, und eine sich spürbar erholende Wirtschaft. […] Extremistische Minderheiten auf der politischen Linken und Rechten waren marginalisiert, ihre Versuche die Republik mit Gewalt zu stürzen, waren gescheitert. […] Am Ende des Jahres 1923 war das Scheitern der Demokratie weit unwahrscheinlicher als ihre Konsolidierung.“31
In den Arbeiten der ersten Interpretationsrichtung dominiert mit Blick auf Periodisierungsfragen, in Anlehnung an die ältere Forschung, die Gliederung der Revolution in zwei Phasen: eine erste friedliche Phase im November und Dezember 1918 und eine zweite gewaltsame Phase ab Januar 1919 mit Höhepunkten während der Berliner Märzkämpfe und der Niederschlagung der bayerischen Räterepublik im Mai 1919.32 Gelegentlich ist für die zweite Periode auch nur von „nachrevolutionären“33 Kämpfen oder Wirren die Rede, nachdem die Revolution an sich bereits vollzogen worden war. Das heißt in der Konsequenz, dass die zweite Phase der Gewalt für einen vergleichsweise kurzen Zeitraum für Unruhe sorgte, im Grunde aber keine geschichtsgestaltende Prägekraft besaß. Für Heinrich August Winkler kennzeichneten die im November und Dezember getroffenen oder in die Wege geleiteten politischen Entscheidungen die eigentlich formative Phase der Revolution, in der Grundlagen für die Weimarer Republik geschaffen worden seien, während der anschließende, von Gewalt geprägte soziale Protest „zu keiner Zeit“ eine Chance auf Mehrheitsfähigkeit besessen habe.34 Nach dieser Lesart kam „Gewalt“ lediglich eine vergleichsweise kurze Nebenrolle zu.
2. Prägende Gründungsgewalt mit fatalen Langfristfolgen
Die zweite Interpretationsrichtung, das Paradigma der Gewalt, wird am stärksten von Mark Jones’ Darstellung Am Anfang war Gewalt argumentativ unterfüttert, daneben auch von Klaus Gietinger und Joachim Käppner.35 Anknüpfend an die Grundthese der Marginalität der Gewalt während der Umbruchsphase 1918/19 arbeitet sich Jones an Winklers Studien zur Revolution ab. Er wirft ihm vor, „entscheidende Teile dessen, was sich damals zutrug, außer Acht“ zu lassen.36 Die Schärfe des Urteils deutet auf das Streben nach einer fundamentalen Revision des Revolutionsbildes hin. Jones’ Studie sticht dabei unter den aktuellen Publikationen heraus, weil sie eine neue Gesamtdeutung der Revolution wie der Weimarer Republik überhaupt – das signalisiert auch der Titel der englischen Originalausgabe Founding Weimar37 – mit intensiver Quellenarbeit verbindet.
Diese Gründungserzählung der Weimarer Republik entfaltet ein Gewaltpanorama, das nicht zuletzt von der neuen mehrheitssozialdemokratisch dominerten Regierung zu verantworten gewesen sei und, unter öffentlich-medialem Flankenschutz, eine nachhaltige Radikalisierung des Meinungsklimas befördert habe. Die genaue Schilderung einzelner Gewaltakte steht bei Jones im Mittelpunkt. Auch ihrer Wahrnehmung und Vermittlung wird viel Aufmerksamkeit geschenkt. Denn an physische Gewalt geknüpfte Ängste, Gerüchte, Panikreaktionen, Perzeptionen und Autosuggestionen sorgten seines Erachtens für die große Reichweite und die politisch-kulturelle Wirkung, die das Thema der Gewalt in und nach der Revolution ausüben sollte.
Dass die Novemberrevolution zu Beginn gewaltfrei geblieben ist, konstatiert auch Jones. Im ersten Revolutionsmonat kam es nur zu wenigen Ausschreitungen, und es waren kaum Todesopfer zu verzeichnen. Panikreaktionen und die Sorge vor einer „Offiziersverschwörung“ motivierten meist zu den frühen vereinzelten Gewaltakten. Eine „Offiziersverschwörung“ habe es dabei nicht gegeben, sie sei ein auf Gerüchten beruhendes „Produkt revolutionärer Mystik“ gewesen.38
Bei der – angesichts jahrelanger blutiger Kämpfe im Weltkrieg erstaunlichen – Friedfertigkeit blieb es aber nicht und sie war auch nicht typisch für das Gepräge und die Auswirkungen dieser Revolution, wie Jones zu zeigen versucht. Einen ersten wichtigen Wendepunkt der Gewalt markierte seiner Wertung nach der 6. Dezember 1918: Damals fielen in Berlin mindestens 16 Menschen einem auch im Nachhinein nicht vollständig aufzuklärenden Maschinengewehreinsatz zum Opfer, als Soldaten des Garde-Füsilier-Regiments, die für die Sicherung des Regierungsviertels zuständig waren, während tumultartiger Zustände auf einen Demonstrationszug von Spartakus-Anhängern und -Sympathisanten an der Kreuzung Invaliden- und Chausseestraße schossen.39 Die „Spirale der Gewalt“, so die regelmäßige Diktion,40 drehte sich ab den Weihnachtstagen, während der Januarunruhen („Spartakusaufstand“), der Märzkämpfe und der Niederschlagung der Münchner Räterepublik im Mai 1919 immer weiter und immer heftiger.
Der Einsatz schweren Geschützes im aufständischen Osten Berlins im März 1919, verbunden mit Gustav Noskes Befehl standrechtlicher Erschießungen, markiert für Jones schließlich einen weiteren, ja den entscheidenden Wendepunkt hin zu „staatlich lizenzierter“, „staatlich gebilligter“, „staatlich verordneter“, „staatlich geförderter“ oder „staatlich legitimierter Gewalt“.41 Ausgelöst wurde das drakonische Vorgehen im Frühjahr 1919 durch die Meldung eines von Spartakisten verübten Massakers an 150 bis 200 Polizisten in Lichtenberg. Dieses Massaker hatte allerdings nicht stattgefunden, wie sich bald herausstellen sollte. Es handelte sich um einen frühen Fall von Fake News mit gravierenden Konsequenzen.42 Die Angst vor dem Bolschewismus, angetrieben von Fehlannahmen und Phantasmagorien, die durch die Propaganda der Roten Fahne freilich befördert wurden, stand in keinem Verhältnis zu seiner tatsächlichen Kraft in Deutschland, war aber folgenreich. Ein regelrechter „Liebknecht-Mythos“ suggerierte den Status eines mächtigen Hohepriesters der Revolution, der diese Rolle gar nicht ausfüllte und weit von einer solchen realen Machtposition entfernt war.43
Umso schärfer fällt die Kritik an der Mehrheitssozialdemokratie aus, die von einem „Herrschaftswillen um jeden Preis“, einem „unbedingten“ oder „absoluten Herrschaftswillen“ geleitet gewesen sei.44 Der sozialdemokratisch geführten Regierung komme danach eine große Mitverantwortung dafür zu, dass die „Novemberrevolution und ihre Nachwehen eine entscheidende Weggabelung auf dem Weg Deutschlands in das dunkelste Kapitel seiner Geschichte“ dargestellt und einen „Inkubationsraum für das Dritte Reich“ bereitgestellt hätten.45 Auch wenn Jones sich gegenüber der These eines zwangsläufigen Scheiterns Weimars verwahrt, betont er abschließend, „dass die dunklen Zeiten der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert nicht erst 1933 oder 1939 begannen“, sondern während der Novemberrevolution und der an sie geknüpften fatalen Gewaltpolitik.46 Aus solcher Deutung geht in aller Klarheit jene Kontinuitätsthese hervor, der zufolge der Umbruch von 1918/19 eher als diktaturgeschichtliche Urszene denn als Ursprung demokratiegeschichtlicher Entwicklungspfade aufzufassen sei.
In dieser Interpretation rückt die blutige Etappe der Revolution ab der Jahreswende 1918/19 in den Mittelpunkt der Betrachtung. Sie wird – gegen Winkler und andere – gleichsam zur formativen, den weiteren Gang der Geschichte besonders prägenden Phase einer Revolution, die auf militärische Gewalt setzte, die kurzfristig die Regierung zu schützen schien, langfristig aber nichts anderes als die Abschaffung der verhassten Republik beabsichtigte. In ebenso fataler wie paradoxer Weise setzte die Regierung Ebert-Scheidemann demnach auf die Unterstützung durch ihre Todfeinde statt auf die eigenen Anhänger, deren Radikalität sie vielmehr im Übermaß fürchtete. Dieses Argument streicht im Übrigen auch Joachim Käppner in seiner aktuellen Revolutionsdarstellung heraus. Er hält die ausgebliebene respektive nicht umgesetzte Militärreform zur Schaffung republikanischer Streitkräfte für „das große Übel der Revolution von 1918/19“, für ihren „Sündenfall“.47 „Die einmalige und auch letzte Gelegenheit vor 1945, dem deutschen Militarismus den Garaus zu machen“, sei verpasst worden. Gegenüber der Ebert’schen Sozialdemokratie formuliert Käppner ein vernichtendes Verdikt, weil an ihr der „Aufstand für Frieden und Freiheit“ gescheitert sei.48
Selbst ohne ausdrückliche Übernahme des Verratsvorwurfs steht die zweite Deutungsrichtung49 in der Tradition Sebastian Haffners. So schreibt Käppner gleich zu Beginn seiner Studie: „Hätte die Ebert-SPD die Massenbewegung genutzt, statt sie zu fürchten, das alte Militär zum Teufel gejagt, statt sich mit ihm zu verbünden, wäre die Republik 1933 wahrscheinlich nicht untergegangen oder wenigstens nicht den Nazis in die Hände gefallen – so der Gedankengang Haffners, und seiner Logik kann man sich schwerlich verschließen.“50 Haffner mag also in gewisser Weise die geistige Vaterschaft für das Paradigma der Gewalt zugesprochen werden.51
III. Gründungsgewalt – eine kritische Re-evaluation
1. Mehrschichtiger Gewaltbegriff zwischen „potestas“ und „violentia“
In Mark Jones’ Werk ist insbesondere von „staatlich lizenzierter Gewalt“ und „staatlich geförderte[r] Gräuel“ der Ebert-Scheidemann-Noske-Regierung die Rede.52 Im englischen Original wird dabei der Begriff „violence“ verwendet, das breitere Bedeutungsfeld des Gewaltbegriffs zwischen „potestas“ und „violentia“ aber nicht aufgespannt.53 Beachtet man das Selbstverständnis der politischen Akteure und ihre Bedrohungswahrnehmungen, so strebten sie nicht oder höchst selten nach brutaler Gewalt, sondern überwiegend nach der Wiederherstellung respektive Durchsetzung von Staatsgewalt – also (im Englischen) nach „power“ und „authority“, nicht aber nach „violence“.
Es gilt mithin, das Problem- und Begriffsfeld zu erweitern, Fragen nach der Wiedergewinnung, Aufrechterhaltung, Wahrnehmung und Übersteigerung von staatlicher Autorität54 in die Betrachtung mit einzubeziehen und beide Begriffsebenen miteinander in Beziehung zu setzen. Für die Sichtweisen der politischen Akteure während der ersten Monate der politisch-gesellschaftlichen Transformation von 1918/19 ergeben sich daraus Fragen, die durch weitere Forschungsarbeit erst noch differenziert beantwortet werden müssen: Wie nahmen sie das Spannungsverhältnis von legitimer Staatsgewalt und willkürlicher physischer Zwangsgewalt wahr? Welche Aussagen lassen sich zur Zweck-Mittel-Relation finden? Wie gestaltete sich das Verhältnis zwischen Legalität und Legitimität auf der einen Seite, zwischen Illegalität und Illegitimität der Gewalt auf der anderen? Wegen des Übergangscharakters der Systemtransformation lassen sich Antworten häufig nicht mit der gewünschten Eindeutigkeit formulieren.
Hinzu kommt selbst im Falle einer für legal und legitim gehaltenen Gewaltausübung die Frage nach der angemessenen Regulierung respektive nach den Überreaktionen von Sanktionsgewalt. Dies betrifft auch Kontrollverluste gegenüber einer situativen Gewaltdynamik. In der Tat ließ sich während der Umbruchszeit in Freikorpskreisen eine „Reduktion des Staatlich-Politischen auf Kampf“ feststellen: unter „Verzicht auf rechtlich-normative Qualifizierungen“.55 Das Verhältnis von Rechtsstaat und Gewaltmonopol befand sich in solchen Konstellationen realiter in einer Schieflage. Die Disbalance hatte eine allgemeinere Ursache, beruht das Gewaltmonopol doch prinzipiell auf der Legitimation der gesamten Rechtsordnung, die in revolutionären Übergangsphasen erst fixiert werden muss, bis eine neue Verfassung für die erforderliche Verrechtlichung sorgt.56
Die von Ebert angeführte Regierung reagierte auf Zustände, die – zumal ihrer Beobachtung und ihrem Empfinden nach – einer bedrohten Ordnung entsprachen und von „multipler Souveränität“ geprägt waren. Für Charles Tilly ist „multiple Souveränität“ ein typisches Merkmal von Revolutionen, gerade zur Erklärung kollektiver Gewaltphänomene.57 Wo Macht – im Sinne von „potestas“ – nicht vorhanden ist oder zumindest herausgefordert wird, kommt Gewalt – im Sinne von „violentia“ – ins Spiel, das wusste schon Hannah Arendt.58 Keineswegs zufällig, sondern vor dem Hintergrund einer in Turbulenzen geratenen Staatlichkeit formulierte Max Weber in seiner berühmten Rede Politik als Beruf Ende Januar 1919, dass der Staat „diejenige menschliche Gemeinschaft [sei], welche innerhalb eines bestimmten Gebietes […] das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit für sich (mit Erfolg) beansprucht“.59 Angesichts dieser klassischen Definition, die den Kontext der Novemberrevolution spüren lässt, hat Dieter Grimm festgestellt, dass es sich bei der Bezeichnung „staatliches Gewaltmonopol“ um einen Pleonasmus handele: „Wo es am Gewaltmonopol fehlt“, so die logische Ableitung im Anschluss an Webers Formel, „besteht kein Staat, sondern entweder ein andersartiger Herrschaftsverband oder Anarchie.“60
Eine solchermaßen juristisch grundierte Vorstellung kam dem bereits über einen längeren Zeitraum gereiften legalistischetatistischen Selbstverständnis der tonangebenden Sozialdemokratie entgegen. Grundsätzlich zielte Ebert auf die Wiederherstellung des Gewaltmonopols als einer zentralen Ordnungs- und Sicherungsleistung des Staates (noch unabhängig von einer spezifischen Staatsform oder demokratischen Legitimation) gegenüber den Angehörigen des Gemeinwesens. Um dies faktisch zu gewährleisten, erfolgten in den frühen Tagen der Revolution Absprachen mit Generalquartiermeister Wilhelm Groener, vor allem aber mit dem für das Heimatheer verantwortlichen preußischen Kriegsminister General Heinrich Scheuch.61
Lange Zeit hatte Ebert „gegen jede Gewaltpolitik“62 argumentiert, er hatte Blutvergießen und einen innerlinken Bruderkrieg vermeiden wollen. Weihnachten 1918 kam es dennoch zu einem von den Mehrheitssozialdemokraten angeordneten Einsatz des Militärs gegen die rebellierende Volksmarinedivision, nicht zuletzt weil Ebert um Leib und Leben des durch die Marinesoldaten gefangengesetzten sozialdemokratischen Berliner Stadtkommandanten Otto Wels fürchtete. Der Einsatz von Regierungssoldaten, auch mangels der Existenz einer eigenen „Volkswehr“, galt den Kritikern Eberts und seiner Regierung als (weiterer) Beweis für ihre Verbündung mit gegenrevolutionären Kräften. Die Kämpfe während der ersten Jahreshälfte 1919 schienen die Stichhaltigkeit dieser Sichtweise zu untermauern. Gleichwohl gerieten dabei die zentralen Motive für das zivil-militärische Bündnis aus dem Blick, nämlich die „Wahrung der Autorität“63 – eben des staatlichen Gewaltmonopols – und die Sicherung einer tatsächlich bedrohten republikanischen Regierung.64
Es steht außer Frage, dass dieses Ansinnen – die legitime Anwendung von Gewalt auf dem Weg zur Schaffung eines demokratisch-rechtsstaatlichen Gewaltmonopols konsequent durchzusetzen65 – im Prozess der Umsetzung insgesamt missglückte. Falsche Partner, die mangelnde Verhältnismäßigkeit der Mittel, aber auch die Unsicherheit der eigenen Rollenbestimmung – mal als legitime Regierung, mal als Bürgerkriegspartei – erschwerten die erfolgreiche und konsensuale Verwirklichung eines grundsätzlich legitimen Bestrebens zur Erfüllung einer Grundbedingung moderner Staatlichkeit. Diese Konstellation und das Gefühl, in die Defensive gedrängt zu sein, führten zu mancher Überreaktion. Prominent ist in dieser Hinsicht die Formulierung des Regierungsaufrufs vom 8. Januar 1919: „Gewalt kann nur mit Gewalt bekämpft werden. […] Die Stunde der Abrechnung naht.“66 Aus diesen Worten sprach stärker die Bürgerkriegspartei als die staatliche Befriedungsmacht. Es zeigt sich erneut, wie widersprüchlich miteinander verflochten das an sich legitime Streben nach „auctoritas“/„potestas“ und illegitime Handlungen im Sinne von „violentia“, von Willkür- und Gewaltherrschaft bisweilen waren.