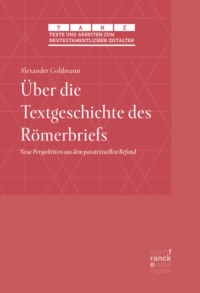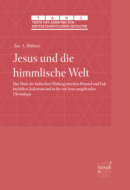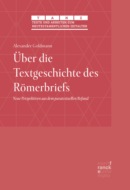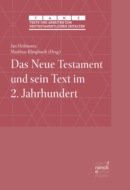Kitabı oku: «Über die Textgeschichte des Römerbriefs», sayfa 5
3.3. Die altlateinischen Prologe der Paulusbriefe
Ein weiteres paratextuelles Phänomen, das gerade für die Erforschung der Textgeschichte des Römerbriefes von großer Bedeutung ist, sind die Prologe. Sie spielen darüber hinaus für die Frage nach Umfang und Reihenfolge des marcionitischen Apostolos, vor allem aber für seine Stellung in der Genese des Corpus Paulinum, eine wichtige Rolle.
Prologe zu den einzelnen biblischen Büchern tauchen häufig in der lateinischen Bibelüberlieferung auf, wo sie auch als argumenta bezeichnet werden. Das bemerkenswerteste Merkmal der Prologe zu den Paulusbriefen, um die es in der vorliegenden Untersuchung gehen soll, ist dabei nicht ihr brillanter theologischer Inhalt. Es ist auch nicht die ausgefeilte Sprache, welche die Texte auszeichnet. Tatsächlich geht es wiederum um die Hinweise, welche sie auf die Briefsammlung geben, auf die sie zurückgehen bzw. für die sie ursprünglich angefertigt wurden. Genau darin begründet sich die Relevanz der Prologe für die vorliegende Arbeit, denn es wird gezeigt werden, dass die altlateinischen Prologe einen von Marcions Apostolos unabhängigen Beleg für die 10-Briefe-Sammlung der Paulusbriefe darstellen.1
Wahrscheinlich waren die Prologe ursprünglich als eine Art zusammenhängende Einführung zu einer Sammlung paulinischer Briefe verfasst. Oft ist von einer Prologreihe die Rede. Dafür spricht, dass die einzelnen Prologe textlich eng miteinander verklammert erscheinen. So finden sich darin diverse Rückbezüge auf bereits Erwähntes, die sich dem Leser um einiges besser erschließen, wenn die argumenta hintereinander gelesen werden.2 In der handschriftlichen Überlieferung tauchen die Prologe als kurze Vorworte auf, die den einzelnen Briefen vorangestellt sind. Sie lassen sich sowohl in Vulgatahandschriften als auch in der altlateinischen Überlieferung finden. In Analogie zu den Kapitellisten deutet ihr Text wiederum auf einen altlateinischen Ursprung hin.3 Die älteste handschriftliche Bezeugung im Rahmen der neutestamentlichen Manuskripte findet sich im Codex Fuldensis4 (Vg F), einer Vulgatahandschrift des 6. Jahrhundert, als ältester indirekter Beleg gilt Marius Victorinus, dessen Kommentare zu den Paulusbriefen aus der Mitte des 4. Jahrhunderts die Kenntnis der Prologe voraussetzen.5 Eine ausführliche Analyse zur handschriftlichen Bezeugung der Prologe liefert DAHL,6 der eigentliche Text der Prologe mitsamt eines kritischen Apparates findet sich zuerst bei CORSSEN.7
Ihre ehemals gängige Bezeichnung als Marcionitische Prologe (= Prol Ma) verdanken sie den wegweisenden Studien von Donatien de BRUYNE8 und Peter CORSSEN,9 die unabhängig voneinander10 den marcionitischen Ursprung der argumenta zu den Paulusbriefen nachweisen wollten. Als Beleg ihrer Theorie führten de BRUYNE und CORSSEN sowohl formale als auch inhaltliche Überlegungen ins Feld. Einerseits rekonstruierten sie die ursprüngliche Reihenfolge (zumindest in den entscheidenden Teilen) der argumenta, die sich mit der von Tertullian und Epiphanius für Marcion bezeugten Anordnung der Briefe in dessen Apostolos deckte. Andererseits schien ihnen auch das in den Prologen entfaltete Paulusbild, gleichsam das inhaltliche Profil, für eine marcionitische Verfasserschaft derselben zu sprechen.
Die Tragweite und Überzeugungskraft dieser „epochemachend[en]“11 Entdeckung wird unschwer deutlich, führt man sich vor Augen, wie zahlreich und zeitnah die Reaktionen darauf erfolgten. In England erfuhr die Theorie unmittelbar Zustimmung von HARRIS (1907)12 und WORDSWORTH und WHITE (1913),13 in Deutschland waren es zunächst HARNACK (1907),14 ZAHN (1910)15 und LIETZMANN (1919),16 welche den marcionitischen Ursprung der Prologe für „eine ausgemachte Sache“17 bzw. als consensus doctorum18 erachteten.
Die marcionitische Verfasserschaft der argumenta wurde als Erstes von MUNDLE (1925) in Frage gestellt.19 Dessen Studie kommt zu dem Resultat, „daß alles, was in den Prologen als marcionitische Anschauung […] gemeinhin angenommen ist, im Rahmen altkatholischer Paulusauslegung auch möglich war.“20 Konkret weist MUNDLE hier auf den Pauluskommentar des Ambrosiaster hin, den er sogar als literarische Vorlage der argumenta identifiziert.21 Wenngleich HARNACK MUNDLEs Einwände umgehend zurückwies,22 mehrten sich in der Folge diejenigen Positionen, welche den marcionitischen Ursprung der argumenta bezweifelten. So votierten FREDE (1964),23 REGUL (1969),24 FISCHER (1972)25 und GAMBLE (1977)26 dagegen, Marcion (bzw. einen Marcioniten) als Verfasser der Prologe zu betrachten. Eine innovative und überaus beachtenswerte Arbeit lieferte Nils Alstrup DAHL 1978.27 Auch er verneint die Annahme einer marcionitischen Verfasserschaft, verschiebt dabei aber erstmals die Perspektive der Untersuchung auf die dahinter liegende Briefsammlung, auf welche die Prologe zurückgehen. DAHLs Lösungsansatz wirkte für viele nachfolgende Studien richtungsweisend, sodass auch CLABEAUX (1989),28 SCHMID (1995)29 und EPP (2004)30 dagegen stimmten, die Prologe als marcionitisch zu verstehen.
Dieser Konsens ist in letzter Zeit allerdings wieder kritisiert worden, wie ein Blick auf die jüngsten Forschungen zum Thema belegt. SCHERBENSKE (2013),31 VINZENT (2014)32 und JONGKIND (2015)33 kommen übereinstimmend zu dem Fazit, sie als marcionitisch zu verstehen, ja sogar als „the rediscovered and recovered work of Marcion himself.“34
Nach diesem knappen Abriss der bisherigen Forschungsgeschichte wird es im Folgenden darum gehen, die Relevanz der Prologreihe im Rahmen der vorliegenden Arbeit ausführlicher aufzuschlüsseln. Auch die Frage der Verfasserschaft der kompletten Serie muss aufs Neue diskutiert werden. Bis dahin wird in der vorliegenden Studie die neutrale Bezeichnung altlateinische Paulusprologe (statt marcionitische Prologe) verwendet.
3.3.1. Reihenfolge
Das auffälligste Spezifikum der Prologe ist zweifellos ihre Reihenfolge. Zwar tauchen die Prologe in allen Handschriften, in denen sie zu finden sind, in der kanonischen Reihenfolge auf, d.h. in derjenigen Reihenfolge, in der auch die tatsächlichen Briefe zu lesen sind, für die sie gleichsam als Vorworte fungieren. Studiert man jedoch den genauen Wortlaut der Prologe, so fällt schnell auf, dass einige argumenta Rückbezüge enthalten und an zuvor Erwähntes anknüpfen. Liest man die Prologe also hintereinander, so treten diese Verklammerungen recht offen zutage und legen es tatsächlich nahe, dass die Prologe ursprünglich als kohärenter Text verfasst wurden. Allerdings stimmt die Reihenfolge der argumenta, die sich aus ihrem Inhalt und den besagten Rückbezügen ergibt, nicht mit der Reihenfolge der kanonischen Briefe überein, denen sie beigegeben sind.
Um festzustellen, welche Reihenfolge die Prologe bzw. die Briefsammlung originär hatte, für die sie ursprünglich verfasst worden sind, soll zunächst der Prolog zum ersten Korintherbrief in den Blick genommen werden. Dabei stellt sich die Frage, wie die Wendung et hi similiter zu verstehen ist – mit wem werden die Korinther hier gleichgesetzt? Auf wen ist dieser Rückbezug ausgerichtet? Die Römer können nicht gemeint sein, denn diese haben das Evangelium nicht von Paulus verkündet bekommen – das macht bereits der Prolog zum Römerbrief selbst deutlich, in dem davon die Rede ist, dass die römische Gemeinde auf das Wirken von falschen Aposteln zurückgeht (nicht also auf Paulus). Dagegen betont der Prolog zum Galaterbrief explizit, dass die Galater das Evangelium zuerst (!) von Paulus empfangen haben (primum ab apostolo acceperunt). Der Galaterprolog muss also erstens (sehr wahrscheinlich direkt) vor dem an die Korinther gestanden haben und zweitens führte er mit einiger Sicherheit auch die Sammlung an.
Weiterhin verwirrt im Prolog zum Brief an die Kolosser die im Eingangssatz zu lesende Wendung et hi sicut Laudicenses sunt Asiani. In der handschriftlichen Überlieferung geht dem Kolosserprolog der Prolog zum Brief an die Philipper voran. Bei den Philippern handelt es sich allerdings nicht um Asiani, sondern um Macedones. Stattdessen muss dem Kolosserprolog ursprünglich (unmittelbar) ein Prolog vorangegangen sein, der ebenfalls Asiani als Adressaten nennt – wahrscheinlich ist hier an eben jene im Kolosserprolog erwähnten Laodizener zu denken, da diese (neben den besagten Kolossern) im gesamten Prologkorpus die einzigen Asiani sind.1
Zuletzt erwähnt der Prolog zum Philipperbrief, dass auch (!) die Philipper Macedones sind (Philippenses ipsi sunt Macedones).2 Da im Rahmen der Prologe allein die Thessalonicher noch als Macedones vorgestellt werden, heißt das auch hier, dass – entgegen der kanonischen Reihung der beiden Briefe – der Philipperprolog ursprünglich nach dem Thessalonicherprolog zu lesen war.
Für die altlateinischen Prologe ergeben sich also folgende Eckpunkte bzgl. ihrer ursprünglichen Reihenfolge:
1 Der Prolog zum Galaterbrief stand unmittelbar vor dem Korintherprolog und eröffnete mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Sammlung.
2 Direkt vor dem Kolosserprolog war mit einiger Sicherheit der Prolog zu einem Brief an die Laodizener zu lesen.
3 Der (oder die) Prolog(e) zu den Thessalonicherbriefen fand(en) sich vor dem Philipperprolog.
All diese Schlussfolgerungen wurden in der Forschungsgeschichte zu den altlateinischen Paulusprologen zu keiner Zeit widerlegt. Zwar unternahm MUNDLE einen solchen Versuch, konnte allerdings nicht überzeugen.3 Nichtsdestoweniger weist er zu Recht darauf hin, dass die mutmaßliche Reihenfolge der Prologe noch lange nicht als zwingender Beweis für die marcionitische Verfasserschaft derselben gelten kann.4 Dennoch bleibt zunächst festzuhalten: die von den Prologen vorausgesetzte Reihenfolge der Paulusbriefe entspricht genau derjenigen, die anhand Tertullians und Epiphanius’ Zeugnis auch für den marcionitischen Apostolos gesichert scheint.5
3.3.2. Umfang
Die nachfolgenden Überlegungen geschehen unter der weithin vertretenen Annahme, dass die Prologe ursprünglich als ein zusammenhängender Text, also eine Art Einleitung zu einer Sammlung von Paulusbriefen, entstanden sind. Fragt man nach dem originalen Umfang dieser altlateinischen Prologreihe, sind die Positionen weniger einhellig als bzgl. ihrer Reihenfolge. Folgende Probleme sind zu klären: Setzt die Prologreihe für die ursprünglich dahinter stehende Briefsammlung einen Brief an die Laodizener oder an die Epheser voraus? Sind die Prologe zu den Pastoralbriefen sekundär? Existierten ursprünglich auch Prologe zu 2 Kor und 2 Thess oder gab es jeweils nur einen Prolog zu den Korinther- bzw. Thessalonicherbriefen? In Hinblick auf den eigentlichen Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist v. a. danach zu fragen, welche Version des Römerbriefes die Prologe voraussetzen. Für die Frage nach der marcionitischen Verfasserschaft der argumenta sind die genannten Fragen von einiger Bedeutung – denn Marcions Apostolos beinhaltete bekanntlich einerseits keine Pastoralbriefe, las andererseits den (kanonischen) Epheserbrief unter dem Titel Πρὸς Λαοδικέας und enthielt – wie später noch gezeigt wird – eine weitaus kürzere Version des Römerbriefes, in welcher u. a. die letzten beiden Kapitel fehlten.1
Hinsichtlich der Frage nach dem Epheserprolog gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, wie der Textbefund zu deuten ist: Einerseits wird damit gerechnet, dass in der Prologreihe dem Kolosserprolog ursprünglich ein Prolog zu einem an die Laodizener gerichteten Brief voranging. Dieser Laodizenerprolog sei heute allerdings nicht mehr vorhanden, da er komplett durch einen (die Epheser als Adressaten nennenden) Prolog ersetzt wurde. Dieser Epheserprolog taucht heute in allen Manuskripten auf, in denen die argumenta zu lesen sind.2 Eine andere, damit in enger Beziehung stehende Auffassung ist die, dass im uns bezeugten Epheserprolog allein die Bezeichnung der Adressaten geändert wurde – ursprünglich wurden im Prolog also die Laodizener als Briefempfänger genannt (und nicht die Epheser).3 Die dritte Meinung geht davon aus, dass der heute in allen Handschriften, welche die Prologreihe bezeugen, zu lesende Epheserprolog in unveränderter Form dem Kolosserprolog vorausging.4 Wie bereits im vorangegangenen Unterkapitel dargelegt, spricht der Wortlaut des Prol Kol allerdings klar gegen die letztgenannte Möglichkeit. Folglich kann man mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass in der originalen Prologreihe entweder ein gänzlich anderer Prolog auftauchte oder aber der heute bekannte Prol Eph ursprünglich als Adressaten die Laodizener (und eben nicht die Epheser) nannte. Beide Möglichkeiten deuten also auf eine Briefsammlung, die statt des Briefes an die Epheser einen Brief an die Laodizener beinhaltete. DAHL resümiert treffend: „Yet it is more likely than not that the original prologue had the Laodicean adress.“5 Zu diesem Schluss kommt auch FLEMMING,6 der in seiner Studie zur Textgeschichte des Epheserbriefes die dargelegte Problematik der Adresse ausführlich thematisiert.7
Auch die Frage nach der Ursprünglichkeit der Prologe zu den Pastoralbriefen ist einerseits von unmittelbarer Bedeutung für die Annahme der marcionitischen Verfasserschaft der argumenta, denn bekanntlich waren die Pastoralbriefe in Marcions Apostolos nicht enthalten.8 Andererseits ist die Frage auch für die Erforschung der Textgeschichte der kanonischen Paulusbriefsammlung von großer Wichtigkeit, denn es gilt zu klären, ob mit den Prologen – neben dem marcionitischen Apostolos – ein weiterer Beleg für eine Briefsammlung existiert, welche die Pastoralbriefe nicht beinhaltete.
De BRUYNE und CORSSEN entwickelten unterschiedliche Lösungsansätze, das Vorhandensein der Prol Past zu erklären und gleichzeitig am marcionitischen Ursprung der Prologe insgesamt festzuhalten. So nimmt de BRUYNE – im Vergleich mit den argumenta zu den Gemeindebriefen – Differenzen in Stil und Ausdruck wahr, die ihn zu dem Schluss führen, sie als spätere, katholische Zusätze zu verstehen. HARNACK folgt ihm dabei in seinen frühen Studien zu den Prologen und konstatiert „einen ganz anderen Charakter“9 der Prol Past.
Auf der anderen Seite bereitet es CORSSEN einige Probleme, wegen der Formulierung im Prolog zum Titusbrief hereticis vitandis qui in scripturis Iudaicis credunt10 hier tatsächlich einen katholischen Ursprung anzunehmen. Seine Alternativerklärung ist gleichsam wegweisend – v. a. für die zahlreichen Studien, die HARNACK in der Folge zur Marcionforschung tätigte: Die Prologe zu den Pastoralbriefen „bezeugen dann vielmehr eine gewisse, wie mir scheint durchaus glaubwürdige, Rückwirkung des katholischen Kanons auf den marcionitischen.“11 Konkret heißt das, dass sich die Marcioniten nicht immer ablehnend gegenüber den Pastoralbriefen verhalten haben müssen, sondern sie ab einem gewissen Zeitpunkt anerkannten und auch in ihre Bibel aufnahmen.12 CORSSEN und HARNACK erachten also die Prol Past nicht als sekundär – zumindest nicht als katholische Ergänzung – und müssen gleichzeitig nicht von der Annahme der marcionitischen Verfasserschaft der Prologe abrücken.
FREDE, der die Annahme der marcionitischen Verfasserschaft der argumenta ablehnt, begnügt sich damit, die Schwachstellen der beiden genannten Erklärungen darzulegen. So weist er darauf hin, dass die von de BRUYNE ins Feld geführten Differenzen zwischen den Prologen zu den Gemeindebriefen und denen der Pastoralbriefe in erster Linie auf die andersartige Thematik und Charakteristik der Texte selbst zurückzuführen seien. Andererseits fehle für die Annahme HARNACKS, dass die Pastoralbriefe zu irgendeiner Zeit doch Teil der marcionitischen Bibel waren, jeglicher Beweis, sodass dies als reines Hilfsargument entlarvt werden könne.13
Doch ist damit tatsächlich die Ursprünglichkeit der Prol Past bewiesen? Mitnichten – wie DAHL überzeugend darlegen kann. Dieser verfolgt hierfür einen konsequent formkritischen Ansatz14 – mögliche inhaltliche Tendenzurteile müssen somit nicht bemüht werden. Rein formal betrachtet, identifiziert DAHL verschiedene Typen innerhalb des Prologkorpus.15 Demnach sind die Prologe zu Gal, 1 Kor, Rom, 1 Thess, „Eph“, Kol und Phil – da sie einem gemeinsamen formalen Muster folgen und einen stereotypen Wortschatz aufweisen – klar von denen an 2 Kor, 2 Thess, Phlm, 1/2 Tim und Tit abzugrenzen. Wie schon de BRUYNE kommt DAHL abschließend zu dem Ergebnis, dass das ursprüngliche Prologkorpus auf eine sieben Briefe umfassende Sammlung zurückgeht.
Die vorliegende Arbeit kann dies allerdings nicht teilen. Denn aus textpragmatischer Perspektive fällt auf, dass fast alle Prologe inhaltlich dazu dienen, a) die jeweilige Adressatengemeinde vorzustellen und geographisch zu verorten, b) die Einstellung der Gemeinde zum Glauben allgemein, zum Evangelium bzw. zum Verfasser selbst (Paulus) zu beschreiben sowie c) Informationen zur Abfassungssituation des Briefes zu liefern. Letzteres beinhaltet stets den Ort, von wo aus der Brief verfasst wurde, sowie, falls der tatsächliche Brief hierfür Anhaltspunkte liefert, die Nennung des Briefboten. Suggeriert die Brieflektüre eine Abfassung in Gefangenschaft, wird auch dies stets in dem entsprechenden Prolog erwähnt – so in den Prologen zu Epheser, Philipper, Kolosser und Philemon.
Diese Bausteine finden sich in allen vorliegenden Prologen wieder, allein die Prologe zu den Pastoralbriefen scheinen an den genannten Charakteristika kein Interesse zu haben und folgen somit nicht dem üblichen Muster.16 Für den ersten Timotheusbrief mag das vielleicht nicht überraschen, finden sich doch im Brieftext nicht wirklich ausreichende Hinweise, die hier Rückschlüsse erlauben würden.17 Verwunderlich ist dagegen, dass der Prolog zum 2 Tim nicht auf einen Gefängnisaufenthalt des Paulus im Moment der Abfassung hinweist.18 Auch hinsichtlich des Abfassungsortes ließen sich anhand des Brieftextes zumindest Spekulationen anstellen,19 doch auch hierüber verliert der Prolog kein Wort. Gleiches gilt für den Prolog zum Titusbrief, der weder Nikopolis als Abfassungsort noch Tychikus als Briefboten nennt, obwohl ein Prologverfasser, der an solcherlei Informationen überaus interessiert zu sein scheint, dies doch in gewisser Weise aus dem Brief herauslesen könnte.20
Stattdessen lesen sich die Prologe zu den Pastoralbriefen schlicht als Inhaltsangabe, in welcher die im Brief behandelten Themen in äußerster Knappheit genannt werden. Dieser grundsätzliche Unterschied hinsichtlich dessen, was der jeweilige Prologtext tatsächlich beschreiben bzw. welche Informationen er dem Leser mitteilen will, erlaubt es, die Prologe zu den Pastoralbriefen klar und sauber von den übrigen zehn Prologen abzugrenzen. Mit einiger Wahrscheinlichkeit sind sie gesondert verfasst worden und stellen somit einen sekundären Zusatz der ursprünglichen Prologsammlung dar.
Wie aber verhält es sich mit den Prologen zum 2. Korintherbrief und zum 2. Thessalonicherbrief? SCHERBENSKE meint, sie aus dem ursprünglichen Prologkorpus ausschließen zu müssen, da sie sich sowohl formal als auch hinsichtlich ihres Umfangs signifikant von den übrigen Prologen unterscheiden.21 Dies liegt allerdings in der Natur der Sache: Wie schon zuvor erwähnt, ist ein zentraler Zweck der Prologe die geographische Einordnung der Adressatengemeinden sowie die Beschreibung des Verhältnisses der Gemeinden zu Paulus. Dass die Prologe zu 2 Kor und 2 Thess hier nicht einfach bereits in den jeweils vorangehenden Prologen Beschriebenes wiederholen wollen und damit insgesamt um einiges kürzer als diese sind, ist absolut verständlich. Es ist also nicht schlüssig, sie aus den genannten Gründen als sekundär zu betrachten.
Eine andere Beobachtung wiegt dagegen schwerer. So lässt sich zeigen, dass sich der Prolog zum 1 Kor offenbar auf den Inhalt beider (!) Korintherbriefe bezieht.22 Die gleiche Beobachtung ergibt sich für den Prolog zum ersten Thessalonicherbrief.23 Daher ist es in der Tat vorstellbar, dass ursprünglich jeweils nur ein Prolog zu den Korinther- und Thessalonicherbriefen existierte.24 Für die vorliegende Arbeit ist diese Schlussfolgerung allerdings unerheblich. Denn die Beobachtung, dass die Prologe zu 1 Kor und 1 Thess inhaltlich jeweils beide Briefe abdecken, untermauert nur die Tatsache, dass die hinter den Prologen stehende Briefsammlung sowohl zwei Korinther- als auch zwei Thessalonicherbriefe umfasste.
Festzuhalten bleibt demnach zunächst: Das originale Prologkorpus bestand aus zehn (möglicherweise auch aus acht) argumenta zu paulinischen Gemeindebriefen und zwar in der folgenden Anordnung: Gal, 1 (2) Kor, Röm, 1 (2) Thess, Laod, Kol, (Phlm), Phil, (Phlm). Daraus ergibt sich folgendes Zwischenfazit: Sowohl Reihenfolge als auch Umfang der den altlateinischen Paulusprologen zugrunde liegenden Texte entspricht dem, was die Häresiologen auch für den marcionitischen Apostolos bezeugen. Es handelt sich um eine Briefsammlung, die aus zehn Briefen besteht und die sich in ihrer Reihenfolge signifikant von der 14-Briefe-Sammlung unterscheidet. Doch muss man aufgrund dieser eben genannten Erkenntnis notwendigerweise auch Marcion (bzw. einen Marcioniten) als Verfasser der Prologe betrachten?