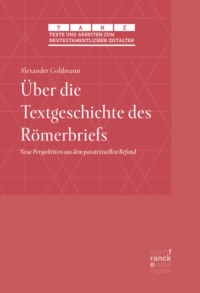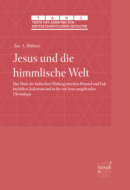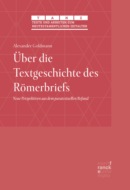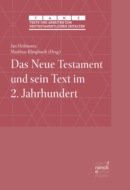Kitabı oku: «Über die Textgeschichte des Römerbriefs», sayfa 6
3.3.3. Verfasserschaft
Wie schon zuvor erwähnt, thematisieren die argumenta inhaltlich – neben einer geographischen Einordnung der Adressaten, Anmerkungen bzgl. Abfassungsort und -situation sowie Boten der jeweiligen Briefe – v. a. die Konflikte zwischen Paulus und seinen Gegnern im Rahmen seiner Missionstätigkeit in den verschiedenen Gemeinden. Dass diese Perspektive tatsächlich als eine Art Verständnisschlüssel der paulinischen Briefe (insbesondere Gal, Kor und Rm) angesehen werden kann, scheint unstrittig; allerdings ist das noch nicht exklusiv marcionitisch. HARNACK ist hier freilich anderer Meinung. Für den Verfasser der argumenta wäre demnach allein „der Gegensatz des richtigen Evangeliums und eines falschen und deshalb der Gegensatz zwischen ‚dem Apostel‘ [scil. Paulus] und den Pseudoaposteln das Thema […]. Wer aber so formuliert, ist Marcionit.“1 Er bemerkt weiterhin, dass die Unterscheidung zwischen richtigem und falschem ‚Wort‘ als Hauptthema der Gemeinden „lediglich von außen herangebracht und […] schlechterdings nicht aus diesen [scil. den paulinischen Briefen] selbst abstrahiert werden [kann].“2
Dass ein solches Verständnis der paulinischen Schriften tatsächlich nicht notwendigerweise als exklusiv marcionitisch zu verstehen ist,3 sondern auch im Rahmen einer frühkatholischen Paulusexegese möglich erscheint, belegen die vielfältigen inhaltlichen Berührungspunkte der argumenta mit den Pauluskommentaren von Marius Victorinus, Ambrosiaster und Pelagius. So wies bereits ZAHN auf die Nähe zwischen den altlateinischen Paulusprologen und dem Pauluskommentar des Ambrosiaster hin.4 MUNDLE widmet sich dieser Abhängigkeit in aller Ausführlichkeit und kommt letztlich zu folgendem Ergebnis:
„Alle unsere Erwägungen führen also zu dem Resultat, daß die Zurückführung der Vulgataprologe [!] auf den Marcionitismus einer kritischen Prüfung nicht standhält. Der Nachweis, daß alles, was in den Argumenten als marcionitische Anschauung seit de Bruynes und Corssens Untersuchungen gemeinhin angenommen ist, im Rahmen altkatholischer Paulusauslegung auch möglich war, ist durch den Vergleich mit Ambrosiaster erbracht worden.“5
Natürlich schließen diese Parallelen einen marcionitischen Ursprung der Prologe nicht aus – allerdings erschüttern sie die Ausschließlichkeit, mit der HARNACK hier einen Marcioniten die Feder führen lassen wollte.6
Dass diese beschriebene Thematik der Prologe alles andere als zwingend auf Marcion verweist, machte DAHL deutlich, indem er die Möglichkeit ins Gespräch brachte, Ignatius als Verfasser der Prologe zu verstehen, da dieser in ein ähnliches Szenario der Auseinandersetzung mit „Judaizers and other Heretics“7 verwickelt war, welches auch als inhaltliches Leitschema der altlateinischen Prologe erkennbar ist. Diese Möglichkeit datiert den Ursprung der Prologe ins 2. Jahrhundert, also in die Zeit, in der auch die 10-Briefe-Sammlung ihre ersten nachweislichen Spuren hinterlassen hat.
Zuletzt erneuerte SCHERBENSKE die von HARNACK vertretene Position, indem er Marcion als den nächstliegenden und bekanntesten Kandidaten ansieht, der für die Verfasserschaft der Prologe in Frage käme.8 Aufgrund eines Mangels an Alternativen zu einer solchen Schlussfolgerung zu gelangen, scheint mir an dieser Stelle jedoch nicht statthaft.9 Es bleibt daher vorerst festzuhalten, dass die Prologe sowohl inhaltlich als auch stilistisch keinerlei Merkmale aufweisen, die zwingend auf ihren marcionitischen Ursprung hindeuten.10 Allein aufgrund inhaltlicher Aspekte wären de BRUYNE und CORSSEN wohl kaum zu dem Ergebnis gekommen, sie als marcionitisch anzusehen.11
Darüber hinaus zeigt sich ein schwerwiegendes überlieferungsgeschichtliches Problem: Sollten die Prologe tatsächlich auf Marcioniten zurückgehen, wie (und wann) hätten sie dann bedenkenlos in zahlreiche katholische Bibelausgaben übernommen und somit für rechtgläubig erklärt werden können? HARNACKS Lösung muss hierfür als äußerst problematisch erachtet werden: Dieser datiert die Paulusprologe bzw. ihr partielles Eindringen in den Text des Corpus Paulinum bereits in die zweite Hälfte des 2. Jh., da sie dem Verfasser des Muratorischen Fragments vorlagen.12 Der Behauptung des Eindringens tatsächlich marcionitischer Prologe in den katholischen Paulustext zu einem solch frühen Zeitpunkt, zu dem – wie das Zeugnis der Häresiologen unschwer erkennen lässt – die Auseinandersetzung mit der marcionitischen Kirche in vollem Gange war, muss mit größter Skepsis begegnet werden. Besonders pointiert formuliert FREDE:
„Ob man aber schon im letzten Viertel des 2. Jahrhunderts, als der Kampf gegen den Marcionitismus seinen Höhepunkt erreichte, wirklich marcionitische Prologe, von deren Existenz Tertullian um 215 offenbar nichts weiß, ohne den geringsten Argwohn in eine katholische Paulusbriefausgabe hat übernehmen können, ist eine Frage, die sich wohl nur mit einem ungewöhnlichen Maß an Kühnheit positiv beantworten läßt.“13
Gleichzeitig lässt wiederum die Bezeichnung der Adressaten des „Epheserbriefes“ als Laodizener sowie v. a. die weite Verbreitung der altlateinischen Paulusprologe in der handschriftlichen Überlieferung auch eine Spätdatierung – etwa gegen Ende des 4. Jh.14 – überaus unwahrscheinlich erscheinen.15
Die fehlende Plausibilität der Antwort HARNACKs ist offenkundig, sodass die späteren Advokaten eines marcionitischen Ursprunges der Prologe die eben zitierte Frage FREDEs entweder ignorieren oder aber einräumen, dass sie das Problem nicht lösen können. So formulierte schon BLACKMAN in wünschenswerter Deutlichkeit:
„Nevertheless [scil. trotz des Schweigens Tertullians über die Prologe in Adv. Marc. 5], the supposition of an early origin is necessary to explain the wide dissemination of the prologues in the West. It is one of the paradoxes of history [!] that these prologues were taken up into the Catholic New Testament and their motif unrecognized.“16
Zuletzt stellt auch JONGKIND die Frage, wie diese Prologe dann eigentlich (trotz ihres angeblich häretischen Hintergrunds) Einzug in die lateinische Texttradition gehalten haben konnten bzw. so lange in dieser überlebt haben. Seine bezeichnende Antwort lautet: „we simply do not know how […].“17
Nimmt man nun von der Annahme des marcionitischen Ursprungs der altlateinischen Paulusprologe Abstand und versteht sie stattdessen als Beleg für die Existenz einer nur zehn Briefe umfassenden Edition von Paulusbriefen,18 löst sich das zuvor beschriebene Paradoxon (BLACKMAN) elegant in Luft auf: Die weite Verbreitung der argumenta innerhalb der lateinischen Textüberlieferung basiert nicht auf der Missachtung bzw. der der zeitlichen Distanz geschuldeten Blindheit bzgl. ihres häretischen (marcionitischen) „Pferdefuß[es]“19 – sie hatten schlicht nichts Häretisches an sich. Tertullian hatte demnach auch gar keine Veranlassung, sich im Rahmen seiner Auseinandersetzung mit Marcions Apostolos mit den Prologen zu beschäftigen, denn sie waren mit einiger Wahrscheinlichkeit auch Teil der ihm geläufigen Bibel. JONGKINDs Einschätzung, eine frühe, unbekannte Sammlung von Paulusbriefen anzunehmen stelle keinerlei Vorteil dar,20 da sie keine forschungsgeschichtlichen Probleme lösen könne, ist folglich in keiner Weise nachzuvollziehen. Tatsächlich ist die Briefsammlung, auf die die altlateinische Prologreihe mit großer Wahrscheinlichkeit ursprünglich zurückgeht, alles andere als unbekannt, sondern wird u. a. durch Marcions Apostolos bezeugt.
3.3.4. Die altlateinischen Prologe und die Überlieferungsgeschichte des Corpus Paulinum
Die bisherigen Studien zu den altlateinischen Paulusprologen kreisten in erster Linie um die Frage, ob sie marcionitischen Ursprungs sind oder nicht. Die Konzentration auf diesen Fragehorizont erscheint jedoch unangebracht. So haben die vorangegangenen Überlegungen deutlich gemacht, dass die notwendigen Kriterien, die in dieser Frage zu einer validen Entscheidung führen könnten, gar nicht erfüllt werden können. Zwar entspricht die den Prologen zugrunde liegende Paulusbriefsammlung formal – d.h. in Reihenfolge und Umfang – dem marcionitischen Apostolos. Dagegen musste festgestellt werden, dass der Textbefund inhaltlich nicht wirklich ausreicht, um eindeutig auf eine marcionitische Verfasserschaft zu schließen – die frühkatholischen Pauluskommentare machen deutlich, dass eine ähnliche Paulusexegese auch außerhalb marcionitischen Einflusses möglich, ja vielleicht sogar üblich, war.1 Die Annahme eines marcionitischen Ursprungs der argumenta ist anhand der zugrunde liegenden Texte zunächst also weder eindeutig be- noch widerlegbar.2
Die Untersuchungen zu den Prologen auf die Frage nach der marcionitischen oder nicht-marcionitischen Verfasserschaft zu reduzieren, stellt somit eine Sackgasse dar. Diese Sackgasse ist jedoch keinesfalls alternativlos. DAHLs Neuansatz hat eine Richtung aufgezeigt, der auch die vorliegende Arbeit nachgeht. Der Fokus liegt nun nicht mehr auf den Prologen selbst. Stattdessen muss die Perspektive erweitert werden, um hinter die Prologe zu schauen und nach der Briefsammlung zu fragen, für welche die argumenta ursprünglich verfasst wurden.
Alle vorangegangenen Überlegungen haben deutlich gemacht, dass die Prologe auf eine Edition der Paulusbriefe zurückgehen, die folgende Merkmale aufweist:
1 Sie umfasst zehn Briefe (beinhaltet also keine Pastoralbriefe und keinen Hebräerbrief);
2 statt des Epheserbriefes beinhaltet sie einen Brief an die Laodizener;
3 der enthaltene Römerbrief ist kürzer als die kanonische Version (mit einiger Wahrscheinlichkeit fehlen die Kapitel 15 und 16);
4 die Reihenfolge der enthaltenen Briefe lautet Gal, 1 (2) Kor, Röm, 1 (2) Thess, Laod, Kol, (Phlm), Phil, (Phlm).
Es ist unstrittig, dass die durch Marcion bezeugte 10-Briefe-Sammlung genau diese Merkmale aufweist. Die Annahme, die Prologe gingen auf eine vormarcionitische Sammlung zurück, ist erst statthaft, wenn belegt werden kann, dass Marcion tatsächlich Veränderungen an den ihm vorliegenden Texten vorgenommen hat. Solange dies allerdings nicht der Fall ist, müssen die Prologe schlicht als ein weiterer Beleg (neben Marcions Apostolos) für die Existenz der 10-Briefe-Sammlung verstanden werden.
3.4. Fazit und Zwischenbilanz
Die paratextuellen Beigaben (Kapitelverzeichnisse und Prologe) spielen für die Erforschung der Textgeschichte der Paulusbriefe eine wichtige Rolle, die bisher weitgehend unterschätzt wurde. Insbesondere die Prologe haben sich als ein (von Marcions Apostolos unabhängiger) Beleg der 10-Briefe-Sammlung der Paulusbriefe erwiesen. Insofern sind sie – ebenso wie als auch die Kapitelverzeichnisse – für die Verhältnisbestimmung der 10-Briefe-Sammlung zur 14-Briefe-Sammlung von wichtiger Bedeutung.
Darüber hinaus müssen die paratextuellen Zeugnisse, insofern sie sich als unabhängig von ihrem tatsächlichen Bezugstext erweisen haben, als separate Bezeugung von Lesarten angesehen und textkritisch ausgewertet werden. Unter diesem Blickwinkel stellen die Paratexte einerseits einen wichtigen Baustein zur Erforschung der textgeschichtlichen Überlieferung und Entstehung des Corpus Paulinum dar. Andererseits können sie möglicherweise auch dazu beitragen, einige undurchsichtige textkritische Problemfelder desselben (z.B. die Frage nach dem Schluss des Römerbriefes) zu erhellen.
Mit dem in Kapitel 2 und 3 dargelegten methodischen Rüstzeug ist es jetzt möglich, ausführlich die drei genannten Abschnitte des Römerbriefes zu untersuchen, in denen umfangreiche, textliche Differenzen zwischen 10Rm und 14Rm identifiziert werden konnten.1
IV. Rm 4 – Das fehlende Abrahamkapitel
Die erste umfangreiche Textdifferenz zwischen 10Rm und 14Rm betrifft Rm 4 – das sogenannte Abrahamkapitel. Thematisch geht es in dem besagten Kapitel v. a. darum, die Abrahamskindschaft als erwählungstheologisches Konzept zu etablieren, das entstehende Christentum also in die Heilsgeschichte Gottes mit Israel einzuschreiben. Um die Textgestalt des von Marcion verwendeten Römerbriefes in diesem Abschnitt genau zu erfassen, ist zunächst die häresiologische Bezeugung zu analysieren.1
4.1. Die häresiologische Bezeugung von Rm 4
Den einzigen verwertbaren Hinweis liefert Tertullian. In seiner polemischen Kampfschrift gegen Marcion findet sich folgende Formulierung, die für die Rekonstruktion von 10Rm von größter Bedeutung ist:
| Aber wie Dieben häufig etwas von ihrer Beute entfällt, was dann als Beweismittel [gegen sie] dienlich ist, so hat, glaube ich, auch Markion den letzten Hinweis auf Abraham hinter sich [zurück] gelassen – wobei kein anderer eher zu beseitigen gewesen wäre –, auch wenn er ihn zum Teil veränderte. | Sed ut furibus solet aliquid excidere de praeda in indicium, ita credo et Marcionem novissimam Abrahae mentionem dereliquisse, nulla magis auferenda, etsi ex parte convertit. | |
Tert. Adv. Marc. 5,4,8
Die besagte Passage kommt in erster Betrachtung recht unscheinbar daher, v. a. da sie gar nicht in Tertullians Auseinandersetzung mit dem marcionitischen Römerbrief (10Rm) zu lesen ist. Tatsächlich taucht der Satz nämlich bereits in Tertullians Besprechung des Galaterbriefes auf, also des ersten Textes innerhalb des Apostolos. Tertullian leitet durch diesen Kommentar die Auseinandersetzung mit der Textstelle 10Gal 4,22-26 ein, um die es ihm in diesem Zusammenhang eigentlich geht. Dem häresiologischen Duktus folgend ist diese Textstelle also das besagte Indiz („indicium“), das der Dieb (Marcion) hier auf seinem groß angelegten Raubzug (durch seine Textvorlage) zurückgelassen hat – alle anderen Erwähnungen Abrahams innerhalb des Textbestandes, den Tertullian hier untersucht,1 habe Marcion demnach gestrichen.2
Die Stelle ist ein Paradebeispiel für das Problem der „redaktionellen Inkonsistenz“, das für die Bestimmung des Bearbeitungsverhältnisses zwischen dem Bibeltext Marcions und dem kanonischen Bibeltext von grundlegender Bedeutung ist. Versteht man Marcion als Textfälscher, der den kanonischen Bibeltext nach seinen theologischen Vorstellungen bearbeitet und alles daraus entfernt hat, was er für theologisch falsch hielt, dann dürfte der marcionitische Bibeltext solche Elemente nicht enthalten. Dies ist aber nicht der Fall. Denn die Häresiologen stützen sich ja gerade auf diejenigen Aussagen, die Marcion ihrer Ansicht nach gestrichen haben müsste, aber tatsächlich nicht gestrichen hat, um ihn aus seinem eigenen Bibeltext zu widerlegen. Genau dies tut Tertullian hier anhand von 10Gal 4,22: Marcion müsste diesen Hinweis auf Abraham eigentlich gestrichen haben, weil er die Identität des deus creator und des deus bonus belegt. Tertullian wirft Marcion daher die Unachtsamkeit der angeblichen Bearbeitung vor: Bei seinem Raubzug, mit dem er den (kanonischen) Bibeltext geplündert habe, hat er eine Stelle übersehen anstatt auch die novissima mentio Abrahae zu streichen. Methodisch ist der Vorwurf der redaktionellen Inkonsistenz von großer Bedeutung, weil er die Unhaltbarkeit der angeblichen Bearbeitung des marcionitischen Bibeltextes belegt. Wie oben gezeigt,3 hat Tertullian diesen Selbstwiderspruch gesehen und zu entkräften versucht. Wenn HARNACK und andere einfach darauf verweisen, dass Marcion bei seinen „Streichungen“ sehr inkonsequent vorgegangen sei,4 entziehen sie ihrer eigenen Argumentation den Boden, weil „Inkonsequenz“ einerseits immer in Rechnung zu stellen, andererseits aber nicht nachweisbar ist und deshalb methodisch nicht als Grundlage eines Arguments verwendet werden darf. Die angenommene Inkonsequenz von Marcions angeblicher Bearbeitung ist ein leicht durchschaubares Hilfsargument, das genau dazu dient, das Axiom der theologisch motivierten Streichungstätigkeit des Marcion aufrecht zu erhalten.5 Die entgegengesetzte Position, die das redaktionelle Gefälle zwischen marcionitischem und kanonischem Text einfach umdreht, Marcion also schlicht als Tradent (nicht als Redaktor) eines von ihm verwendeten Textes versteht und dagegen von einer redaktionellen Bearbeitung (Erweiterung) dieses kurzen Textes durch die Herausgeber der 14-Briefe-Sammlung ausgeht, muss folglich als plausibler angesehen werden.
Auch wenn es Tertullian in der zitierten Stelle tatsächlich um etwas ganz anderes geht, weist er damit ausdrücklich darauf hin, dass in 10Gal 4,22 die einzige mentio Abrahae im gesamten Apostolos zu lesen ist. Folglich findet sich in Tert. Adv. Marc. 5 verständlicherweise auch keine weitere Erwähnung oder Auseinandersetzung mit einem Vers, der Abraham nennt. Tertullians Kommentar zeigt also in wünschenswerter Deutlichkeit, dass im gesamten marcionitischen Apostolos (und folglich auch in der 10-Briefe-Sammlung) Abraham nur an dieser einen Stelle erwähnt ist.6
Diese Erkenntnis hat weitreichende Konsequenzen für die Rekonstruktion des marcionitischen Galaterbriefes (10Gal), v. a. aber für den Römerbrief und die Frage nach seiner ursprünglichen Textform. Somit fallen zum einen die Erwähnungen Abrahams in 14Rm 9,7 und 14Rm 11,1 ins Auge. Es wird noch zu klären sein, wie an diesen Stellen der Text des 10Rm ausgesehen haben könnte.7 Zum anderen lenkt das Fehlen der mentiones Abrahae das Augenmerk auf einen weitaus umfangreicheren und theologisch sehr bedeutsamen Briefteil, in dem sich alle weiteren mentiones Abrahae innerhalb des kanonischen Römerbrieftextes (14Rm) finden, nämlich 14Rm 4. Das ganze Kapitel stellt einen semantisch zusammenhängenden Textabschnitt dar. Dieser theologisch sehr gewichtige Abschnitt war also zweifellos nicht in Tertullians Exemplar des marcionitischen Apostolos vorhanden. Alle bisher getätigten Rekonstruktionsversuche des Apostolos (von Adolf von HARNACK bis hin zu Ulrich SCHMID)8 sind sich in diesem Urteil9 einig.
Einzige Ausnahme bildet Jason BEDUHN, der allerdings hierfür eine Quelle heranzieht, die einer kritischen Prüfung des Quellenwerts für die Rekonstruktion des marcionitischen Apostolos nicht standhält. Es handelt sich dabei um die Acta Archelai (AA) des Hegemonius – ein Text aus dem 4. Jahrhundert, der in seiner Struktur stark an den Dialog des Adamantius erinnert. Allerdings richtet sich der Text nicht gegen Marcioniten (Marcion selbst wird in gesamten Werk nur zwei Mal peripher erwähnt), sondern gegen die Manichäer bzw. die Lehre Manis. Darin enthalten sind Antithesen Manis, in welchen bereits HARNACK marcionitischen Ursprung erkannt haben will.10 Zieht HARNACK die Acta Archelai noch heran, um den Inhalt der Antithesen des Marcion zu rekonstruieren, erweitert BEDUHN das Gewicht der ohnehin schon fragwürdigen Quelle, indem er in den Kapiteln 44 und 45 der AA nun sogar marcionitischen Bibeltext herausfiltern will. Für die auf Abraham rekurrierende Stelle aus dem Römerbrief11 bemerkt HARNACK auch, dass „bei M. [scil. im Apostolos] dieser Vers wahrscheinlich nicht [stand].“12 BEDUHN dagegen zieht die genannte Wendung für seine Textrekonstruktion des Apostolos heran und identifiziert damit eine Variante für Rm 4,2 des marcionitischen Römerbriefes.13 Dieses Vorgehen muss jedoch klar zurückgewiesen werden, da grundsätzlich keinerlei stichhaltige Hinweise erkennbar sind, dass in der (fiktiven) Disputation mit Mani tatsächlich Zitate aus der Bibel Marcions verwendet wurden (bzw. dass die Manichäer selbige verwendeten). HARNACKs Annahme, dass der Manichäismus hauptsächlich mit marcionitischen Argumenten operierte,14 rechtfertigt nicht, die AA als Quelle zur Rekonstruktion des Apostolos heranzuziehen, denn selbst wenn es sich tatsächlich um marcionitisches Gedankengut handelte, welchen sich Hegemonius hier bedient, so ist damit auf keinen Fall gewährleistet, dass er dabei auch Auszüge aus dem marcionitischen Bibeltext verwendet.
Es ist also unbedingt weiterhin davon auszugehen, dass das gesamte Kapitel in Marcions Text gefehlt hat. Wie aber kommt es zu einer solch umfangreichen Textdifferenz? Anders als bei den Schlusskapiteln des Briefes erscheint die Option eines mechanischen Blattausfalls an dieser Stelle, d.h. in der „Mitte“ des Textes, hochgradig unwahrscheinlich. Stattdessen muss man davon ausgehen, dass hier ein redaktioneller Eingriff erfolgte. Es legen sich nun zwei Möglichkeiten nahe: entweder wurde der entsprechende Abschnitt in Gänze gestrichen oder aber komplett ergänzt und zum eigentlichen Textbestand erst nachträglich hinzugefügt. Dass die letztere Option weitaus plausibler gegenüber der Annahme einer tendenziösen Streichung Marcions ist, wird in der Folge ausführlich dargelegt.
In den bisherigen Textrekonstruktionen des marcionitischen Römerbriefes ist das Urteil in dieser Frage dagegen nahezu ausnahmslos anderslautend: Ganz der Sichtweise Tertullians folgend, der Marcion in diesem Zusammenhang polemisch als Dieb tituliert (Tert. Adv. Marc. 5,4,8), spricht z.B. SCHMID hier von einer „Ausmerzung“ und konstatiert: „es gibt keinen Grund dafür, anzunehmen, Marcion sei nicht der Urheber dieser Textänderung.“15 Dass SCHMID hier keinen Grund sieht, von Marcion als Urheber abzusehen, liegt wohl v. a. darin begründet, dass das Fehlen des Abrahamkapitels bisher als alleiniges Phänomen des marcionitischen Textes wahrgenommen wurde. Denn alle bisher bekannten Manuskripte des Römerbriefes enthalten den fraglichen Textabschnitt.16
Die vorliegende Arbeit wird allerdings deutlich machen, dass das Fehlen des strittigen Abschnitts entgegen aller bisherigen Untersuchungen sehr wohl Spuren innerhalb der handschriftlichen Überlieferung der Paulusbriefe hinterlassen hat. Diese werden jedoch erst dann sichtbar, wenn man die methodische Beschränkung auf die griechischen Handschriften aufgibt und stattdessen den Fokus der Untersuchung auf die paratextuellen Elemente der lateinischen Texttradition erweitert.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.