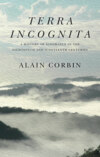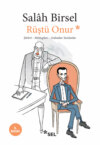Kitabı oku: «Kartell Compliance», sayfa 16
bb) Zivilrechtliche Nichtigkeit
46
Vertragsbestimmungen, die gegen das Kartellverbot verstoßen, sind nichtig. Im europäischen Recht folgt dies aus Art. 101 Abs. 2 AEUV, im deutschen Recht aus § 138 BGB. Die Wirksamkeit des Gesamtvertrages[100], also über eine nichtige Klausel hinaus, bestimmt sich sodann einheitlich nach nationalem Recht, in Deutschland gem. § 139 BGB oder (im Falle von AGB) § 306 Abs. 1 BGB. Nach § 139 BGB ist im Zweifel „das ganze Rechtsgeschäft nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, dass es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein würde.“ Ob eine Vereinbarung teilbar ist und auch ohne den rechtswidrigen Teil abgeschlossen worden wäre, lässt sich nur mit Blick auf den jeweiligen Einzelfall beurteilen. Dabei trifft die Beweislast grds. denjenigen, der sich auf die Fortgeltung des Gesamtvertrags beruft.[101] Ist der ungültige Teil aber vom Gesamtvertrag trennbar und enthält letzterer eine salvatorische Klausel, so gilt die (widerlegbare) Vermutung, dass der Vertrag im Übrigen wirksam ist.[102]
B. Einzelne Beschränkungen
47
Der folgende Abschnitt B skizziert die kartellrechtliche Bewertung der besonders praxisrelevanten vertikalen Beschränkungen, namentlich: Gebiets- und Kunden- (I.), Preis- und Konditionenbeschränkungen (II.), Wettbewerbsverbote (III.) sowie Beschränkungen im Rahmen besonderer Vertriebsformen wie beim Selektivvertrieb und Online-Handel (IV.).
I. Gebiets- und Kundengruppenbeschränkungen
1. Beschränkungen i.S.v. Art. 4 lit. b Vertikal-GVO
48
Nach Art. 4 lit. b Vertikal-GVO stellt es grundsätzlich eine unzulässige Kernbeschränkung dar, wenn vertikale Vereinbarungen – z.B. zwischen Herstellern und Groß- oder Einzelhändlern – das Gebiet oder die Kundengruppen[103] beschränken, in das oder an die der Abnehmer (oder dessen Kunden) die Vertragswaren oder -dienstleistungen verkaufen dürfen. Art. 4 lit. b Vertikal-GVO soll eine Aufteilung von Märkten[104] verhindern und sicherstellen, dass Vertragsprodukte ohne räumliche Begrenzung an beliebige Kundengruppen abgesetzt werden können.[105] Insoweit geht es um Totalverbote, d.h. um das „Ob“ der Lieferung in bestimmte Gebiete und an spezifische Gruppen, nicht hingegen um das „Wie“ der Belieferung.[106] Beschränkungen des Abnehmers in der Art und Weise, auf die er die Vertragsprodukte vertreibt (etwa das Verbot eines bestimmten Vertriebswegs), sind nicht als Kernbeschränkung i.S.d. Art. 4 lit. b Vertikal-GVO zu qualifizieren.[107]
49
Wie sämtliche Kernbeschränkungen gem. Art. 4 Vertikal-GVO ist auch lit. b als umfassendes Verbot ausgestaltet, das sowohl unmittelbare/direkte als auch mittelbare/indirekte Beschränkungen erfasst.[108] Eine unmittelbare Beschränkung liegt etwa in der Verpflichtung, nicht an Kundengruppen (z.B. Online-Händler) bzw. Kunden in bestimmten Gebieten (z.B. außerhalb von Deutschland) zu verkaufen oder Bestellungen solcher Kunden an andere Händler weiterzuleiten.[109] Mittelbare Gebiets- oder Kundenbeschränkungen können sich aus den (Einzelfall-)Umständen ergeben, z.B. wenn Anreize gesetzt werden, bestimmte Kunden oder Gebiete nicht zu beliefern. Einige zentrale Beispiele nennt die Europäische Kommission in ihren Vertikal-LL (z.B. Verweigerung/Reduzierung von Prämien oder Nachlässen, Verringerung der Liefermenge, Androhung der Vertragskündigung, höhere Preise für auszuführende Produkte etc.).[110] Allgemein geht die Europäische Kommission davon aus, dass eine Vereinbarung eher als Gebiets- oder Kundenbeschränkung einzustufen ist, wenn sie durch ein Überwachungssystem (z.B. unterschiedliche Etiketten oder Seriennummern), mit dem sich der tatsächliche Bestimmungsort der gelieferten Ware überprüfen lässt, flankiert wird.[111]
50
Vom Tatbestand ausgenommen, d.h. freistellungsfähig, sind Beschränkungen bezüglich des Orts der Niederlassung des Abnehmers selbst. Es stellt also keine Kernbeschränkung nach Art. 4 lit. b Vertikal-GVO dar, wenn vereinbart wird, dass der Abnehmer nur bestimmte Vertriebsstelle(n) und Lager nutzt.[112]
2. Ausnahmen nach Art. 4 lit. b Ziff. i-iv Vertikal-GVO
51
Art. 4 lit. b Vertikal-GVO sieht in Ziff. i-iv vier ausnahmsweise zulässige Gebiets- und Kundengruppenbeschränkungen vor.[113]
a) Verbot des aktiven Verkaufs in/an exklusiv zugewiesene Gebiete/Kundengruppen
52
Die wichtigste Ausnahme vom Verbot der Gebiets- und Kundengruppenbeschränkungen regelt Ziff. i, wonach der Anbieter den Verkauf in Gebiete oder an Kundengruppen (z.B. Großhändler, Einzelhändler, Endkunden, Weiterverarbeiter o.ä.) beschränken kann, die er ausschließlich einem anderen Abnehmer zugewiesen oder sich selbst vorbehalten hat (sog. „Alleinvertrieb“). Eine ausschließliche Zuweisung in diesem Sinne liegt vor, wenn sich der Anbieter verpflichtet, sein Produkt für den Vertrieb (i) in einem bestimmten Gebiet oder (ii) an eine bestimmte Kundengruppe ausschließlich an einen Händler zu verkaufen und den Händler so vor Verkäufen durch alle anderen Abnehmer des Anbieters in „sein“ Gebiet oder an „seine“ Kundengruppe zu schützen.[114]
53
Wichtig dabei ist aber, dass den Abnehmern nur der sog. „aktive“ Verkauf untersagt werden darf, nicht hingegen der Verkauf insgesamt, also einschließlich des sog. „passiven“ Verkaufs. Die Begriffe aktiver und passiver Verkauf werden in den Vertikal-LL wie folgt definiert:[115]
| – | „Aktiver Verkauf“: Aktive Ansprache individueller Kunden oder Kundengruppen bzw. Kunden in einem bestimmten Gebiet z.B. mittels Direktwerbung einschließlich Massen-E-Mails oder persönlicher Ansprache/Besuche. |
| – | „Passiver Verkauf“: Bedienung unaufgeforderter Bestellungen vom Kunden. Sind Bestellungen auf allgemeine Werbe- oder Verkaufsförderungsmaßnahmen zurückzuführen, die auch nicht zugewiesene Kunden/Gebiete erreichen, aber ein vernünftiges Mittel zur Ansprache von Kunden in eigenen oder freien Gebieten darstellen, handelt es sich ebenfalls um passive Verkäufe. |
54
Damit können Abnehmer in Alleinvertriebssystemen vor aktiven Verkäufen Dritter geschützt werden, keinesfalls aber vor passiven Verkäufen. Beschränkungen des Passivvertriebs sind, abgesehen von wenigen Ausnahmen (s. sogleich), stets als Kernbeschränkung einzustufen.[116]
b) Sprunglieferungsverbot
55
Nach Art. 4 lit. b Ziff. ii Vertikal-GVO ist es auch zulässig, den Verkauf an Endverbraucher durch Großhändler zu beschränken.[117] Auf diese Weise soll es dem Anbieter ermöglicht werden, eine klare Funktionstrennung zwischen Groß- und Einzelhändlern durchzusetzen.[118]
c) Beschränkungen im Selektivvertrieb
56
Art. 4 lit. b Ziff. iii Vertikal-GVO erlaubt Gebiets- oder Kundenbeschränkungen gegenüber Händlern eines selektiven Vertriebssystems. Ihnen darf untersagt werden, nicht zum Selektivvertrieb zugelassene Händler zu beliefern, die im Selektivvertriebsgebiet, also im Geltungsbereich eines Selektivvertriebssystems, tätig sind. Auch kann der Verkauf in Gebiete untersagt werden, in denen die Vertragsprodukte zwar noch nicht selektiv vertrieben werden (sog. „virgin territories“), in denen der Anbieter aber ein selektives Vertriebssystem zu betreiben beabsichtigt.[119] Insoweit darf jeweils nicht nur der aktive, sondern ausnahmsweise auch der passive Verkauf an andere Händler untersagt werden.[120]
d) Beschränkung beim Verkauf von Zwischenprodukten
57
Im Gegensatz zu den bereits erläuterten Ausnahmen vom Verbot der Kunden- und Gebietsbeschränkung betrifft Art. 4 lit. b Ziff. iv Vertikal-GVO vorrangig nicht Vertriebs-, sondern Zulieferverträge. Demnach kann ein Anbieter den Abnehmern einen Weiterverkauf an seine Wettbewerber (= des Anbieters) für solche Produkte verbieten, die den Abnehmern zur Weiterverwendung geliefert werden (d.h. Zwischenprodukte oder Komponenten).[121] Damit soll der Anbieter in die Lage versetzt werden, verhindern zu können, dass seine Vertragswaren für die Herstellung von Konkurrenzprodukten genutzt werden.[122]
Ob diese ratio tatsächlich erreicht wird, ist aber in Fällen fraglich, in denen die Teile über „Umwege“, z.B. erst nach Weiterverarbeitung durch den Abnehmer, „mittelbar“ zur Konkurrenz des Anbieters gelangen.[123]
e) Verbote des Vertriebs von Graumarktware
58
Verbote des Vertriebs von Ware, die auf dem sog. „Graumarkt“, also außerhalb der durch den Lieferanten autorisierten Vertriebswege erworben wird, können zum Schutz von Vertriebssystemen vom Tatbestand des Art. 101 Abs. 1 AEUV ausgenommen oder zumindest freigestellt sein.[124] So hat der BGH ausdrücklich festgestellt, „jeder Graumarktbezug [stelle] – unabhängig von seiner Rechtmäßigkeit – eine empfindliche Störung des Vertriebskonzepts des Herstellers dar, der entgegenzuwirken der Hersteller berechtigt sein kann.“[125] Daneben sind gewisse Beschränkungen denkbar, etwa indem Händlern, die Graumarktware vertreiben, Bildrechte zur Bewerbung der jeweiligen Produkte nicht bereitgestellt werden. Der Ursache des Problems der Graumarktware ist so indes nicht beizukommen. So wird Ware z.B. durch Händler in Niedrigpreisregionen zwecks Eröffnung neuer Absatzwege an Händler in höherpreisigen Gebieten veräußert, die wiederum Zugang zu preiswerter oder zusätzlicher Ware suchen. Denn Beschränkungen des passiven Vertriebs durch den Handel sind außerhalb von Selektivvertriebssystemen grds. nicht möglich, sodass das „Problem“ – abseits des Selektivvertriebs – nicht an der Wurzel gelöst werden kann.
3. Gebiets- und Kundenbeschränkungen im Überblick
59

[Bild vergrößern]
II. Preis- und Konditionenbeschränkungen
60
Unter den vertikalen Beschränkungen kommt der „Preisbindung der zweiten Hand“ in der Praxis zentrale Bedeutung zu (1.). Auch Preis- und Konditionenbeschränkungen wie z.B. Meistbegünstigungsklauseln sind zuletzt vermehrt in den Fokus gerückt, z.B. mit Blick auf die Geschäftsbedingungen von Hotelbuchungsportalen wie HRS oder Booking.com (2.).
1. Vertikale Preisbindung
a) Das Preisbindungsverbot i.S.d. Art. 4 lit. a Vertikal-GVO
61
Die vertikale Preisbindung oder Preisbindung der zweiten Hand wird von den Kartellbehörden und Gerichten in ständiger Praxis als bezweckte Wettbewerbsbeschränkung qualifiziert.[126] Daraus folgt zweierlei: Zunächst ist es für die Annahme einer Wettbewerbsbeschränkung nicht erforderlich, die konkreten Auswirkungen der Preisbindung auf den Markt zu untersuchen. Sie unterfällt stets dem Tatbestand des Art. 101 Abs. 1 AEUV.[127] Weiterhin kommt es auch nicht darauf an, wie groß die Marktanteile der beteiligten Unternehmen sind.[128] Zwar unterfällt ein Verhalten nur dann dem Kartellverbot, wenn es spürbare Auswirkungen auf den Wettbewerb hat. Die Einordnung als bezweckte Wettbewerbsbeschränkung hat aber zur Folge, dass die Preisbindung der zweiten Hand „ihrer Natur nach und unabhängig von ihren konkreten Auswirkungen [stets] eine spürbare Beschränkung des Wettbewerbs dar[stellt].“[129] Dementsprechend stuft die Vertikal-GVO die Preisbindung der zweiten Hand als Kernbeschränkung ein (Art. 4 lit. a) und versagt ihr damit die Freistellungsmöglichkeit.[130]
62
Eine Preisbindung liegt vor, wenn der Anbieter die Möglichkeiten des Abnehmers zur Gestaltung seiner Verkaufspreise beschränkt. Unbenommen bleibt dem Anbieter aber die Möglichkeit, Höchstverkaufspreise festzusetzen oder unverbindliche Preisempfehlungen („UVP“) auszusprechen. UVP und Höchstpreise dürfen dabei aber nicht infolge der Ausübung von Druck oder der Gewährung von Anreizen faktisch Fest- oder Mindestverkaufspreisen gleichkommen („Preispflege“). Bei der Bewertung, ob ein bestimmtes Verhalten unter das Preisbindungsverbot fällt, sind stets die Umstände des Einzelfalls von zentraler Bedeutung.[131] Vor diesem Hintergrund ist die unternehmerische Selbsteinschätzung vielfach mit Unsicherheiten behaftet, zumal auch das soft law der Kartellbehörden regelmäßig nur eine erste Orientierung bietet.[132]
aa) Preisbindung zulasten der Abnehmer
63
Als Kernbeschränkung nach Art. 4 lit. a Vertikal-GVO sind vertikale Preisbindungen zulasten der Abnehmer (Preisbindung der zweiten Hand)[133] zu qualifizieren. Beschränkungen der Preisbildungsfreiheit des Anbieters/Lieferanten (Preisbindung der ersten Hand) z.B. in Form von Bestpreisklauseln, wonach der Anbieter (auch) dem Abnehmer stets seinen günstigsten Preis anbieten muss, stellen keine Kernbeschränkung i.S.d Vertikal-GVO dar.[134] Dies bedeutet aber nicht, dass solche Regelungen keine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellen, sondern lediglich, dass Preisbindungen zulasten der Anbieter – im Unterschied zu Preisbindungen der zweiten Hand – einer Freistellung nach der Vertikal-GVO zugänglich sind.
64
Eindeutig erfüllt ist das Preisbindungsverbot i.S.d. Vertikal-GVO, wenn Fest- oder Mindestpreise für den Weiterverkauf der gelieferten Produkte durch den Abnehmer (Händler) unmittelbar vorgegeben oder vereinbart werden. Nicht freistellungsfähig sind dabei sowohl Vorgaben des Lieferanten (Hersteller oder Großhändler) gegenüber dem Händler, die einheitlich gebundene Preise gegenüber dessen Kunden vorsehen, als auch solche, die den Händler zu einer differenzierten Preisgestaltung nach Käufergruppen oder Absatzkanälen verpflichten (z.B. Preisdifferenzierung für Verkäufe des Händlers in seinem Ladengeschäft und Online).[135] Unzulässig sind demnach etwa die nachstehend beispielhaft aufgeführten Abreden:[136]
Unmittelbare Festlegung der Mindestpreise:
| – | „Der Normalpreis beträgt 2,89 EUR, der Aktionspreis mindestens 2,59 EUR.“ |
| – | „Die UVP darf um maximal 3 % unterschritten werden.“ |
Anknüpfung an die Preise von Dritten:
| – | „Der Normalpreis darf den Wiederverkaufspreis des Händlers Y nicht unterschreiten.“ |
| – | „Der Wiederverkaufspreis von mindestens 2,89 EUR wird nicht unterschritten, solange sich die wesentlichen Wettbewerber X und Y an die UVP halten.“ |
65
Eine unzulässige Preisbindung in diesem Sinne liegt nach dem Wortlaut von Art. 4 Vertikal-GVO auch dann vor, wenn Weiterverkaufspreise nur mittelbar oder indirekt gebunden werden.[137] Die nach Art. 4 lit. a Vertikal-GVO missbilligte Beschränkung der Preissetzungsfreiheit des Abnehmers gegenüber seinen Kunden erstreckt sich deshalb nicht nur auf die End- oder Abgabepreise des Händlers, sondern erfasst bereits die Bindung einzelner Preisbestandteile und anderer preisbildender Faktoren.[138] Eine indirekte bzw. mittelbare Preisbindung liegt beispielsweise in folgenden Fällen vor:[139]
Abmachungen über Absatzspannen oder Nachlässe, die der Händler auf ein vorgegebenes Preisniveau höchstens gewähren darf:
| – | „Der Wiederverkaufspreis wird durch den netto/netto Einkaufspreis zuzüglich 25 % gebildet.“ |
| – | „Der Wiederverkaufspreise muss zwischen 80 EUR und 100 EUR liegen.“ |
| – | „Der Aktionspreis darf die UVP nicht um mehr als 20 % unterschreiten.“ |
Bestimmungen, nach denen die Gewährung von Nachlässen oder die Erstattung von Werbeaufwendungen von der Umsetzung eines vorgegebenen Preisniveaus abhängig gemacht wird (s. auch unten zur sog. „Preispflege“).
66
In der Praxis kommt es häufig zu Diskussionen über Deckungsbeiträge. Ausgehend vom Preisbindungsverbot stellt sich dabei zum einen die Frage, inwieweit der Hersteller in diesbezüglichen Gesprächen das Risiko für eine Fehleinschätzung des zukünftigen Marktpreises übernehmen, also eine (Mindest-)Spanne des Händlers garantieren darf. Zum anderen erscheint fraglich, ob der Händler daran gehindert ist, in Nachverhandlungen einen Ausgleich vom Hersteller zu fordern, wenn sich Spannenerwartungen nicht realisieren ließen.[140] Zwar sind derartige Garantien oder Ausgleichsforderungen, sofern sie „im freien Spiel der Kräfte“ zustande kommen, dem Grunde nach kartellrechtlich zulässig. Die konkrete Ausgestaltung kann im Lichte des Preisbindungsverbots dennoch problematisch sein.[141]
Beispiele: Spannengarantie/Kompensation
| – | So kann die Spannengarantie eines Herstellers als Zusicherung dafür gewertet werden, dass der Handel eine UVP insgesamt umsetzt. Die individuelle Zusicherung dürfte dabei regelmäßig bereits als nach § 21 Abs. 2 GWB unzulässige Anreizgewährung qualifiziert werden.[142] Geht der Händler auf ein solches Angebot ein, läge eine wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung i.S.v. Art. 101 Abs. 1 AEUV/§ 1 GWB vor. |
| – | Als unproblematisch erachtet das BKartA dagegen nachträgliche Forderungen des Handels nach einer wirtschaftlichen Kompensation für enttäuschte Ertragserwartungen: „Die Forderungen des Händlers können [. . .] bei entsprechend starker Marktposition unter dem Aspekt der Missbrauchsaufsicht über marktbeherrschende oder marktstarke Unternehmen problematisch sein. Für sich genommen vermitteln sie aber noch keinen hinreichenden Schluss auf eine kartellrechtswidrige Vereinbarung über die Verkaufspreise des Händlers. Hierfür müssen vielmehr weitere Anhaltspunkte hinzukommen.“[143] |
| – | Weist der Händler den Hersteller darauf hin, dass seine Konkurrenten die UVP nicht befolgen, könnte dies dahingehend verstanden werden, dass der Händler die Preisbindung des Herstellers billigt und ihn im Sinne einer Bedingung für die Umsetzung auffordert, für die Einhaltung des Preisniveaus durch die Konkurrenten zu sorgen („Preismoderation“).[144] |
67
Die Wirksamkeit direkter wie indirekter Maßnahmen zur Preisfestsetzung wird erhöht, wenn der Lieferant sie mit Maßnahmen zur Preisüberwachung kombiniert oder die Händler verpflichtet, Mitglieder des Vertriebsnetzes zu melden, die vom Standardpreisniveau abweichen.[145] Kartellrechtliche Bedenken der Europäischen Kommission bestehen dabei insbesondere mit Blick auf den Online-Handel: Der Abschlussbericht zur Sektoruntersuchung E-Commerce hebt hervor, dass die Preistransparenz im Internet und die Entwicklung von Preisbeobachtungssoftware die Identifikation von abweichendem Preissetzungsverhalten der Händler stark vereinfacht habe.[146] Diese Bedenken dürften ganz besonders bei der kartellrechtlichen Beurteilung von Preisempfehlungen des Herstellers zum Tragen kommen (s. sogleich).
68
Beschränkungen des Händlers bei der Bewerbung von Preisen sind grundsätzlich nicht anders zu behandeln als die Einwirkung auf die Preisbildung selbst.[147] Dieser Grundsatz wurde jüngst durch mehrere Entscheidungen der britischen Kartellbehörde (Competition and Market Authority, „CMA“), bestätigt. Diese hat Hersteller sanktioniert, die ihren Händlern vorgeschrieben hatten, zu welchen Preisen sie Produkte im Internet mindestens bewerben müssen (sog. Minimum Advertised Price „MAP“).[148] Das Bundeskartellamt hat entsprechende Verhaltensweisen zuletzt im sog. Matratzenfall (2014-2015) sanktioniert und Bußgelder in Höhe von ca. 27 Mio. EUR verhängt.[149]
69
Als etwaig faktische Preisbindung wird auch der Aufdruck von UVP auf Verpackungen diskutiert. Nach Einschätzung der Kommission soll ein entsprechender Aufdruck den Anreiz der Händler zur Preissenkung verringern.[150] Nach Ansicht des BGH kann ein Packungsaufdruck jedenfalls in Verbindung mit flankierenden Werbemaßnahmen als faktische Preisbindung wirken, wenn die Verbindung von Aufdruck und Werbung Abweichungsmöglichkeiten faktisch beschränkt.[151] Diese Rechtsauffassung erscheint fraglich. Schon die Annahme, der Anreiz der Händler zur Preissenkung werde verringert, überzeugt nicht uneingeschränkt. Vielmehr erscheint auch das Gegenteil plausibel: So macht gerade die aufgedruckte UVP Preissenkungen attraktiv, weil sich Händler gegenüber Kunden als besonders preisgünstig positionieren können.[152] Demgegenüber wird argumentiert, dass entsprechende Aufdrucke Anreize zur Preissenkung verringern. Dem lässt sich entgegenhalten, dass Höchstpreisbindungen grds. zulässig sind (Art. 4 lit. a Vertikal-GVO) und aufgedruckte UVP ähnlich wirken bzw. jedenfalls höheren Preisen entgegenstehen. Vor diesem Hintergrund dürften entsprechende Aufdrucke v.a. in Verbindung mit anderen, unmittelbaren oder mittelbaren Maßnahmen, die die Preissetzungsfreiheit des Handels faktisch beschränken, als unzulässige vertikale Preisbindung zu qualifizieren sein.[153]