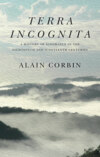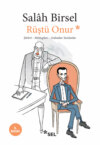Kitabı oku: «Kartell Compliance», sayfa 18
c) Möglichkeiten der Einzelfreistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV
90
Bei vertikalen Preisbindungen, die als Kernbeschränkung nicht nach der Vertikal-GVO freistellungsfähig sind, wird vermutet, dass die Voraussetzungen der Legalausnahme nach Art. 101 Abs. 3 AEUV nicht erfüllt sind. Den Unternehmen steht aber die Möglichkeit offen, im Einzelfall die Effizienzeinrede nach Art. 101 Abs. 3 AEUV zu erheben.[216] Insoweit bedarf es des Nachweises, dass die vertikale Preisbindung Effizienzvorteile erzielt und auch alle weiteren Voraussetzungen nach Art. 101 Abs. 3 erfüllt sind.[217] Nach den Vertikal-Leitlinien erscheint die Freistellung einer vertikalen Preisbindung vor allem in folgenden drei Fallkonstellationen denkbar.[218]
91
Erstens kann die Festsetzung von Weiterverkaufspreisen erforderlich sein, um in einem Franchisesystem oder einem „ähnlichen Vertriebssystem“ mit einheitlichen Vertriebsmethoden eine kurzfristige Sonderangebotskampagne (im Regelfall zwei bis sechs Wochen) zu koordinieren.[219] In Deutschland sind vergleichbare Maßnahmen der Preiswerbung schon 2003 vom BGH als zulässige Ausnahme vom Preisbindungsverbot qualifiziert worden.[220]
Beispiele zur Aktionsplanung:
| – | Bei der Planung von Rabattaktionen kommt der Vorfeldabstimmung mit dem Hersteller angesichts absehbarer Absatzsteigerungen zentrale Bedeutung zu. Wenn die Zeiträume für eine vom Hersteller geförderte Aktion vorab festgelegt werden, ist dies zulässig.[221] |
| – | Kritisch ist es, wenn der Hersteller nicht nur über Mengen informiert wird, sondern der Händler auch den vorgesehenen Aktions-LVP nennt. Die Abgrenzung zwischen der – grundsätzlich erlaubten – bloßen Information durch den Händler und der Zusage eines bestimmten Preises wirft Probleme auf.[222] |
| – | Kritisch sind Kontaktaufnahmen durch Hersteller, wenn Aktionspreise als zu niedrig empfunden wurden.[223] Die Nennung eines mit der Preisempfehlung übereinstimmenden Aktions-LVP im Zusammenhang mit der Warenorder kann den Verdacht nahelegen, dass es sich um eine Zusage handelt, die Preisempfehlung zu befolgen.[224] Vor diesem Hintergrund sollten Händler davon absehen, dem Hersteller vorab den geplanten Aktionspreis zu nennen. Sofern die Händler die Einschätzung des Herstellers zu den Mengeneffekten eines Aktions-LVP einholen möchten, ist anzuraten, die empfohlenen Ordermengen für mehrere alternative LVP abzufragen, um nicht den Anschein zu erwecken, ein bestimmter Aktionspreis werde zugesagt.[225] |
92
Zweitens kann eine vertikale Preisbindung bei der Markteinführung eines Produkts[226] zu Effizienzvorteilen führen.[227] Diese Fallgruppe knüpft an das Problem der Nachfrageunsicherheit an[228] und beruht auf folgender Überlegung: Mit einer Preisbindung der zweiten Hand wird für die Händler in der Produkteinführungsphase ein Anreiz geschaffen (Stichwort: Margensicherheit), ihre Verkaufsbemühungen zu intensivieren und das neue Produkt – auch im Interesse der Verbraucher – zu lancieren.[229] In der Praxis bereitet insoweit der Nachweis der Unerlässlichkeit Schwierigkeiten. Diese Voraussetzung von Art. 101 Abs. 3 wird von der Europäischen Kommission in dieser Konstellation dahingehend konkretisiert, dass eine Einzelfreistellung nur dann in Betracht kommt, wenn „es für den Anbieter nicht sinnvoll [engl. Sprachfassung: „not practical“] ist, alle Abnehmer vertraglich zu verkaufsfördernden Maßnahmen zu verpflichten“[230]. Während dieser Vorbehalt schwer greifbar und nicht praxistauglich erscheint,[231] kann er als Ausprägung des allgemeinen Gedankens verstanden werden, dass eine Preisbindung mangels Unerlässlichkeit nicht freistellungsfähig ist, wenn mit der Vergütung spezifischer Investitionen ein milderes Mittel bereitsteht.[232]
93
Als drittes Beispiel für eine mögliche Rechtfertigung nennt die Europäische Kommission die Verhinderung des Trittbrettfahrens (free riding). Dieses trete insbesondere bei „Erfahrungsgütern oder komplizierten Produkten“ auf. Durch die Vorgabe des Weiterverkaufspreises kann das Risiko gesteuert werden, dass Kunden im Vorfeld ihrer Kaufentscheidung Einzelhändler aufsuchen und Beratungsdienste in Anspruch nehmen, das Produkt dann aber zu einem günstigeren Preis bei Einzelhändlern (Trittbrettfahrern) erwerben, die eine derartige Beratung nicht anbieten und damit einhergehende Kosten nicht einpreisen müssen.[233] In der Praxis dürfte eine Rechtfertigung aber häufig an den Nachweisanforderungen scheitern.[234] So verlangt die Kommission, dass das Unternehmen überzeugend darlegt, dass die Preisbindung „nicht nur ein Mittel, sondern auch einen Anreiz darstellt, um etwaiges Trittbrettfahren von Einzelhändlern in Bezug auf diese Dienstleistungen auszuschalten, und dass die angebotene Kundenberatung den Kunden insgesamt zugute kommt.“[235] Unabhängig davon, dass dieser Nachweis schwer zu führen ist, könnte eine Einzelfreistellung mangels Unerlässlichkeit ausscheiden. Als weniger einschneidendes Mittel kommt in Betracht, dass z.B. im Selektivvertrieb ein (Mindest-) Umfang an Beratungsleistungen gefordert wird.[236]
94
Insgesamt dürfte es sich bei der Einzelfreistellung aber um eine bloß theoretische Möglichkeit handeln.[237] In diese Richtung deutet zumindest der Befund, dass kaum Fälle bekannt sind, in denen die Voraussetzungen nach Art. 101 Abs. 3 AEUV bei einer klassischen Kernbeschränkung bejaht worden sind.[238] Die die Entscheidungspraxis der Europäischen Kommission prägende Haltung kam im Fall PO/Yamaha (2003) paradigmatisch zum Ausdruck, wo es heißt: „[P]reisbindungen der zweiten Hand sind Kernbeschränkungen, die nicht die kumulativen Voraussetzungen des Art. 81 Abs. 3 EGV [Art. 101 Abs. 3 AEUV] erfüllen [. . .].“[239] Allgemein dürfte die Einzelfreistellung von bezweckten Wettbewerbsbeschränkungen damit – von den o.g. Fallgruppen abgesehen – praktisch nahezu unmöglich sein.[240] Dabei scheint die restriktive Handhabung der Europäischen Kommission auch vom EuGH gebilligt zu werden. Jedenfalls waren die Fälle, in denen die Europäische Kommission vor dem EuGH scheiterte, nicht durch eine unterschiedliche Rechtsauffassung gekennzeichnet, sondern durch eine unzureichende Beweisführung der Europäischen Kommission in Bezug auf das Vorliegen einer Vereinbarung.[241] Die restriktive Handhabung der Einzelfreistellung bietet Anlass für vielfältige Kritik.[242] So wird die Beurteilung vertikaler Preisbindungen im Lichte ihrer ökonomischen Wirkungen als zu rigide empfunden und der formaljuristische Prüfungsansatz (form based approach) beklagt, der im Ergebnis einem per se-Verbot gleichkomme.[243] Bis auf weiteres müssen sich Unternehmen aber an der restriktiven Praxis orientieren, zumal sie stets dem Risiko ausgesetzt sind, dass die Kartellbehörde ihr Vorbringen als nicht ausreichend erachtet.[244]
d) Vertikale Preisbindung im Überblick
95

[Bild vergrößern]
2. Meistbegünstigungsklauseln (insbesondere sog. Bestpreisklauseln)
96
Im Unterschied zu vertikalen Preisbeschränkungen, die dem Abnehmer konkrete Preisvorgaben machen, wirken Meistbegünstigungsklauseln („most favoured nation clauses“) relativ:[245] Der wettbewerbliche Preissetzungsspielraum des Gebundenen wird dahingehend eingeschränkt, dass sich die Preissetzung gegenüber Dritten auch auf die dem Klauselverwender zu gewährenden Bedingungen auswirkt und umgekehrt: So regeln entsprechende Klauseln die Verpflichtung, Dritten – gleich ob Anbietern oder Abnehmern[246] – keine günstigeren Konditionen („echte Meistbegünstigungsklausel“) zu gewähren oder Dritten zugestandene Konditionen automatisch auch dem Klauselverwender anzutragen („unechte Meistbegünstigungsklausel“).[247]
97
In der Praxis sind Meistbegünstigungsklauseln häufig Bestandteil von Beschaffungsverträgen, mit denen ein Erwerber sicherstellen möchte, dass ihm der Lieferant stets seine günstigsten Konditionen anbietet. Mit den regelmäßig von Online-Plattformen genutzten Bestpreis- und Paritätsklauseln[248] sind in den letzten Jahren aber auch neue Gestaltungsformen in den Fokus gerückt.[249] Durch Bestpreis- und Preisparitätsklauseln verpflichtet der Betreiber einer Online-Verkaufsplattform seinen Vertragspartner (etwa ein Hotel), der Produkte (oder Zimmer) über die Plattform vermarktet, auf der Plattform stets seine besten und über sonstige Kanäle keine günstigeren Konditionen/Preise anzubieten.
98
Ist der Betreiber einer Online-Verkaufsplattform wie z.B. Amazon auch selbst Händler oder Anbieter der vertragsgegenständlichen Produkte, sind Bestpreis- und Preisparitätsklauseln zulasten der Plattformnutzer nach der Praxis des BKartA schwerpunktmäßig als unzulässige horizontale Kernbeschränkung einzustufen. Entsprechend hat das Bundeskartellamt die von Amazon gegenüber Marketplace-Händlern genutzten Preisparitätsklauseln beanstandet und das Unternehmen zu einer Rücknahme dieser Klauseln gedrängt.[250] Der vertikale Umstand, dass Amazon die Klausel in den Dienstleistungsvertrag über die Bereitstellung der Plattformdienste aufgenommen hatte, trat demgegenüber zurück.[251]
99
Aufgrund der vielschichtigen und aktuellen Rechtsprechung gerade zu Bestpreisklauseln von Hotelbuchungsportalen wird nachfolgend – unter a) – zunächst auf diese eingegangen. Sodann wird – unter b) – der Rahmen für allgemeine Meistbegünstigungsklauseln skizziert.
a) Bestpreis- und Preisparitätsklauseln als aktuelles Online-Phänomen
100
Bestpreis- und Preisparitätsklauseln werden häufig von Online-Plattformen verwendet, um die bei ihnen registrierten Unternehmen daran zu hindern, außerhalb der Plattform bessere Preise oder Konditionen anzubieten. Während zuletzt Bestpreisklauseln von Hotelbuchungsportalen (insbesondere HRS und Booking) im Fokus der Aufmerksamkeit standen, wurden auch schon Verfahren gegen Plattformen zum Vertrieb anderer Produkte (etwa in den Bereichen Energie[252] oder Versicherungen[253]) geführt.
101
Mit Bestpreisklauseln können Online-Plattformen ihren Nutzern den günstigsten Preis für ein Produkt garantieren und der Trittbrettfahrerproblematik vorbeugen. Bietet eine Plattform stets den besten Preis, haben Kunden keinen Anreiz mehr, ein Portal lediglich zur kostenlosen Informationsgewinnung zu nutzen, Käufe dann aber dort zu tätigen, wo bessere Konditionen angeboten werden.[254] Trotz der mit Bestpreisklauseln einhergehenden Beschränkungen nehmen Anbieter derartige Bedingungen hin, wenn sie auf die durch ein Portal vermittelte Reichweite angewiesen sind, wie dies etwa aus der Perspektive von Hotels bei HRS und Booking der Fall ist.[255] Zwar handelt es sich hierbei nur um einen Vertriebsweg unter vielen.[256] Aufgrund des Nutzerverhaltens der Endkunden, die die Suche nach einem Hotelzimmer regelmäßig auf einem der großen Buchungsportale beginnen, kommt den Portalen jedoch überragende Bedeutung zu.[257]
102
Die Verwendung von Bestpreisklauseln ist mit Rechtsunsicherheit behaftet, weil die kartellrechtliche[258] Bewertung in den Mitgliedstaaten teilweise erheblich divergiert.[259] Vor diesem Hintergrund wäre eine harmonisierende Klarstellung auf EU-Ebene wünschenswert,[260] etwa indem die Europäische Kommission ihre Rechtsauffassung in neuen Vertikal-LL oder einer zukünftigen Vertikal-GVO ausdrückt.[261] Wie die vergleichende Betrachtung der europäischen Entscheidungspraxis zeigt, nimmt das BKartA eine eher restriktive Haltung ein:[262] Seine Einschätzung, wonach weite wie enge Bestpreisklauseln unzulässig sind,[263] steht in Widerspruch zu den Entscheidungen der französischen, der italienischen, der schwedischen,[264] der irischen[265] sowie zuletzt auch der polnischen Wettbewerbsbehörde.[266] Auch in Deutschland ist die Praxis angesichts divergierender Entscheidungen des OLG Düsseldorf sowie der kritischen Haltung der Monopolkommission uneinheitlich,[267] wenngleich die aktuellste Entscheidung des OLG Düsseldorf auch zu mehr Rechtsklarheit beigetragen und der restriktiven Handhabung durch das BKartA Grenzen gesetzt hat.
aa) Enge und weite Bestpreisklauseln von Buchungsportalen
103
In der Entscheidungspraxis wird zwischen engen und weiten Bestpreisklauseln unterschieden. Bis zur Intervention des Bundeskartellamts wurden Bestpreisklauseln von Buchungsportalen typischerweise in ihrer weiten Spielart verwendet.[268]
| – | Weite Bestpreisklauseln verpflichten ein Hotel, auf einem Buchungsportal immer zumindest gleich günstigste Preise anzubieten, wie sie auf anderen Buchungs- oder Reiseportalen, auf der hoteleigenen Homepage und ggf. auch offline angeboten werden.[269] Dieses „Besserstellungsverbot“ wurde dabei regelmäßig durch eine Verfügbarkeitsparitätsklausel „abgesichert“[270], wonach die in anderen Vertriebskanälen noch verfügbaren Zimmer stets auch auf dem jeweiligen Buchungsportal verfügbar sein mussten.[271] |
| – | Enge Bestpreisklauseln untersagen hingegen lediglich das Anbieten von günstigeren Preisen oder Konditionen auf der eigenen Homepage, sodass eine Preisdifferenzierung sowohl zwischen Hotelbuchungsportalen[272] als auch beim Offline-Vertrieb möglich bleibt.[273] |
bb) Anwendbarkeit von Art. 101 Abs. 1 AEUV
104
Selbst soweit die kartellrechtliche Beurteilung von Bestpreisklauseln im Ergebnis divergiert, besteht zunächst im Ausgangspunkt Einigkeit: Enge und weite Meistbegünstigungsklauseln beeinträchtigen grundsätzlich den Wettbewerb i.S.v. Art. 101 Abs. 1/§ 1 GWB.[274] Bereits die daran anschließende Frage aber, ob die Klauseln als tatbestandsmäßige Wettbewerbsbeschränkung zu qualifizieren sind, wird kontrovers beurteilt. Während des OLG Düsseldorf bislang von einer bewirkten Wettbewerbsbeschränkung ausging,[275] hatte das BKartA eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung für möglich gehalten, dies aber offengelassen.[276]
105
In seiner jüngsten Entscheidung hat das OLG Düsseldorf für eine enge Bestpreisklausel nun aber bereits die Tatbestandsmäßigkeit verneint.[277] Dabei hat sich der zuständige Senat auf die Rechtsfigur der Nebenabrede eines kartellrechtsneutralen Austauschvertrags gestützt (dazu noch näher unten, Rn. 128 ff.). Demnach sei für enge Bestpreisklauseln allein maßgeblich, ob es sich um eine immanente Schranke des kartellrechtsneutralen Hotelportalvertrages handelt bzw. ob diese Klausel erforderlich ist, um den Vertrag sinnvoll durchzuführen.[278] Dies hat der Senat mit Blick auf die streitgegenständlichen Klauseln des Anbieters „Booking.com“ bejaht: „Die Vereinbarung zur Raten- und Bedingungsparität ist notwendig, um einen fairen und ausgewogenen Leistungsaustausch zwischen den Beteiligten als Portalbetreiber und den vertragsgebundenen Hotels als Abnehmer der Vermittlungsdienstleistung zu gewährleisten, und sie geht weder zeitlich noch räumlich oder sachlich über das zur Zielerreichung Erforderliche hinaus.“[279]
cc) Anwendbarkeit der Vertikal-GVO auf Bestpreisklauseln
106
Mit dieser Entscheidung des OLG Düsseldorf hat die ebenfalls sehr kontrovers diskutierte Frage, ob Bestpreisklauseln dem Anwendungsbereich der Vertikal-GVO unterfallen,[280] jedenfalls für enge Bestpreisklauseln im Anwendungsbereich der Vertikal-GVO praktisch entschärft. Bereits im Dezember 2017 hatte das OLG Düsseldorf zudem die Freistellungsfähigkeit von engen und weiten Bestpreisklauseln in der „Expedia“-Entscheidung[281] weitgehend bestätigt, nachdem diese Frage in den Entscheidungen zu „HRS“[282] und „Booking“[283] noch offenbleiben konnte. Damit sind enge wie weite Bestpreisklauseln nach Art. 2 Vertikal-GVO freistellungsfähig und stellen insbesondere keine Kernbeschränkung dar.[284]
Vertikalvereinbarung i.S.v. Art. 1 Abs. 1 lit. a Vertikal-GVO
107
Umstritten war die Anwendbarkeit der Vertikal-GVO bislang insbesondere mit Blick auf die Frage, ob Bestpreisklauseln als Teil einer Vertikalvereinbarung i.S.v. Art. 1 Abs. 1 lit. a Vertikal-GVO zu qualifizieren sind, die Parteien also „für die Zwecke der Vereinbarung auf einer anderen Ebene der Produktions- oder Vertriebskette tätig“ sind und Bedingungen für den „Weiterverkauf“ geregelt werden. Dies hat das OLG Düsseldorf in der „Expedia“-Entscheidung bejaht.
108
Schon im Vorfeld dieser Entscheidung stand außer Streit, dass die von den Hotelportalen geschuldete Vermittlungsdienstleistung auf einer der Überlassung von Hotelzimmern vorgelagerten Vertriebsstufe erfolgt, der Hotelportalmaklervertrag also ein Vertikalverhältnis zwischen dem Portal (als Anbieter der Vermittlungsdienste) und den jeweiligen Hotels (als Nachfrager) begründet. Die ursprünglichen Zweifel des Senats lagen vielmehr darin begründet, dass die Bestpreisklauseln weder die Bedingungen für den Bezug der Vermittlungsdienstleistungen durch die Hotels noch die Konditionen für den Weiterverkauf dieser Vermittlungsdienstleistung durch die Hotelunternehmen betreffen, sondern sich beim Absatz von Hotelzimmern selbst auswirken: „Auf diesem Absatzmarkt stehen die als Vermittler tätigen Hotelplattformen jedoch in keiner vertikalen Beziehung zu den Hotels.“[285] Ob dies der Anwendbarkeit der Vertikal-GVO entgegenstand, konnte der Senat aufgrund der hohen Marktanteile von HRS und Booking im Ergebnis offenlassen.[286]
109
In seiner „Expedia“-Entscheidung hat das OLG Düsseldorf dann aber entschieden, dass Plattformbetreiber und Hotels auch beim Verkauf der Hoteldienstleistungen in einem Vertikalverhältnis zueinander stehen.[287] Den Umstand, dass sich die Plattformbetreiber darauf beschränken, Zimmerbuchungen zu vermitteln, hat der Senat mit der Konstruktion eines unechten Handelsvertreters „überwunden“. Art. 1 Abs. 1 lit. h Vertikal-GVO stelle klar, dass Abnehmer im Sinne einer Vertriebskette nicht nur derjenige ist, der vom Lieferanten auf eigenes Risiko Waren oder Dienstleistungen kauft und weiterverkauft, sondern auch, wer für Rechnung eines anderen Unternehmens verkauft. Daher unterfielen Handelsvertreterverträge jedenfalls dann dem Geltungsbereich der Vertikal-GVO, wenn sie – wie bei den Hotelbuchungsportalen der Fall – als Vielfachvertretung ausgestaltet sind, der Handelsvertreter bzw. die Plattform also als „unabhängige Zwischenperson“ tätig werde (sog. „unechter Handelsvertreter“).[288] Dass (unechte) Handelsvertreterverträge als vertikale Vereinbarung zu qualifizieren seien, ergebe sich aus den Vertikal-LL (Rn. 12, 49) und entspreche dem Zweck der Vertikal-GVO, sämtliche Bezugs- und Vertriebsvereinbarungen in einer vertikalen Vertriebskette zu erfassen.[289] Weiterhin betreffen die Bestpreisklauseln nach der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf auch die Bedingungen, zu denen die Hotelleistungen an die Gäste veräußert werden. Damit sei auch der zweite Teil der Legaldefinition in Art. 1 Abs. 1 lit. a Vertikal-GVO erfüllt,[290] sodass Portalbetreiber als Abnehmer und die Hotels als Anbieter i.S.d. Vertikal-GVO einzustufen sind.
Weder Freistellungsausschluss noch Kernbeschränkung
110
Die Ausnahmetatbestände der Vertikal-GVO stehen einer Freistellung von engen und weiten Bestpreisklauseln nach der Rechtsprechung nicht entgegen.[291] Obwohl sich Portalbetreiber und Hotels (die ihre Leistungen auch über eigene Vertriebskanäle wie z.B. Websites absetzen) auf der Vertriebsstufe als Wettbewerber gegenüberstehen, greift der Freistellungsausschluss nach Art. 2 Abs. 4 S. 1 Vertikal-GVO nicht. Nach Abs. 4 S. 2 lit b ist die Vertikal-GVO auch auf Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern anwendbar, wenn ein Wettbewerbsverhältnis nur beim Absatz der Vertragsprodukte („Einzelhandel“) besteht, nicht aber auf der vorgelagerten Stufe.[292] Dies hat das OLG Düsseldorf in der „Expedia“-Entscheidung überzeugend bejaht: Die Betreiber der Hotelbuchungsportale stehen mit den vertragsgebundenen Hotels lediglich auf der Einzelhandelsstufe beim Absatz der Hoteldienstleistungen im Wettbewerb, erbringen diese selbst aber nicht.[293]
111
Schließlich sind enge wie weite Bestpreisklauseln nach der Rechtsprechung auch nicht als Kernbeschränkung einzustufen.[294] Wie sich bereits aus dem Wortlaut ergibt („Beschränkung des Abnehmers“), erfasst Art. 4 Abs 1 lit. a nur Beschränkungen, die eine Preisbindung des Abnehmers (hier des Buchungsportals) bezwecken. Einer Freistellung entzogen sind damit lediglich Preisbindungen der zweiten Hand.[295] Beschränkungen der Preisbildungsfreiheit des Anbieters – also der ersten Hand wie hier der Hotels – sind demnach nicht von Art. 4 lit. a)Vertikal-GVO erfasst und stehen der Freistellung nicht entgegen.[296]