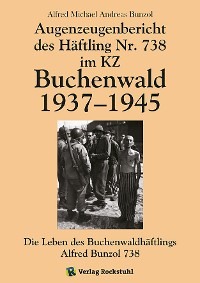Kitabı oku: «Augenzeugenbericht des Häftling Nr. 738 im KZ Buchenwald 1937–1945», sayfa 2
Aber wo soll ich nun mit seiner Lebensgeschichte anfangen und wo aufhören? Wer eine Geschichte aus dem Leben kennt, kennt meist nur ihr Ende. Das Ende in diese Geschichte kennen wir. Sie endet mit einem, „Selbstmord“. Wollen wir jedoch den „Selbstmord“ verstehen, das Wieso oder Warum hinterfragen, müssen wir zu ihrem Kern vordringen. Wollen wir aber zu ihrem Kern vordringen, müssen wir an ihren Anfang, an ihren Wurzeln beginnen. Nur so können wir im Lichte der Wahrheit versuchen zu verstehen. So lasst mich von vorn beginnen! Ich werde euch seine ganze Lebensgeschichte von der Geburt bis zum Tod erzählen. Beginnen werde ich aber nicht wie in einem Märchen, womöglich mit „es war einmal … “. Beginnen werde ich auch nicht mit seiner Geburt sondern mit dem 22. Mai 1951, seinem Todestag.
Der 22. Mai 1951
Heute ist der 22. Mai 1951. Ich stehe wie immer sehr früh auf, und gehe zum Fenster. Einfach nur am Fenster zu stehen, aus ihm zu schauen, um das draußen zu betrachten. Einfach schön. Das was ich sehe, ist das Wirken von gegenseitiger Anziehung und es machte mir große Freude, nicht nur Freude, sondern auch Dankbarkeit. Der Frühling ist da, nicht nur in der Natur, sondern auch in mir. Blühende Bäume, die Sonne strahlt. Die Welt kann so schön sein. Es wird heute wieder ein herrlicher Tag werden. So ist das halt morgens im Frühling, die Sonne geht auf und die Vögel zwitschern. Es ist ein Pfeifen der Anerkennung, so wie die Männer schönen Frauen manchmal hinterher pfeifen. Der allmorgendliche Blick in die Schönheit der Natur, in die Freiheit, den ich genieße und brauche, ist mir nach Buchenwald zur Gewohnheit geworden. Auch wenn es nur ein kurzer Ausblick ist, ich sauge ihn auf. Er gibt mir täglich neue Lebenskraft. Ein immer wieder faszinierender Anblick, wie es die Sonne schafft, die Natur jeden Morgen zu neuem Leben erwachen zu lassen. Das Licht das die Naturwelt durchströmt, es läßt sich nicht wiedergeben. Man muss es sehen und erleben. Wie in den Urgewalten des Windes die Bäume tanzen. Natur ist etwas Kostbares! Gleich werden die Leute vom NKWGviii kommen, um mich zum „Erfahrungsaustausch“ nach Karlshorst abzuholen. Wieder so ein sinnloses Verhör. Wieder diese bohrenden Fragen zu meiner Gesinnung, meiner Einstellung zur Sowjetunion, was ich über Stalin, den großen Führer denke. Ob ich die Entwicklung in der Sowjetzone gutheiße, die SEDix, die neue Staatsführung, die Deutsche Demokratische Republik (DDR). Warum ich mit einem Zeugen Jehovasx verkehre? Immer wieder diese Fragen, die ich seit meiner „Strafversetzung“ von Weimar nach Teltow hier über mich ergehen lassen muß. Zu der neuen Arbeitsstelle gehört dieses von der Sowjetarmee konfiszierte Einfamilienhaus in Rangsdorf, im Grenzweg, in welches ich mit meiner Familie einziehen durfte. Es lag etwas abseits. In einer schönen Waldsiedlung. Schon in Weimar hat man versucht mich aus dem Verkehr zu ziehen. „Wegen meiner demokratischen Ansichten“, die im sowjetisch besetzten Sektor anscheinend nicht mehr gefragt sind. Hier war ihre Strategie, mich auf Arbeit zu demütigen oder mich kalt zu stellen. Beinah wäre es ihnen gelungen. Ich musste mich in psychiatrische Behandlung begeben, war auch einige Zeit in der Psyachtrie in Jena untergebracht. Diese Demütigungen machten mir anfangs schwer zu schaffen. Als die „neuen Genossen“ in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands aber merkten, dass sie keine Wirkung mehr bei mir erzielten konnten, wurde ich eben nach Teltow versetzt. Ab da beschäftigte sich der NKWD mit mir. Ein Grund war sicherlich auch, uns Buchenwaldkameraden zu trennen, denn ich war nicht der einzigste von uns, der wegen seiner politischen Gedanken Schwierigkeiten bekam. Oder haben sie vielleicht Angst vor uns Buchenwaldlern? Sehen uns in diesem neuen System als ungebetene Konkurrenten, die unangenehme Fragen stellen? Ich habe meine Konsequenzen aus diesem ganzen politischen Schwindel gezogen, ich werde mich wie schon so viele von meinen Kameraden in den amerikanischen Sektor absetzen. Aus Angst, ja! Vor den demütigenden und erniedrigen Verhören, nein. Vor den Russen, nein. Vor diesen sogenannten neuen Genossen in der SED, nein. Sondern aus Angst vor einer neuerlichen Verhaftung, einer Deportation nach Sibirien, womöglich wieder nach Buchenwald. Wer trauert hat keine Angst mehr, wer liebt auch nicht, aber davor habe ich Angst. Einige der alten Genossen von Buchenwald hat es auf die eine oder andere Weise schon getroffen. Warum, es weis keiner so genau. Ich weis nicht was noch kommen wird in den unendlichen Jahrhunderten. Aber eins weis ich genau, das würde ich nicht nochmals überstehen, nicht mehr durchhalten können. Diesmal würden sie mich zerstören und nicht nur mich, auch meine gesamte Familie. Deshalb kann und will ich in diesem sogenannten sozialistischen System nicht mehr mitmachen. Hoffentlich klappt alles wie geplant. Die Koffer hat Käte schon gepackt. Sie stehen im Flur. Am Wochenende werden wir Rangsdorf in Richtung Hessen verlassen. Es ist schon alles mit meinen Kameraden Briel vorbereitet. Käte weiß aber noch nichts davon, ich will sie und die Kinder nicht unnötig in Gefahr bringen. Sie denkt wir fahren nach Großrudestedt zu ihren Eltern. Ihr geht es nicht besonders, sie ist seit eineinhalb Monaten wieder schwanger, hat es mir vorige Woche gesagt. Wir freuen uns sehr auf das Kind. Kindersegen ist Gottes Segen habe ich Käte gesagt. Dann sind wir eben zu sechst. Die Kinder Hansi, Jutta, Rosa, „das neue“, Käte und ich. Ich freue mich darauf. Hoffentlich wird es ein Junge? Käte braucht mich jetzt. Das spüre ich. Sie braucht viel Liebe und Zärtlichkeit von mir. Sie möchte auch, dass ich für sie da bin, um sie bestmöglichts zu unterstützen. Ich mache leise, um Käte und die Kinder nicht zu wecken. Gehe ins Badezimmer und dusche mich. Im Fenster sehe ich den Wagen vom NKWD vorfahren. Ich gehe und öffne die Haustür, damit sie nicht klingeln brauchen, denn die Kinder und Käte sollen ruhig noch schlafen. Es ist ja erst kurz vor 6.00 Uhr. Es sind zwei neue Genossen. Sie sehen mein verdutztes Gesicht und sagen, da Sergeant Konzef und Major Kowulev, ihn kenne ich persönlich, er wohnt bei Notens, verhindert sind. Notens sind die einzigen Bekannten in Rangsdorf, mit denen wir uns angefreundet haben. Ich bitte sie herein, weil ich noch nicht ganz fertig bin. Sie fragen nach meiner Dienstwaffe und wollen sie sehen. Das wundert mich etwas, aber was soll’s. Ich führe sie ins Arbeitszimmer, wo ich sie in meinen Schreibtisch aufbewahre und gebe sie einem der Genossen. Ich sehe wie der andere das Arbeitszimmer abschließt. Ich setze mich hinter meinen Schreibtisch und frage ihn was das soll und wo er den Schlüssel zu meinem Haus her hat. Das Haus gehört der Sowjetunion war seine Antwort. Wofür wir natürlich auch die Schlüssel haben. Der andere kam auf mich zu. Ich wollte noch den Kopf drehen und ihn anschauen. Zu Spät, er drückt etwas Kaltes, Metallenes an meine Schläfe. Als ich aufschauen wollte, verstärkte sich der Druck. Ich spüre den kalten Druck meiner Pistole, die ich ihm gab. Er entsicherte sie und schoss auf mich. Bums! „Sie legten die Pistole in die Hand ihres Opfers und verließen in aller Ruhe das Zimmer durch das Fenster. Bei ihnen kann keinerlei Hektik auf, den sie gehörten dem Spezialkommando des NKWD an. Und ihr Spezialkommando innerhalb des NKWD war auch für solche Fälle zuständig. Die beiden sind froh, dass alles so schnell und unkompliziert ablief. Den sie wussten, daß auch noch die Frau mit Kindern im Hause waren. Wären sie wach gewesen, hätten auch sie erschossen werden müssen, so lautete der Befehl. Ein Familiendrama eben. Aber auch so würde keiner eine Liquitierung vermuten. Alle werden denken es war Selbstmord. Es hat doch schon so oft funktioniert. Wer sollte, wenn überhaupt, eine Ermittlung einleiten. Es sieht doch alles wie der perfekte Selbstmord aus. Sie waren zufrieden. Es würde wieder ein Lob und vielleicht Sonderurlaub geben. Für sie war es eben nur ein Deutscher, ein Faschist oder in diesen Fall ein Verräter, den sie beseitigten. Sie hatten kein Problem damit, Menschen zu liquidieren, wenn die Partei es verlangte. Denn die Partei wusste schon warum, wenn ein solcher Befehl erteilt wurde. Und in diesem Krieg gegen die Deutschen wurde er ihnen oft erteilt. Für sie immer eine Art Rache für die Vernichtung ihrer ganzen Familie. Nur sie sind die einzigen Überlebenden eines Rachefeldzuges der gehassten Faschisten gegen Ihr Dorf, südlich von Kiew, was nicht mehr existiert, von der Landkarte verschwunden ist. Von der Landkarte verschwunden wie so viele anderen Dörfer und Städte in der Sowjetunion, mit samt ihren Bewohnern, in diesem großen Krieg. Sie erlebten den barbarischen Vernichtungskrieg der SS gegen die Zivilbevölkerung aus nächster Nähe. Sie sahen mit eigenen Augen, wie die Bewohner ihres Dorfes in eine Scheune gesperrt und bei lebendigem Leibe verbrannt wurden. Fassungslos sahen sie die brennende Scheune, hörten die Schreie. Fassungslos sahen sie diese Satiriker, die so etwas taten und dabei noch lachen konnten. Begreifen, nein, das konnten sie nicht. Alle weg, Mutter, Vater, Schwester, Verwandte. Sie waren damals gerade Sechzehn, Kinder. Nur der Zufall rettete sie, warum gerade sie? Sie mussten alles erst begreifen lernen, was nicht zu verstehen war. Sie hatten ihre Familie verloren. Zeit zur Trauer war kaum da. Es wurde der Moment in ihren Leben, den sie nie vergessen werden, auch wenn er schon lange vorbei ist. In ihnen wurden an diesem Tag andere Menschen geboren. Sie lebten zwar noch, waren aber innerlich tot. Ihr bisheriges Leben wurde wie durch Geisterhand zerstör, sie hatten das Wichtigste für immer verloren. Ihre Gesichter, sie alterten um Jahre. Was wäre aus ihnen ohne diesen Krieg geworden? Aus Kolja wahrscheinlich ein Schlosser. Was schimpften die Eltern mit ihm, nichts war vor ihm sicher, alles baute er auseinander. Oder Mischa, der stets der beste Sportler in der Klasse war. Er zu Wettkämpfen bis nach Kiew fuhr. Dort siegte. Wie stolz waren die Eltern, die so schnell verschwanden, wie der Krieg kam. Wer hat sich von diesen deutschen Faschisten schon für das Schicksal eines Mischa oder Kolja interessiert, ihr Schicksal. Nur die Partei, die KPdSU, gab ihnen die nötige Kraft um diese Zeit der Trauer durchzustehen. In dieser für sie absolut verzweifelten Situation. Sie wurde ihre neue Familie. Die Partei hat sie erzogen, sie als Kämpfer gegen ihren Feind ausgebildet, aus ihnen Kommunisten gemacht. Sie wurden lebende Kampfmaschinen, die in diesem Krieg gegen die Deutschen so dringend gebraucht wurden. An Nachwuchs mangelte es ja nicht, dafür sorgten schon die Faschisten selbst, mit ihrem Krieg der verbrannten Erde. Sie wurden Partisanen, später Soldaten in der sowjetischen Armee und sie waren nicht zimperlich gegen die Deutschen. Nach dem Krieg wurden sie zum NKWD delegiert, in besagte Spezialeinheit. Für diese, ihre Partei, würden sie alles tun, ohne nach dem warum zu fragen, denn die Partei hat immer recht. Sie setzten sich zufrieden in ihr Auto und fuhren davon. Keiner hatte sie bemerkt.“ Ich weiß nicht, wie viel Zeit seid dem Knall vergangen ist. Eine Ewigkeit. Die reden irgendetwas miteinander. Ich kann sie nicht verstehen. Diese Stimmen! Sie sind sooo langsam, sooo phlegmatisch, soooo rollend. Genauso langsam, schleichend und phlegmatisch sind ihre Schritte. Der eine drückt mir die Pistole in die Hand. Ich will sie nicht! Wieso gehen sie durchs Fenster und nicht durch die Tür. Mein Blut spritzt auf den Schreibtisch, auf dem mein Kopf liegt. Wie bei einem Huhn, dem man den Kopf abgeschlagen hat. Mit jedem Herzschlag ein Spritzer. Es tat nicht weh, ich spürte wie mein Leben mit jedem Herzschlag, mit jedem Atemzug immer mehr aus meinem Körper weicht. Alfred du musst um Hilfe schreien! Ich kann es nicht mehr. Ich bin zu schwach. Heute ist der Tag für mich gekommen, ich werde sterben müssen. Ich habe keine Angst um mich, nur um die Zukunft meiner Familie. Für sie wird es schrecklich werden. Es entsteht eine seltsame Ruhe in mir. Ich durchschreite einen langen Gang. Links und recht stehen alte Kameraden Spalier, die es nicht mehr gibt. Sie schütteln mir die Hand. Es spielt ein Orchester Musik. Sie spielen diese traurige, aber faszinierende Musik die ich seit Buchenwald höre und die mich seit dem verfolgt. Heute wird sie zum letzten Mal gespielt, nur für mich. Ist dies etwa der Eingang zum Himmel? Ich sehe den Beginn meines Lebensweges, meine Geburt. Im Angesicht des Totes beginnen die Bilder meines Lebens, das am Freitag, dem 31. Mai 1907 in Bielschowitz begann, sich aneinandergereiht in Bewegung zu setzen und ziehen wie in einen Film an meinem inneren Augapfel vorbei. Für mich wird dieser Film das Ende sein. Trotzdem, lässt er mich nicht los, ich muss ihn einfach zu Ende schauen. Danach wird es für mich kein Zurück ins Leben geben. Morgen werde ich die Sonne nicht mehr aufgehen sehen. Das weiß ich!
Die Jahre 1907 bis 1925

Ich sehe Bielschowitz, die Kirche, den Dorfladen, unser Haus. Bielschowitz, ein Bergarbeiterdorf in Oberschlesien. Dort wurde ich am 31. Mai 1907 als jüngster Sohn des Bergbauelektrikers Alfons Bunzol und seiner Ehefrau Marie im Schlafzimmer meiner Eltern geboren. Die Kinder wurden ja im Elternhaus geboren und man starb auch dort. Es war ein Freitag. Kein außergewöhnlicher, abgesehen von meiner Geburt, eben ein Freitag wie jeder andere Freitag davor. Die Kirchturmuhr schlug wie immer zu jeder vollen Stunde die Anzahl der bereits abgelaufenen. Bei meiner Geburt schlug sie elf Mal. Meine Geburt ging sehr schnell, als das ich groß darüber zu berichten hätte. Sie so ca. 50 min dauerte, eigentlich noch weniger. Mutters ersten Worte die ich zu hören bekam: war doch gar nicht so schlimm, mein Kleiner. Alle, Mutter, die Hebamme, meine Oma und eine Nachbarin, fingen an zu lachen. So war ich pünktlich zum Schichtende von Vater auf der Welt. Gemeinsam mit Mutter, ich nuckelte schon an ihrer Brust, konnten wir den staunenden Vater begrüßen. Fast alle Männer im Dorf arbeiteten in der Grube als Bergmann. Das dörfliche Leben in Bielschowitz wurde geprägt durch den Bergbau, von deren Wohlergehen die Masse der Dorfbewohner abhängig war. Daraus ergab sich eine weitgehende Interessengleichheit. Hierarchische Unterschiede gab es wohl, so zwischen Steiger und Obersteiger oder den einfachen Bergmann. Nach Schichtende gingen die wenigsten wie Vater nach Hause, die meisten in den Dorfladen um Schnaps zu trinken. Die Frauen versorgten Haus und Hof, ihre Männer und natürlich uns Kinder. Der Samstag war für sie der Hauptarbeitstag, an dem alles zum Sonntag gerichtet wurde, wie etwa Hof und Straße zu fegen und überall Ordnung schaffen. Je nach Jahreszeit wurde immer ein sehr leckerer Streusel- oder Obstkuchen gebacken. Tagsüber hielten sie ihr Schwätzchen auf der Straße und tauschten untereinander Neuigkeiten aus. Von fernen Ereignissen erfuhr man ja so gut wie nichts. Es sei denn, man hatte Geld übrig und konnte sich eine Zeitung leisten. So war man eben auf den engsten Bereich seiner Umgebung angewiesen. Haustüren wurden nicht abgeschlossen, es sei denn, Zigeuner waren in der Nähe, deren üblicher Rastplatz bei der Auffahrt zur Halde lag. Infolgedessen herrschte im Dorf ein ständiges Leben im Freien. Auch wir Kinder spielten, sofern man nicht die Schule besuchen musste, den ganzen Tag im Freien. Es sei denn, es regnete, da suchte man sich irgendeinen Schuppen oder einen anderen Unterschlupf. Getauft hat man mich natürlich in der Kirche von Bielschowitz. Die Taufe war meist ein Familienfest, aber oft wurde sie gleichzeitig auch zum Dorffest, an der die gesamte Nachbarschaft und Verwandtschaft teilnahm. Den Pfarrer nicht zu vergessen. Die Haustür wurde geschmückt. Man machte kleine Geschenke. Nach der Heiligen Messe am Vormittag gab es dann ein Festmahl im Hause, zu dem die Paten und die Familie eingeladen waren. Wenn man getauft ist, tritt man der Kirche bei. Dass ich getauft bin, liegt an meinen Eltern, obwohl sich diese Entscheidung natürlich auch auf mein Leben auswirkte. Es bedeutete für mich, dass ich von nun an zur katholischen Gemeinde von Bielschowitz dazugehörte. Wie alle in Bielschowitz zur katholischen Gemeinde dazugehören. Man gab mir den Rufnamen Alfred, sowie den Zweitnamen Eduard. Einer schönen Tradition folgend, es waren die Namen meines Großvaters oder Urgroßvaters? Ich weis es nicht mehr so genau. Ich war der jüngste von 3 Geschwistern, Hildegard genannt Hilde, Adelheid und Paul. Wir wohnten in einen Haus, es war natürlich auch Eigentum der Grube, in der mein Vater arbeitete. Wie fast alles in Bielschowitz Eigentum der Grube war, wahrscheinlich auch die Menschen die hier wohnten. Die Ausdehnung der Königin-Luise-Grube, so war ihr Name schon seit ca. 1820, reichten im Süden bis nach Kunzendorf (Delbrückschächte), Paulsdorf und Bielschowitz. Eine Ausdehnung von fast 45 qkm! Bielschowitz war eines von vielen typischen Bergarbeiterdörfern in Oberschlesien, mit einigen übrig gebliebenen Bauernhöfen, wo noch Landwirtschaft betrieben wurde. Die Bergarbeitersiedlung bestand aus Einfamilienhäusern in Klinkerbauweise. Unser Haus hatte 5 Zimmer, die Küche, die gute Stube, das Elternschlafzimmer und 2 kleine Kinderzimmer.

In einem der Kinderzimmer schliefen Hilde und ich, in dem anderen Adelheid und Paul. Toilette war auf dem Hof. Die anderen Häuser hatten bestimmt die gleiche Ausstattung. Jedenfalls sahen sie von außen alle gleich aus. Zum Haus gehörten ein großer Garten und ein kleiner Hof. Vater hielt sich, wie fast alle hier, Kaninchen, ein paar Hühner und einen Hund. Der Hund, die Rasse kann man schlecht beschreiben, weil vielleicht viele Hunde zu seiner Entstehung beigetragen haben, hörte auf den Namen Spitz. Spitz war der Liebling von uns Kindern und sehr verspielt. Er war unser ständiger Begleiter. Bielschowitz hatte 2 zentrale Anlaufpunkte. Die Kirche in der Dorfmitte umgeben von einem Park mit Teich und den Dorfladen, der rechts neben der Kirche stand. In dem Park waren Bänke, sie waren nachmittags Anlaufpunkt der Jugend des Dorfes. Wie die meisten jungen Menschen auf der ganzen Welt ihre Anlaufpunkte suchen. Sie brauchen ihre romantischen Plätze, ungestört, möglichst weit weg von der Welt der Erwachsenen. Alle Straßen führten zu diesen Zentrum, umkreisten es ringförmig und führten wieder hinaus. Der Kirchgang am Sonntag war heilige Pflicht. Alle Einwohner von Bielschowitz waren katholisch, ich wüsste keine Ausnahme. Im religiösen Leben der Bergleute nahm ja, getragen von der katholischen Tradition, die Heiligenverehrung einen breiten Raum ein. Oft begann die tägliche Arbeit sogar mit einem kollektiven Morgengebet. Meine Eltern und wir Kinder waren logischerweise auch katholisch und so ging es jeden Sonntag aufs schönste herausgeputzt zur Kirche. Wo alle beim sonntäglichen Kirchgang dem Herrgott huldigten, die meisten im täglichen Leben dagegen dem Schnaps. Man hörte sich die Messe an und beichtete anschließend. Ich wusste vor einer Beichte wirklich nicht, was ich da zu beichten hätte. Einmal beichtete ich, nur um überhaupt etwas zu beichten, ich war glaube neun oder zehn, dass ich der Nachbarstochter, sie hieß Maria, beim Doktorspiel zwischen die Beine geschaut habe. Darauf der Beichtvater: „Oh, Gott! Das hat dir doch nicht etwa Spaß gemacht, mein Sohn? Ich sagte, doch, sie durfte es ja auch bei mir!“ Die Strafe, ich solle zehn Mal das Vaterunser betten. Ich fand es sehr ungerecht, da die Höchstanzahl für uns Kinder normalerweise fünf Mal war. Doch was der Pfarrer sagte war Gottes Wort und somit Gottes Wille für uns alle. Wurden wir doch zur Hörigkeit gegenüber der Kirche erzogen. Für uns alle war der sonntägliche Kirchgang mit seiner Beichte jedoch eine Selbstverständlichkeit die zum Leben dazugehörte, wie Sonne und Mond, oder Feuer und Wasser. Zu meinem Leben gehörte auch, dass ich jeden Tag mit Hilde, vielen Freunden aus der Nachbarschaft, im angrenzenden Wald, auf dem Hof, oder ganz einfach im Garten, spielte. Oder wir zogen über die Felder. Manchmal kletterten wir auf die vielen Halden, die um Bielschowitz aufgeschüttet wurden. Und geschüttet wurde viel, denn es wurde immer mehr Steinkohle gefördert, wegen der man sich immer tiefer in die Erde graben mußte. Unsere Eltern sahen es aber nicht gern, da es gefährlich war. Gefährlich, weil im inneren der Halden Schwelbrände auftraten. Die Folge, es kam zu plötzlichen Einstürzen, auch waren die austretenden Dämpfe beim Einatmen sehr giftig. Oft holten Hilde und ich Vater von der Arbeit ab. Für uns war der Weg zur Grube sehr spannend und Vater freute sich immer sehr. Spannend deshalb, weil man Autos und Lkws bestaunen konnte. Für uns Kinder waren diese Dinger ein Wunder. Die Fahrer machten sich oft einen Scherz und hupten, wenn sie an uns vorbeifuhren. Man zuckte dann jedes Mal zusammen, über dieses urtümliche Geräusch. Wir setzten uns einfach vor das Werkstor und warteten bis Vater Feierabend hatte. Manchmal ging er dann mit uns in den Dorfladen, rechts neben der Kirche im Dorfzentrum und kaufte uns Süßigkeiten. Der Laden war zugleich Anlaufstelle für viele Bergleute, die hier ihren Schnaps tranken und dass meist nicht zu knapp. Wenn man den Laden betrat waren links 5 oder 6 Stehtische aufgestellt, an denen die Bergleute standen und tranken. Rechter Hand war der eigentliche Laden in dem man alles kaufen konnte. Angefangen von Süßigkeiten, Brot, Wurst, Spielzeug, Stoffe, eben alles was man auf den Dorf so zum Leben braucht. Manchmal lästerten die Bergleute über Vater, weil er nur ganz selten mittrank. Aber Mutter war sehr froh darüber. Es gab genügend Frauen in Bielschowitz, die neidvoll auf unsere Familienglück schauten und wahrscheinlich oft genug davon träumten, es auch einmal so zu erleben. Die Bunzol galten als sehr glückliche Familie, die sie auch war. Viele der Bergleute, die hier ein und aus gingen, die meisten unter ihnen waren ungebildet, gaben ihren Lohn nicht der Familie, sondern ließen ihn gleich in dem Dorfladen. Freitags war immer Lohntag und dann sah man häufig wie verzweifelte Frauen versuchten den Männern das wenige Geld abzunehmen. Die Schulden waren in diesen Familien oft so hoch, das sie im Dorfladen keinen Kredit mehr für essen und trinken bekamen. Die letzte Stufe war dann meist, dass sie in die Sozialbaracken ziehen mussten, die am Rande von Bielschowitz standen, weil ihnen auch das Geld für die Miete fehlte. Die in diesen Baracken lebten waren gebranntmarkt, aus diesem Abstieg wieder herauszufinden war sehr, sehr schwer, wenn nicht unmöglich. Sie wurden als asozial angesehen. Auch unter uns Kindern. Es spielten sich oft schreckliche Szenen ab. Die Männer schlugen Ihre Frauen bis diese wieder verschwunden waren. Ihre harten Fäuste schlugen wie Schmiedehämmer auf sie ein. Da half auch die wöchentliche Beichte der Männer vor Gott, um Vergebung, die sie letztendlich immer von ihren Beichtvater bekamen, den Frauen und ihren Leiden nicht viel. Not und Leid der betroffenen Familien, die bei dem geringen Lohn der Bergleute ohnehin schon in dürftigen Verhältnissen lebten, war unbeschreiblich groß. Aber Vater war Gott sei Dank immer für unsere Familie da. Ich habe nie gesehen, dass er Mutter je geschlagen hat. Aber als Kind interessierten mich diese Schicksale wenig, für mich waren die Süßigkeiten wichtiger. Es war eben so wie es war, wir waren doch glücklich. Unser Leben war schön, sehr schön.

Doch es bleibt nicht mehr lange schön, da der Krieg ausbrach. Im Juni 1914 begann er, er sollte für alle ein großer Krieg werden, er bekam später den Namen „der 1. Weltkrieg“. Weil die ganze Welt sich mehr oder weniger an ihm beteiligte. Es kam die allgemeine Mobilmachung. Die meisten Männer wurden Soldaten. Soldaten kämpfen für einen Herresführer, einen König oder einen Kaiser, denen die wenigsten von ihnen je begegnet sind, ihn nicht einmal kannten. Geschweige das sie wußten um was es für sie hier eigentlich geht. Sie gehorchen aber. Sind es Narren, oder was sind sie, das sie so blind gehorchen können. Viele von ihnen zogen sogar mit Hurra in diesen Krieg. Vater nicht. Für fast alle von ihnen war es ein Hurra auf nimmer wieder sehen.
Für unsere Familie begann der 1. Weltkrieg am 3. August 1914. An dem Tag wurde unser lieber Vater in diesen sinnlosen Krieg eingezogen. Natürlich erinnere ich mich noch, wie Vater mit dem Zug ins Nirgendwo abtransportiert wurde, als wir ihn in Hindenburg am Bahnhof verabschiedeten. Es war sehr traurig. Für mich, damals erst 7 Jahre, war es jedoch noch nicht bewusst, was dies für unsere Familie, für unsere Zukunft bedeuten würde. Wir Kinder waren doch glücklich, in unserer Idylle von Bielschowitz. Die Väter wurden eingezogen, an die Front, die Front war weit weg. Die einzigste Verbindung für uns zur Front, zu unseren Vätern, waren Briefe und Telegramme. Bis zum September wurde Bielschowitz vom Krieg ja noch verschont, ab dann erinnerten die Todesanzeigen der gefallenen Soldaten jeden daran, dass der Tod auch in unserem idyllischen Dorf reiche Ernte halten sollte. Schon am 7. September, als einer der ersten Kriegstoten, fiel unser Vater in Frankreich. Dort liegen seine Gebeine für immer, irgendwo in einem Loch verscharrt. Wenn überhaupt. Fern von seiner Heimat. Fern von uns. Ich weiß noch als wäre es wie heute, als der Postbote kam und das Telegramm vom Kriegsministerium brachte. Sonst war es immer ein freudiges Ereignis, wenn man Post bekam. Aber dies sollte sich im Verlauf des 1. Weltkrieges schnell ändern. Der Postbote hatte immer mehr Telegramme und weniger Briefe auszutragen, je länger der Krieg dauerte. Er brachte mit dieser Nachricht Schmerz und Schrecken in die jeweiligen Familien. In Bielschowitz gab es zum Ende des Krieges keine Familie mehr die nicht ein Opfer zu beklagen hatte. Wie gesagt, uns traf es als erste hier. Mutter weinte wochenlang. Sie sagte immer wieder unter Tränen, Alfons wollte nicht in diesen Krieg, der nicht sein Krieg war. Aber es herrschte ja Kriegsrecht und Wehrdienstverweigerung gab es nicht. Entschloss man sich doch zu diesem Schritt, wurde man, ohne mit der Wimper zu zucken, erschossen. Oder man musste fliehen. Aber wohin sollte Vater fliehen, er hatte eine Familie. Der Krieg hat das Leben eines 32 jähriger Mannes, der in der Blüte seines Lebens stand, einfach so genommen. Und wofür? Und wer fragt jetzt schon oder noch, Alfons wofür bist Du gestorben, was hatte dein Tod für einen Sinn gehabt, was hat er bewirkt? Was hätte dieser Mann noch gutes in seinen Leben leisten können. Der Krieg hat unser Eltern ihrer Liebe beraubt, denn ich glaube sie haben sich sehr geliebt. Der frühe Tod unseres Vaters war nicht nur für Mutter ein riesiger Schmerz, nein, für die Familie fehlte über Nacht der Ernährer und das sollten wir bald zu spüren bekommen. Am Anfang wurden wir noch vom vielen Leuten im Dorf unterstützt. Den Umstand zu verdanken, und das trifft leider zu, dass einige in Bielschowitz zu Beginn des ersten Weltkriegs sich vorübergehend von der weit verbreiteten Kriegseuphorie für Kaiser, Volk und Vaterland anstecken ließen. Die jedoch nicht von langer Dauer sein sollte. Ich bin überzeugt, dass die meisten gar nicht wussten, um was es in diesen Krieg eigentlich ging. Wir Kinder schon gar nicht. Wir waren viel zu dumm, um den tödlichen Ernst zu begreifen. Für uns war Krieg nur ein Wort, mit dem wir nicht viel oder gar nichts anfangen konnten. Wenn überhaupt konnten wir Krieg mit der jährlichen Schlacht gegen die Stare in Verbindung bringen, die versuchten die Kirschen oder Birnen im Garten zu fressen. Hier verbrachten wir oft Stunden damit, sie zu verjagen. Es war aber meist ein aussichtsloser Kampf, da die Stare warten konnten und wir irgendwann schlafen mussten.
Krieg, was ist eigentlich Krieg? Das erste, was ich bei jedem Krieg bezweifle, von dem ich aus den letzten hundert Jahren weiß, ist, dass dort jemals für die Sache derjenigen gekämpft wurde, die in den Krieg zogen. Krieg ist ja nur ein Wort. Es wurde ja auch schon unendlich viel über ihn geschrieben. Aber, oder, auch unendlich wenig. Diese Bücher füllen Regale. Man kann ihn zwar beschreiben, man kann seine Entstehung analysieren, seine grausamen Auswirkungen zeigen, aber begreifen kann man ihn nicht. Denn im Krieg wird jeglicher Verstand der Menschheit außer Kraft gesetzt. Da spielt die Bildung des einzelnen in der Masse, kaum eine oder sogar keine Rolle. Es gibt ihn immer wieder, er kommt immer wieder, er ist immer wieder da, als Krieg. Wie das Unkraut auf den Feldern. Die Menschheit wird wohl nie in der Lage sein, ihn zu verhindern oder in die Geschichte zu Verbannen. In dieser Welt geht es um Macht oder Geld. Der Mensch tut doch wirklich alles um soviel wie möglich davon zu bekommen und schreckt dabei vor Nichts zurück. Der Krieg ist dabei nur die Spitze des Eisberges. Ich glaube dies galt für jeden alten Krieg von gestern, genau wie es für jeden neuen Krieg von heute und morgen gelten wird.
Je länger dieser 1. Weltkrieg dauerte, wir waren ja nicht mehr die einigste Kriegsopferfamilie, ließ die Unterstützung, genauso wie die Kriegseuphorie, immer mehr nach. Es hatte nun jeder mit sich selbst zu tun. Es wurde alles immer knapper. Kaum noch Brot, kaum noch Heizmaterial. Hilde und ich mussten nun von Vater den Kaninchenbestand übernehmen und versorgen. Er hatte ca. 40 Kaninchen. Wer einmal Kaninchen gezüchtet hat, weiß was das für eine schwere Arbeit ist, zumal ich erst 7 Jahre war. Ich musste mit Hilde, die damals auch erst 9 Jahre war, lernen Gras zu mähen, und Heu zu trocknen. Es war wichtig für die Kaninchen neben den täglichen Fressen für einen entsprechenden Wintervorrat zu sorgen. Im Herbst gingen alle auf die abgeernteten Getreide- und Kartoffelfelder und sammelten Ähren und Kartoffeln, um für die Tiere genügend Winterfutter zu haben. Aber ich glaube, Hilde und mir hat es irgendwie Spaß gemacht. Paul war 15 Jahre und arbeitete in der gleichen Grube wie Vater. Er bekam eine Lehrstelle als Bergbauelektriker. Paul war sehr gut in der Schule, deshalb wurde ihm nach Schulabschluss diese Stelle von der Grubenleitung angeboten. Vielleicht aber auch nur aus Mitleid wegen Vater. Wichtiger für uns war aber, dass Paul Deputatsteinkohle bekam. Jetzt konnte unser Küchenherd, der Tag und Nacht, Sommer wie Winter, brannte, nicht mehr ausgehen. Auf Ihn wurde gekocht, hier wurde warmes Wasser zum Waschen bereitet und er spendete, wenn es kalt war, Wärme. Damit brauchten wir auch nicht mehr, wie viele anderen im Dorf, auf den aufgeschütteten Halden nach minderwertiger Kohle suchen. Keine Arbeit auf der Grube hieß, keine Deputatkohle, egal ob Krieg war. Nur wenige im Dorf hatten noch das Geld um die immer teuerer werdende Kohle zu bezahlen. Für die meisten langte es ja kaum noch um sich etwas zu essen zu kaufen. Zu Paul hatte ich nicht den Kontakt den man zu einem Bruder haben sollte. Erstens war der Altersunterschied schon ziemlich groß und bedingt durch seine Lehre war Paul ja auch kaum noch zu hause. Wenn dann meist um zu schlafen. Er hatte, auch verständlich, andere Interessen als wir. Er zog viel mit seinen Kameraden herum und hielt sich viel in diesen Freundeskreis auf. Auch hatte er schon eine Freundin, die Elfriede Nagel. Nagels wohnten zwei Häuser weiter, rechts von uns. Sie war sehr nett. Alle konnten sie gut leiden und sie war im Gegensatz zu Paul oft Gast in unserem Haus. Sie sollte bis zu Pauls frühen Tod seine einzige große Liebe bleiben. An seinen Tod wäre Elfriede fast zerbrochen. Elfriede heiratete späte, drei Jahre nach Pauls frühen Tot, einen gewissen Korus, den ich nicht kenne. Es war aber nur eine Vernunftehe, wie mir Hilde später einmal schrieb. Adelheid war damals 14 Jahre und hatte eine Lehrstelle als Hauswirtschaftsfrau in Hindenburg bekommen. Sie wohnte in der dortigen Hauswirtschaftsschule im Internat. Da das Geld für eine Fahrt nach Hause oft fehlte, konnte sie uns nur noch selten besuchen. Sie war sehr ruhig, arbeitete bei ihren wenigen Besuchen meist im Haus. Im Grunde genommen bemerkte man sie kaum, im Gegensatz zu Hilde und mir. Mutter sagte oft, wir sollen nicht so rumtollen. Aber eins muss man sagen, Adelheid hatte goldene Hände, sie konnte sehr gut nähen und hatte dazu noch einen guten Geschmack. Das war für uns von großem Vorteil. Sie nähte eigentlich für die ganze Familie die Sachen. Vater hatte Ihr zum 12. Geburtstag eine Singer Nähmaschine geschenkt, welche ihr ganzer Stolz war. Sicher hat er damit auch Ihr Talent gefördert. Wenn sie uns besuchte, brachte sie Paul und mir meist eine Hose oder ein Hemd mit. Mutter und Hilde bekamen ein Kleid oder eine Schürze. Dies nähte sie im Internat der Hauswirtschaftsschule. Stoffreste gab es dort zu genüge. Adelheid sagte, dass diese sowieso nur weggeschmissen werden. Leider waren Ihre Besuche nicht so häufig, aber wenn sie kam war die Freude groß. Ich glaube, für Adelheid war es jedes Mal der Lohn für Ihre Arbeit, wen sie unsere Freude und Begeisterung für die mitgebrachten Sachen erleben konnte. Man sah den Stolz in ihren Augen. Es waren nicht nur Sachen schlechthin, nein sie waren sehr modisch. Mutter wurde oft gefragt, wo wir die schönen Sachen her haben. Wenn sie es Adelheid sagte, war sie noch stolzer.