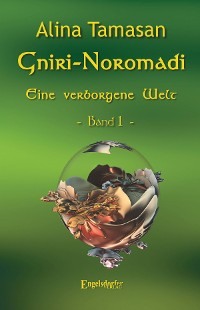Kitabı oku: «Eine verborgene Welt», sayfa 8
‚Hat das mit Naturwesen und Weltenverbinden zu tun?‘ Noromadi war etwas verwirrt.
‚Noromadi, du bist eine Vermittlerin. Was du in der Welt der Naturwesen erfahren wirst, dürfen auch die Menschen erfahren. Die Menschen, die mehr darüber wissen möchten, werden zu dir finden, wenn es an der Zeit ist. An dieser Stelle ist dein Einfühlungsvermögen gefragt: Bringe dem Ängstlichen die Botschaft der Harmonie von Natur und Mensch, ohne ihn noch mehr zu ängstigen.‘
‚Ich muss also keinen Zauber weben, um die Welten zu vereinen?‘
‚Mitgefühl ist ein Zauber‘, und Noromadi verstand.
‚Aber diese Mischwesen-Sache?‘, erkundigte sie sich beklommen.
‚Was behagt dir daran nicht?‘
‚Das Bewusstsein, kein Mensch zu sein.‘
‚Aber du bist ein Mensch, innen wie außen. Im Grunde sind alle Menschen Naturwesen, sie haben sich nur von der Natur entfernt und das vergessen.‘
‚Ich weiß‘, meinte Noromadi betrübt, ‚aber da steckt mehr dahinter.‘
‚Was dich von ihnen unterscheiden mag‘, fuhr ihr Gegenüber unbeirrt fort, ‚ist dein Gefühl, in einer vergangenen Inkarnation unter dem Volk der Gniri gelebt zu haben, als einer von ihnen. Dieses Erinnern verwirrt dich, denn deine unterschiedlichen Leben offenbaren sich dir wie eine Perlenkette. Ereignisse, die weit in der Vergangenheit liegen, die geschahen, als du in einem anderen Körper lebtest, treten auf einmal wieder klar zutage, als seien sie erst gestern passiert. Dein Verstand ist jung, er lebt nur so lange wie der Körper Noromadi lebt, und seine Erinnerungen sind nur aus dem jetzigen Dasein. Er kann nicht verstehen, dass sich deine Seele an etwas erinnert, was nicht in diesem Leben stattfand. Deswegen fühlst du in dir eine Diskrepanz, einen Widerspruch zwischen dieser und der anderen Welt, deswegen fällt es dir als Mensch so schwer, den Aspekt des Mischwesens anzunehmen.‘
‚Also ist die Bezeichnung Mischwesen nur eine Metapher dafür, dass ich einmal eine Gniri war? In einem früheren Leben?‘
‚Exakt!‘
‚Aber ich kann doch nicht die Einzige sein, die zu einem Menschen geworden ist. Es muss doch ganz viele solcher Mischwesen geben.‘
‚Natürlich. Doch bist du eine der Wenigen, die eine solche Botschaft verkraften und die das Potential haben, mit diesem Bewusstsein zu leben ohne in die geistige Verwirrung abzugleiten.‘
‚Gibt es denn noch andere auf der Welt wie mich?‘
‚Schlaf‘, erwiderte er schlicht und streichelte sie sanft.
„Vielen Dank“, flüsterte die junge Frau und schloss die Augen.
Noromadi betrat mit einem freundlichen Lächeln und einem flotten Gruß auf den Lippen den Raum, gab dem Doktor brav die Hand und nahm artig Platz.
„Du hast dir die Haare zurückgebunden“, bemerkte der Arzt erstaunt.
„Ja, sie sind sehr widerspenstig. Ein wenig Ordnung schadet nicht“, antwortete sie kokett.
„Ich möchte dir heute die freudige Nachricht überbringen, dass dies unser Abschlussgespräch ist. Du wirst heute entlassen.“
„Dankeschön. Ich wusste es schon, Frau Fischer hat geplaudert.“
„Ja, unsere Frau Fischer. Manchmal kann sie einem die Überraschung wirklich verderben“, antwortete Dr. Müller augenzwinkernd. Dann erhob er sich und legte ihr seine Hand auf die Schulter. „Freust du dich auf zu Hause?“
„Was für eine Frage?“, sie grinste. „Natürlich. Ich habe Heimweh nach meinen Eltern … und nach Martin.“
„Ich wünsche dir alles Gute und viel Glück!“ Dr. Müller reichte ihr die Hand.
‚Hoffentlich muss ich sie nie wieder schütteln‘, dachte sie schaudernd, derweil sie sich höflich verabschiedete.
Die Sonne schien hell und heiß, kein Wunder, der Sommer stand in seinem Zenit. Vor der Klinik warteten die Eltern – und Martin. Während Clara und Wilhelm sie fest an sich drückten, blieb er distanziert, als wolle er prüfen, ob sie wirklich geheilt sei. Er musterte sie von oben bis unten. Dann rang er sich ein mühsames Lächeln ab, küsste sie kurz auf die Stirn und bekannte mit einem knappen Gruß, dass er sich freue, sie wieder in der Freiheit zu sehen. Noromadi runzelte die Stirn.
‚Wahrscheinlich haben ihn seine Freunde wegen der Irren in der Klappse aufgezogen‘, dachte sie. Mit interessiertem Gesicht ließ sie die Berichte ihrer Eltern von alltäglichen Banalitäten über sich ergehen.
„Die Bilder, die du auf der Station gemalt hast, gefallen mir sehr gut“, lobte Clara ihre Tochter auf der Fahrt. „Diese Sonnenblume würde ich glatt einrahmen und im Wohnzimmer aufhängen. Was hältst du davon, mein Schatz?“ Sie sah Noromadi mit glänzenden Augen an. Diese erkannte, dass sie sich nicht davor drücken konnte.
„Ja, eine gute Idee“, antwortete sie gespielt munter, derweil Beklommenheit in ihr aufkam, weil sie wusste, dass dieses Bild sie immer an ihren Aufenthalt in der Psychiatrie erinnern würde. Ihrer Mutter schien dafür das nötige Feingefühl zu fehlen. Als auch Wilhelm die Idee seiner Frau lobte, sank der jungen Frau das Herz in die Knie.
‚Halt den Mund‘, zwang sie sich. Dann sah sie Martin an. Der zuckte zusammen und blickte scheu auf die Landschaft, die an ihnen vorbeizog. Zu Hause ließ Noromadi ihre Eltern vorangehen, dann packte sie Martin an der Schulter und hielt ihn zurück.
„Hör mal“, zischte sie, „du musst dich mit meiner Gegenwart nicht quälen, nur um mich zu schonen. Wenn du etwas zu sagen hast, dann tu es jetzt!“ Um Martins Mundwinkel zuckte es. Schließlich senkte er den Kopf und nuschelte so leise, dass man es kaum hören konnte:
„Ich denke, es ist besser, wenn wir beide getrennte Wege gehen.“ Noromadi nickte.
„Das denke ich auch“, antwortete sie und ließ ihn, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, einfach stehen. Sie betrat das Haus und erklärte ihren Eltern, dass Martin noch etwas zu erledigen hätte. Unter einem Vorwand begab sie sich auf ihr Zimmer. ‚Ich werde mich jetzt nicht damit aufhalten, zu erklären, dass wir uns getrennt haben.‘ Sie ließ sich auf ihr Bett fallen und drückte das Kopfkissen an sich.
„Egal wie groß das Haus auch sein mag, dieser Raum hier ist meiner, mein Reich, in dem ich sein darf, wie ich wirklich bin“, flüsterte sie. „Ab jetzt gilt für mich mehr denn je: Ich muss aufpassen, was ich in der Gegenwart anderer Menschen sage. Am besten sage ich gar nichts. Ich habe meinen Schutzgeist, mit dem ich reden kann, und wer weiß, vielleicht finden sich noch Gniri … Ob die mich wohl verstehen würden?“ Noromadi kaute zweifelnd auf ihrer Unterlippe. Angst keimte in ihr auf und ließ ihr Herz klopfen, aber dann besann sie sich.
‚Alles ist gut, es ist alles in Ordnung. Ich bin nicht verrückt, spätestens dann, wenn ich wieder im Wald bin, werde ich merken, dass sie da sind und ich mich nicht irre. Sie werden den Kontakt suchen, also muss ich mich nicht überwinden, ich muss ihn nur annehmen … Nebenher werde ich ein normales Leben in einem profanen Alltag führen, in dem Studium, Abendessen und andere Themen wohnen, nur keine Gniri oder Engel. Meinen Eltern werde ich eine vortreffliche Tochter sein und für ihre Belange Interesse zeigen, als wären sie für mich von absoluter Wichtigkeit. – Ou, der Nachbar hat geheiratet? Wirklich? Ah, schön … wen denn? Wie alt ist sie? Was macht sie? Oh, Bankkauffrau, ein solider Beruf … Eine neue Tapete haben Sie im Wohnzimmer? Die Blumenmuster sind ja wirklich der letzte Schrei.‘ Noromadi schluckte.
„Ja, so wird es sein. Diese Gespräche werde ich führen, derweil mich andere Dinge beschäftigen, Dinge, die mein Herz berühren, die mich aufwühlen, Fragen, auf die ich dringend eine Antwort benötige – und all das muss ich mit mir selbst ausmachen, während mich die neue Tapete im Wohnzimmer wahnsinnig fasziniert …“
„Du bist nicht allein“, hörte sie ihren Schutzgeist plötzlich als reale Stimme. „Alles wird gut.“
Auf einmal spürte Noromadi etwas Weiches auf ihrer Hand. Sie lächelte, während ihre Augen zu den Medikamenten wanderten, die auf ihrem Schreibtisch lagen.
„Ich glaube“, flüsterte sie so leise, dass es nur ihr Schutzgeist hören konnte, „ich werde sie ganz absetzen … die Packungen werden leer sein, aber wo der Inhalt landet …“
Im Haus (Ia-ra hì)
Es nieselte, hauchfeine Tröpfchen schwebten durch die Luft und durchnässten langsam aber sicher jedes noch so kleine Fleckchen. Iefîs fühlte sich hundeelend. Obwohl die Temperatur ganz angenehm war, spürte er doch die klamme Kälte in seinen Knochen. Er rieb sich das Bein, dieses dumpfe Pochen würde ihn noch in den Wahnsinn treiben. Er kämpfte gegen das Verlangen, die Wunde bloßzulegen und zu scheuern, auch das würde ihm schließlich keine Linderung verschaffen.
Unzählige winzige Tröpfchen hatten sich in seinen feinen Augenbrauen eingenistet, sie verschmolzen miteinander und rannen als dicke Perlen über die Nasenspitze. In den Fasern seiner groben Hose hatte lehmiger Schlamm braune Streifen hinterlassen, die auch der stärkste Regen nicht ohne weiteres würde wegwaschen können. Iefîs verabscheute Schmutz, am meisten ärgerte ihn, dass er seinem Gastgeber so vor Augen treten musste. Die Krücke war auf trockenem Boden und bei sonnigem Wetter ein guter Helfer, im Dreck und Matsch taugte sie nichts.
Er hatte all seine Hoffnung in Gàschìwa, das Orakel der Gniri gesetzt, auch wenn zwischen Gniri und Dhàrdhats seit Langem ein Konflikt schwelte. Vielleicht erachtete sie ihn ja doch als „würdig“.
„Würdig“, murmelte Iefîs missmutig, wrang sein langes blondes Haar aus und humpelte weiter. ‚Es kann nicht mehr weit sein‘, sagte er sich und tastete mit seinen blauen Schlitzaugen die Umgebung ab. Dieser Mischwald war kein Naturschutzgebiet der Menschen, es war ein reiner Forst. „Na ja, viel ist hier auch nicht mehr zu holen. Sie können ihn ja nicht völlig abholzen, das erlauben die Gesetze nicht“, flüsterte der Dhàrdhats und wischte sich mit dem Hemdsärmel über das Gesicht.
„Was hast du gesagt?“, hörte er plötzlich eine Stimme in einer fremden, doch ähnlichen Sprache. Er blickte sich um und sah eine kleine Gestalt unter einer hohen Buche kauern. Sie lächelte ihn zahnlos an.
„Wer bist du?“ Iefîs hatte, wie viele Dhàrdhats, schon als Kind die Gniri-Sprache gelernt, was in diesen Zeiten durchaus von Vorteil war. Genauso vorteilhaft war es, gegenüber Fremden vorsichtig zu sein. Doch von dieser kleinen gebeugten Gestalt hatte er wohl kaum etwas zu befürchten. Freundlich grüßte er: „Hallo, ich bin Iefîs. Ich habe gesagt, die Gesetze der Menschen verbieten es, den Wald vollständig zu roden.“
„Verbieten mögen sie es wohl, verhindern können sie es nicht“, antwortete die alte Frau. „Ich bin Mhiat-Mai, du kannst Mai sagen. Willst du nicht herüber kommen? Unter dieser Buche ist es ziemlich trocken. Die Leute, die in ihrer Krone wohnen, werden bestimmt nichts dagegen haben, dass du hier für ein Weilchen rastest.“ Iefîs legte seine Hand schützend vor die Augen und blickte in die Krone des großen Baums.
„Hier wohnen Gniri, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass sie hier so einen wie mich wollen, oder?“ Er sah die alte Frau hoffnungsvoll an.
„Hey, ihr da oben!“, rief Mai hinauf, „Iefîs ist mein Freund, wenn ihr ihm was tut, kriegt ihrs mit mir zu tun, habt ihr gehört?“ Dann reichte sie ihm ihre knorrige Hand. „So lang ich hier bin, machen sie nichts.“ Der Dhàrdhats ergriff ihre Hand und trat unter das grüne Dach. Hier war es in der Tat trocken und richtig gemütlich. Als er nach oben schaute, blickte er in eine Reihe neugieriger Gniriaugen, die zwischen den Ästen hervorlugten. „Hast wohl nicht viel Rast gemacht seit es regnet, hm?“ Die Alte sah Iefîs mitleidig an.
„Nein, das stimmt“, antwortete er müde.
„Wollte dich keiner begleiten?“
„Nein!“
„Verstehe, sich heutzutage ungefragt unter einen Gniribaum zu stellen, kann böse Folgen haben“, murmelte sie, „besonders für einen wie dich!“
„Ja, besonders für einen wie mich“, wiederholte Iefîs betrübt, „dabei bin ich noch gar nicht so alt, dass ich irgendetwas mit der Versklavung der Gniri zu tun haben könnte.“
„Die Verbitterung der Leute sitzt tief in ihren Herzen. Sie reichen sie an ihre Kinder und Kindeskinder weiter.“
„Ach, immer diese Grundsatzgespräche“, seufzte Iefîs und strich sich eine Strähne von der Wange. „Ich habe nichts damit zu tun. Der Fürst regiert unser Dorf, er leistet sich Bedienstete, aber Sklaven hat er nicht, das ist schon seit ewiger Zeit verboten.“
„Du bist auch auf dem Weg zu Gàschìwa?“ Iefîs nickte. „Wo tut es denn weh?“ Verblüfft starrte er sie an, dann entblößte er das Hosenbein und zeigte die schwarzen Geschwüre, welche die Haut bis zum Schenkel bedeckten.
„Oje“, murmelte die alte Frau. „Wann hat es angefangen?“
„Vor etwa einem halben Leben“, meinte Iefîs lahm, „wo quält es dich?“
„Bei mir ist’s der Rücken, vom Hals bis zu den Lenden. Lange werde ich nicht mehr laufen können.“ Sie lächelte wehmütig, dann wurde sie ernst. „Wann hast du zuletzt etwas gegessen? Du siehst hungrig aus.“
„Bevor der Regen anfing.“ Mai warf ihm ein kleines in Blätter eingewickeltes Bündel zu. „Oh, danke. Ich habe etwas Schnaps dabei“, sagte Iefîs kauend, „einen Trinkschlauch brauch ich für das Orakel, doch der andere … wenn du möchtest? Der wärmt“, fügte er bibbernd hinzu.
„Mir ist nicht kalt, aber einen Schluck nehme ich gerne! – Hast du trockene Kleider mit? Du musst raus aus dem Zeug“, fügte sie hinzu, als sie Iefîs‘ zittrige Hand sah. „Es ist ja nicht mehr weit und dort hat sich schon eine kleine Lücke aufgetan.“ Die Gniri deutete auf einen unbestimmten Punkt am Firmament. Da besann sich Iefîs, holte flugs Hemd und Hose aus dem Rucksack und zog sich rasch um.
„Fein, fast wie ein Mensch“, grinste Mai.
„Was das Kälteempfinden betrifft, stehen wir ihnen in nichts nach“, grummelte Iefîs.
„Da kennst du die Menschen nicht“, lachte Mai, „die sind noch empfindlicher als ihr!“ – Sie schwatzten noch ein wenig miteinander und weil sie sich so gut verstanden, beschlossen sie, ihren Weg gemeinsam fortzusetzen. Sie packten ihre Rucksäcke ein und als sich Mai schwerfällig erhob, erkannte Iefîs das ganze Ausmaß, das die Schwarze Krankheit unter ihrer Behaarung angerichtet hatte. Ihre Haut war schwarz und übersät mit Geschwüren und selbst als sie stand, konnte sie sich nicht aufrichten und hielt den Kopf leicht gesenkt.
„Hast du Kinder?“, der Dhàrdhats sprach seinen Gedanken sofort aus.
„Ach, wegen der Haare?“, lachte Mai, „nein, Kinder, die sich darin festhalten könnten, habe ich keine mehr, aber ich trage welche auf meinem Rücken, deswegen ist mein Haar noch so dicht.“ Iefîs runzelte die Stirn. „Da staunst du, was? Wenn man sein ganzes Leben lang Kinder mit sich herumgetragen hat, wird man auch im Alter nicht damit aufhören. Was einen nicht umbringt, macht einen noch stärker“, erwiderte sie stolz.
Es dauerte nicht mehr lange und am Rand des Weges, den Menschen durch diesen Wald geschlagen hatten, lag rechter Hand ein Hang. Dort wuchs eine prächtige Buche. Hier wohnte Gàschìwa. Brennnesseln und Dornen schützten den einsam stehenden Baum, der Weg war schmal und unscheinbar und im dichten Gebüsch fast unsichtbar. Der Orakelbaum wurde von zwei Gniri bewacht.
„Wer seid ihr, was wollt ihr?“, fragte der Größere von beiden gelangweilt.
„Iefîs und Mhiat-Mai“, übernahm die Alte das Wort. „Wir sind hier, um das Orakel um Heilung zu ersuchen.“
„Ihr habt wohl die Schwarze Krankheit“, der Kleine blickte misstrauisch auf Iefîs’ bandagierten Fuß. „Davon haben wir schon genug gehabt. Die empfängt das Orakel nicht, also trollt euch!“
„Aber wir brauchen die Hilfe!“, erwiderte Iefîs empört.
„Geht zu Pythera, Gàschìwas Schwester, nicht weit von hier.“
„Das habe ich mir schon gedacht“, die Gniri blickte die beiden spöttisch an, „hat sich also doch bewahrheitet, was man so hört.“
„Pass auf, was du sagst, Weib!“, fuhr der Große sie an.
„Oder … was? Willst du das Leben einer alten Frau und eines kranken Mannes auf dem Gewissen haben?“
Iefîs kochte vor Wut und er musste schwer an sich halten. ‚Macht keinen Fehler‘, schoss es ihm durch den Kopf, ‚sonst geht es euch an den Kragen, so wahr ich hier als kranker Mann stehe, ich bin schließlich um einiges größer und stärker als ihr!‘
„Geht jetzt! Lauft den Weg weiter, dann trefft ihr auf eine große Asphaltstraße. Überquert sie und nehmt euch vor diesen rasenden Dingern in Acht. Ihr werdet an einen Menschen-Ort kommen, an dessen Rand sich ein Bauernhof befindet. Von dort aus führt eine Allee direkt in den Wald. Dort wird sie euch, wenn ihr Glück habt, empfangen.“
Die Alte packte den Dhàrdhats am Ärmel und zog ihn fort.
„Wusstest du, dass sie uns abweisen würde?“, fragte Iefîs, als sie außer Hörweite waren.
„Ich wusste es nicht, ich ahnte es“, erwiderte die Alte. „Du kennst Gàschìwa nicht, hm?“ Die Gniri blieb stehen, ihre Augen blitzten unter den buschigen Brauen hervor.
„Ich komme von weit her“, bekannte Iefîs. „Ich habe von ihr gehört und auch“, er senkte den Kopf, „dass viele abgewiesen werden.“
„Sie weist nicht nur viele ab, mein Junge, sie weist alle ab!“
„Was machen wir dann hier?“ blaffte der Dhàrdhats aufgebracht.
„Was wir vermuten, das wissen wir nicht, nicht wahr, mein Junge? Also haben wir uns auf den Weg gemacht, um es zu erfahren!“
„Hör auf, mich mein Junge zu nennen, ich bin nicht dein Sohn!“
„Manchmal benimmst du dich aber wie er“, grinste Mai.
„Pythera – kennst du sie?“ Iefîs hatte sich schnell wieder beruhigt.
„Ich habe von ihr gehört.“
„Und? Wird sie uns aufnehmen?“
„Ja, das wird sie.“
„Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? – Ach, vergiss es!“, rief Iefîs ärgerlich und machte eine wegwerfende Handbewegung.
„Hör mir zu!“ Mai zupfte ihn am Ärmel. „Zwei Heiler sind besser als einer, und man weiß nie, ob Gàschìwa nicht auf ihre alten Tage noch ihre Meinung ändert. Was Pythera betrifft, sie wird ihr Bestes tun.“
„Wie meinst du das?“
„Das wirst du sehen, wenn wir da sind!“ Er wollte eben etwas erwidern, als er Geräusche vernahm.
„Warte!“, er griff nach ihrer Schulter.
„Na was? Da kommen Menschen diesen Weg entlang“, antwortete die Gniri ohne eine Spur von Unsicherheit in der Stimme.
„Ja, es ist ja auch ein Menschenweg … Was machen wir jetzt?“
„Weitergehen, sie sehen uns doch nicht! Außerdem sind sie ziemlich weit weg, wenn sie laufen, hört man sie lange bevor sie da sind. Sag bloß, du hast noch nie solche Wege betreten?“ Mai blickte irritiert auf ihren Begleiter.
„Ich habe sie gemieden und bin lieber durch den Wald gegangen.“
„Mutig, mutig“, rief sie erstaunt aus, „daran sieht man, dass du nicht viel reist, was?“ Iefîs murmelte irgendetwas Undeutliches. „Glaube mir: Menschenwege durch den Wald sind für Reisende wie dich nie verkehrt. Die Menschen sehen dich nicht und kein Gniri kann behaupten, dass du durch sein Land gestapft seiest!“ Da musste er ihr recht geben, so hatte er das noch gar nicht gesehen. – Es dauerte tatsächlich eine ganze Weile, ehe ihnen ein junges Paar mit einem Kind und einem Hund entgegenkam. Der bunte Mischling blieb stehen, schnupperte, richtete seine Ohren auf und sah Iefîs unverwandt in die Augen.
„Mai!“, rief der Dhàrdhats ängstlich, „was mache ich jetzt? Der hat mich gesehen!“
„Ihn begrüßen, mein Junge, was sonst?“, lachte die Alte.
„Sssî!“, rief sie dem Hund zu. „Komm mal her, du bist ja ein Schöner, was?“ Mai klatschte freudig in die Hände als das Tier schwanzwedelnd auf sie zu lief.
„Ja, ja, ein Schöner bist du!“, rief sie fröhlich aus und kraulte ihn. „Komm, mein Junge, sei keine Memme, streichle ihn, er freut sich!“ Iefîs fuhr dem Mischling zögerlich durch das Fell.
„Mia!“, hörten sie plötzlich die Menschenfrau rufen, „Mia, was machst du da? Komm her!“ Der Hund stellte seine Ohren auf, drehte sich um und lief zurück zu seinem Frauchen.
„Siehst du? Menschen sehen uns nicht.“
„Das weiß ich auch!“, brummte Iefîs. Er klemmte sich die Krücke unter die Achsel und humpelte direkt auf die Familie zu.
„Also, ein bisschen musst du ihnen schon aus dem Weg gehen“, Mai hetzte ihm besorgt hinterher, „sonst laufen sie dich über den Haufen!“
„Quatsch, ich bin so groß wie sie, die …“, er hatte die Worte kaum ausgesprochen, da musste er einen Satz zur Seite machen. Er trat auf eine matschige Stelle und – lag auch schon auf dem Boden. „Mist!“, fluchte er. „Das darf doch nicht wahr sein, ich …!“ Wütend hob er die Faust.
„So viel zur Leichtfüßigkeit von Dhàrdhats“, lachte die alte Frau.
„Ich glaube, ich bin die große Ausnahme“, brummelte Iefîs, während er sich mühsam aufrappelte.
„Kann ich dir helfen?“, klang es plötzlich vor ihm. Iefîs schaute auf und blickte direkt in das Gesicht des Menschenkindes, das ihn mit ihren dunklen Augen neugierig ansah. Mai blieb wie angewurzelt stehen. Iefîs, von Haus aus blass, wich der letzte Rest Farbe aus dem Gesicht.
„Ähm“, hüstelte er verlegen, „also …“ Ehe er etwas sagen konnte, packte ihn das Mädchen an der Hand und half ihm auf.
„So, siehst du? Das ist doch schon viel besser“, sagte sie auf Deutsch. Iefîs verstand die Worte zwar nicht, aber ihre Bedeutung war ihm sofort klar. ‚Was sind die Menschen doch leicht zu durchschauen‘, trotz seiner Überraschung musste er lächeln. Als Naturwesen konnte er alles, was Menschen dachten und empfanden, telepathisch wahrnehmen – sofern er es wollte. Es war jedoch ungleich schwerer, diese Gabe gegenüber Seinesgleichen anzuwenden. Der Dhàrdhats hatte sich oft gefragt, wie dieses Phänomen zu erklären sei, und warum das so war.
Das Mädchen sah ihn so freundlich an, da ließ er sich brav die Hose abklopfen und die Krücke reichen. Mai stand dabei und klappte mehrmals den Mund auf und zu.
„Kind! Wo bleibst du denn?“, hörten sie die Mutter verärgert rufen.
„Komm doch endlich!“, rief auch ihr Vater.
„Ich komme!“, winkte die Kleine ihren Eltern zu. „Ich muss gehen!“, wandte sie sich an Iefîs, „ich hoffe, dass das Bein wieder gut wird, und Ihnen wünsche auch viel Glück!“, rief sie Mai zu.
„Kind!“ Der Mann wurde nun auch ärgerlich, „mit wem redest du denn da?!“ Das Mädchen winkte und rannte zu seinen Eltern. Mai und Iefîs blickten ihr verdattert nach. Sie spürten noch ihr Bedürfnis, sich umzudrehen und ihnen zu winken, aber ihren Eltern zuliebe unterließ sie es.
„Was, zum Teufel, treibst du nur? Führst du wieder Selbstgespräche, oder was?“, fuhr die Mutter sie ungnädig an. Mai fühlte die Bedeutung der Worte und seufzte leise.
„Na komm!“, sagte sie zu Iefîs, „lass uns weitergehen.“
„Was, verflucht noch mal, ist hier passiert?“, rief Iefîs aus, „wie kommt es, dass dieses Kind uns sieht? Du hast doch selbst gesagt …“
„Ja, ja, ich weiß, was ich gesagt habe“, antwortete die Alte mit einer wegwerfenden Handbewegung, dann wurde sie nachdenklich. „Es ist schon seltsam, ich merke es seit … nun ja, seit geraumer Zeit, da hat sich etwas geändert!“
„Was meinst du?“, der Dhàrdhats hob überrascht eine Augenbraue.
„Bisher hatte ich nur davon gehört, es nie selbst erlebt. Man sagt, dass seit einiger Zeit immer mehr Menschen in der Lage sind, uns – mehr oder minder – wahrzunehmen, es gibt gewissermaßen zwei Lager, die Sehenden und die, die nicht sehen! Aber“, fuhr Mai mit erhobenem Zeigefinger fort, „noch sollen die Nichtsehenden in der Überzahl sein.“
„Du meinst, so wie früher?“, murmelte Iefîs gedankenverloren.
„Ja und nein. Früher wurden Sehende hingerichtet, wenn es auch nicht viele waren! Heute sollen es mit jeder Generation mehr werden und eine wahre Flut von Sehenden soll sich bereits über die Erde verbreiten. – Ich spüre es, es liegt irgendetwas in der Luft!“, erklärte Mai geheimnisvoll. Iefîs kratzte sich nervös sein langes spitzes Ohr, das war ihm alles nicht recht geheuer. – Je länger sie den Weg gingen, desto mehr Menschen begegneten ihnen. Der Dhàrdhats erschrak jedes Mal wieder und wollte sich am liebsten verstecken, doch wegen seines kranken Beines ging das nicht so schnell, so ließ er es lieber bleiben und war nur froh, keinem Sehenden zu begegnen. Schließlich erreichten sie die besagte viel befahrene Straße.
„Was machen wir jetzt?“, fragte Iefîs besorgt, „wir sind doch viel zu langsam. Die fahren uns einfach über den Haufen!“
„Wir warten!“, antwortete Mai. „Wenn der größte Andrang vorbei ist, rennen wir rüber.“
„Was für ein größter Andrang? Es rauscht doch ständig etwas vorbei!“
„Es gibt Zeiten, da fahren mehr und dann fahren wieder weniger!“
„Wie lange sollen wir warten? An welchen Zeitraum hast du gedacht?“
„Ich denke an gar nichts“, erwiderte Mai seelenruhig, „ich warte!“ Sie setzte sich in das Gras.
„Ist dir das nicht zu nass?“
„Der Rock trocknet wieder.“ – Also warteten sie, Iefîs auf seine Krücke gestützt, Mai sitzend. Es rauschten stetig Autos vorbei, aber irgendwann, kurz bevor Iefîs der Geduldsfaden endgültig riss, wurden es wirklich weniger und sie konnten die Straße sicher überqueren. Es wurde schon dunkel als sie am Waldesrand ankamen.
„Wer da?“, hörten sie jemanden aus dem Dunkeln rufen.
„Iefîs und Mhiat-Mai“, rief der Dhàrdhats, ehe die Alte das Wort ergriff. Über ihren Köpfen in einer Buche knackte und raschelte es. Dann machte es tapptapp und bewaffnete Gnirimänner standen vor ihnen.
‚Das ist doch ein Menschenweg, auf dem jeder laufen darf‘, dachte Mai, ‚was machen sie so ein Theater?‘
„Wir möchten zur Heilerin Pythera“, sagte sie laut. Dafür erntete sie von Iefîs ein entrüstetes Stirnrunzeln. Wer das Gespräch eröffnet, war der Sprecher, und es gehörte sich nicht, ihn zu unterbrechen.
‚Sieh mich nicht so an‘, Mai blickte störrisch drein, ‚du hast mich unterbrochen, nicht ich dich!‘ Iefîs grummelte und trat zurück.
„Was wollt ihr von der Heilerin?“, fragte einer der Bogenschützen.
„Wir brauchen ihre Hilfe.“ Die Alte wies auf ihren Rücken. Der Anführer senkte die Waffe und die anderen taten es ihm nach.
„Es gibt viele wie euch, die Hilfe brauchen“, sagte er etwas freundlicher. „Es ist die Schwarze Krankheit?“ Die beiden nickten. „Du!“, rief der Gniri und zeigte mit spitzem Finger auf Iefîs, „bleibst hier, aber du“, er nickte Mai freundlich zu, „kannst mitkommen!“ Der Dhàrdhats wollte sich gerade entrüsten, doch abermals übernahm die Alte das Wort.
„Entweder wir beide oder keiner!“, sagte sie, denn sie wusste genau, dass der Soldat eine alte Frau nicht abweisen durfte. Das galt als Missachtung von Weisheit und Erfahrung. „Was kann er euch schon tun?“, versuchte sie ihn zu überzeugen, „sieh dir doch sein schlimmes Bein an!“
„Es geht nicht um was tun!“, antwortete der Gniri trotzig, „er gehört einfach nicht hierher …“
„Ich auch nicht, und nun hör auf zu reden und führ uns zu ihr. Ich habe schreckliche Rückenschmerzen und mein Freund braucht einen neuen Verband!“ Widerwillig ließ sich der Wächter darauf ein.
„Du kommst mit“, wies er einen seiner Leute an, „wir führen sie zur Heilerin!“ Der Gniri trat herzu. „Und du!“, sprach er zu einem dritten, „läufst voraus und sagst Bescheid, dass Besuch kommt.“ Gemeinsam mit den Wächtern verließen Mai und Iefîs den Menschenweg und betraten das Gebiet des Volks am Eichenhain. Hier im Dickicht von Büschen und Baumwurzeln kamen sie noch langsamer voran, sodass die Geduld der beiden Wächter gründlich auf die Probe gestellt wurde.
Der Schein der Glut tauchte ihr Gesicht in ein tiefes Rot. Im großen Kessel dampfte und brodelte es vor sich hin. Pythera rührte langsam die Suppe um und nickte zufrieden.
„Mehr als nur ein sättigendes Mahl“, murmelte sie, „es wird ein wahrer Krafttrunk werden! Ich wünschte nur, er würde mehr bewirken, als kurzzeitig die Lebensgeister zu wecken.“ Zwischen dem Blubbern und Knacken des brennenden Holzes wurden plötzlich Rufe laut.
„Herrin!“, klang eine Stimme von weit her. Die Heilerin richtete ihre Ohren auf, lief zur Tür und trat ins Freie.
„Dìurthi, bist du das?“, rief sie zurück.
„Ja, Herrin, ich bin’s“, rief der Gniri. „Ich wollte Euch Bescheid geben, es kommt Besuch! Zwei Kranke, eine alte Gniri und ein hinkender Dhàrdhats! Sie wollen Euch um Heilung bitten.“
„Die Schwarze Krankheit?“, fragte Pythera und kannte die Antwort bereits.
„Ja“, antwortete Dìurthi. Die Heilerin seufzte schwer.
„Lass sie kommen.“ Dìurthi nickte und verschwand im Dickicht.
„Da kommt die Suppe gerade zur rechten Zeit“, murmelte Pythera, während sie die Liege als Sitzstatt für ihre Gäste herrichtete. Sie holte aus der Ecke eine kleine Holzleiter und lehnte sie an den Stamm ihrer Eiche. Dann stieg sie herab und wartete auf die Ankömmlinge. Als die sich näherten, beschlich sie ein Gefühl innerer Beklemmung, das ihr wohl bekannt war. Die alte Frau rieb sich im Näherkommen den Rücken und lächelte tapfer.
„Seid gegrüßt, Herrin!“, rief sie. „Ich bin Mai und das ist Iefîs, mein großer Begleiter.“ Der Dhàrdhats verneigte sich höflich, ergriff Pytheras Hand und führte sie an seine Stirn.
„Dheer“, murmelte er. Dem Wächter war diese Geste fremd, er presste amüsiert die Lippen zusammen, um ein Lachen zu unterdrücken.
‚Feine Leute, diese Dhàrdhats‘, dachte er.
„Kommt“, Pythera wies auf die Leiter.
„Ràkot, bist du so lieb und trägst Mai nach oben?“ Die Alte verzog mürrisch das Gesicht, doch traute sie sich nicht, die freundliche Geste abzulehnen. Iefîs seufzte neidisch. Mit zusammen gebissenen Zähnen wartete er geduldig, bis die beiden den Stamm erklommen hatten. Da reichte Pythera ihm die Hand.
„Komm!“, sagte sie, „ich glaube, ich könnte es schaffen …“ Iefîs runzelte ungläubig die Stirn.
„Ihr wollt mich doch nicht da hinauf schleppen?“, fragte er perplex.
„Ich versuche es, du kannst doch dein Bein gar nicht beugen.“
„Das Kniegelenk ist steif“, antwortete Iefîs.
„Na, siehst du? Dann wird es mit der Leiter kaum funktionieren.“
„Ich habe kräftige Arme. Ich kann mich hoch ziehen, Eure Hoheit. Seid mir nicht böse, wenn ich es versuche.“ Von einer Frau getragen zu werden, war ihm furchtbar peinlich und er zierte sich vor den Wachen und vor der alten Gniri. Er humpelte zur Leiter und reichte Pythera die Krücke. Dann packte er die Sprosse über seinem Kopf und zog sich daran hoch, bis er mit seinem gesunden Fuß auf der untersten Sprosse stand. Keiner bemerkte, dass er wie von Geisterhand etwas geschrumpft war.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.