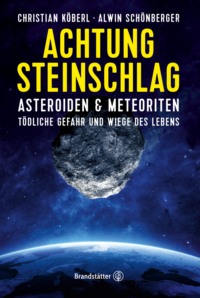Kitabı oku: «Achtung Steinschlag!», sayfa 2
Ein berühmter Meteorit stärkt den Kampfesmut
Das Jahr 1492 hat mindestens zwei bedeutsame historische Ereignisse zu bieten. Am 12. Oktober erreichte Christoph Kolumbus den amerikanischen Kontinent. Und knapp einen Monat später, am 7. November, donnerte in Europa ein Meteorit herab. Kurz vor Mittag an diesem Tag erschütterte eine gigantische Detonation das Elsass und Teile der Schweiz. Ein kleiner Bub aus der Stadt Ensisheim beobachtete, wie ein großer Stein mit ohrenbetäubendem Getöse vom Himmel raste und außerhalb der Stadtmauern in ein Weizenfeld krachte. Der Einschlag ließ den Boden erzittern und hinterließ eine Grube von etwa einem Meter Tiefe.
Wenig später eilten die vom Spektakel alarmierten Stadtbewohner herbei. Fast augenblicklich fielen sie über den mysteriösen Stein her, wohl in der Annahme, es handle sich um ein Zeichen Gottes. Sie schabten, kratzten und brachen Teile davon ab und stopften sie in ihre Taschen, vermutlich in der Hoffnung, der Stein besäße wundersame Heilkräfte, könne für magische Rituale oder als Talisman dienen. Behördenvertreter schritten schließlich beherzt ein, untersagten das wilde Treiben, ließen den Stein in die Stadt schaffen und dort sicher verwahren. Heute sind noch 56 Kilo davon übrig, das ursprüngliche Gewicht dürfte rund 135 Kilo betragen haben. Es handelte sich somit um einen durchaus stattlichen Brocken – und zugleich um den ersten sorgfältig dokumentierten Meteoritenfall in Europa.
Kurz nach der Bergung des wundersamen Steins machte der römisch-deutsche König Maximilian I. Station in Ensisheim, damals ein Verwaltungssitz der Habsburger. Maximilian führte seine Armee gerade Richtung Frankreich und inspizierte bei seinem Zwischenstopp auch den mysteriösen Felsen. Grundsätzlich vertrat man die Ansicht, dass derartige Gegenstände ein böses Omen darstellen. Wenn der Allmächtige die Erde mit Steinen bewirft, sei dies als sicheres Zeichen dafür zu werten, dass er grollte – und womöglich auch noch Seuchen, Missernten oder Hungersnöte schickt. In dem Fall allerdings einigten sich Maximilian und die lokalen Autoritäten nach eingehender Beratung darauf, den mächtigen Stein lieber als wohlwollende Botschaft des Himmels zu betrachten, als Signal, Gott werde Maximilian in der nahenden Schlacht zur Seite stehen. Derart optimistisch gestimmt, säbelte Maximilian selbst zwei Stücke vom Meteoriten ab, eines für sich, eines für einen Freund, den österreichischen Landesfürsten Sigismund.
Um der Angelegenheit noch mehr Würde zu verleihen und deren Tragweite für die Nachwelt zu erhalten, verfasste der berühmte Schriftsteller und Poet Sebastian Brant ein aufwendig gestaltetes Flugblatt, das sowohl den Fall des „Donnersteins von Ensisheim“ beschrieb und illustrierte, als auch dem König Mut zusprach. Die Schrift in Latein und Deutsch war recht flott fertig: Bei dem Meteoriten von Ensisheim handelte es sich immerhin um das erste derartige Exemplar seit der Erfindung des Buchdrucks.
Vielleicht zog Maximilian mit all dem Zuspruch und spirituellen Beistand im Rücken besonders zuversichtlich in die Schlacht. Jedenfalls gewann er sie, und in späteren Gedichten pries Brant den vom Himmel gefallenen Stein als Beweis der göttlichen Gnade, die Maximilian zuteil geworden war. Brant fertigte aber auch sachlichere Notizen an. Zum Beispiel listete er auf, in welchen umliegenden Regionen die Menschen den Knall gehört hatten. Aufgrund seiner Angaben ließ sich rekonstruieren, dass die Explosion über ein Areal von rund 40.000 Quadratkilometern wahrnehmbar gewesen sein könnte.
Ein Zeuge war womöglich ein 21-jähriger Maler namens Albrecht Dürer, der sich am fraglichen Novembertag in Basel aufhielt, nur 40 Kilometer südlich von Ensisheim. Gesichert ist nicht, ob Dürer von dem Meteoritenfall wusste, doch malte er zwischen 1494 und 1496 ein kleines Bild auf die Rückseite seines Gemäldes „Büßender Hieronymus“, das heute zum Schatz der National Gallery in London zählt. Es ist ein düsteres, reichlich abstraktes Werk, in dessen Zentrum knallrot und bizarr gezackt das Schema einer Explosion zu sehen ist – und ein steinförmiges Objekt inmitten dieser Apokalypse.
Der sagenhafte Tisch des Eisens
Ziemlich exakt 100 Jahre später beschäftigten sich Menschen auf der anderen Seite unseres Planeten ebenfalls mit Steinen, die angeblich vom Himmel fielen. Der Gouverneur der Provinz Tucumán im nördlichen Argentinien hatte die Geschichte schon oft gehört: Immer wieder erzählten Indianer von geradezu fantastischen Eisenvorkommen in einer Gegend, die sie „Campo del Cielo“ nannten, das Himmelsfeld. Die Ureinwohner gewannen das Metall und bauten Waffen daraus. Und sie behaupteten, die gewaltigen Eisenmassen seien einfach vom Himmel gefallen. Sie gaben jenem Landstrich, in dem das Metall zum Liegen gekommen war, den Namen „El Mesón de Fierro“: Tisch des Eisens.
Im Jahr 1576 beauftragte der Gouverneur den Capitán Hernán Mexia de Miraval, der Sache auf den Grund zu gehen. Mit acht Mann brach Miraval auf. Indianer führten den Trupp durch unwegsames Gelände, vorbei an gefürchteten Volksstämmen, die man des Kannibalismus verdächtigte. Nach einem beschwerlichen Marsch erreichten die Männer tatsächlich den Mesón de Fierro. Miraval verfasste einen ausführlichen Bericht, in dem er, gestützt auf das Urteil eines Schmieds, die ungewöhnliche Reinheit des Materials lobte. Außerdem verlieh er seiner Vermutung Ausdruck, man sei womöglich auf eine sagenhafte Eisenmine gestoßen. Dann schickte er einen detaillierten Bericht seiner Expedition ab. Das Schreiben landete in einem Archiv in Sevilla. Dort packte es jemand in eine Lade, und darin blieb es liegen – ungelesen und vergessen für die folgenden 340 Jahre.
Im Lauf der nächsten beiden Jahrhunderte wurden weitere Expeditionen in die Region entsandt. Denn die Erzählungen der Indianer kursierten nach wie vor, und die Spanier hofften nicht zuletzt, einer reichhaltigen Mine auf der Spur zu sein. Mitunter war sogar von Silbervorkommen die Rede, was sich jedoch als Irrtum entpuppte. 1783 zum Beispiel brach ein Leutnant der Königlichen Armada namens Rubin de Celis mit 200 Mann in die Region auf. Don Rubin war ein gebildeter, rational denkender Mensch des 18. Jahrhunderts. Er glaubte nicht an außerirdische Steine, fand aber auch keine überzeugenden Hinweise auf eine Mine. Die Masse von El Mesón de Fierro schätzte er auf etwa 15 Tonnen. Sein Bericht unterschied sich teils erheblich von den Schilderungen anderer Entdecker, und heute wissen wir auch, warum: Nicht ein einzelner Brocken ging vor ungefähr 4.000 Jahren über dem Campo del Cielo nieder, sondern ein ganzer Meteoritenschauer. Allein im Zentrum des Areals fanden Forscher inzwischen fast zwei Dutzend Einschlagskrater, jeweils 20 bis 100 Meter im Durchmesser. Damit zählt Campo del Cielo zu den größten Meteoritenstreufeldern unseres Planeten. Die historischen Berichte bezogen sich auf unterschiedliche Teile des Eisenmeteoriten an verschiedenen Fundorten.
In späterer Zeit gestaltete es sich außerordentlich schwierig, die Trümmer wieder aufzuspüren. Viele Suchen verliefen erfolglos, und zwar selbst mit Methoden der Bodenprospektion. Die Ursache dafür war vermutlich, dass die Gegend auch reich an natürlichen irdischen Eisenvorkommen ist und das extraterrestrische Metall deshalb in den Analysen nicht deutlich genug hervorstach. Auf das erste Bruchstück, nach jüngsten Vermessungen 29 Tonnen schwer, stießen Forscher 1969. Es trägt heute die Bezeichnung „El Chaco“. Über die Jahre legten Wissenschaftler immer mehr Teile frei. Erst im September 2016 wurde neuerlich ein gewaltiger Eisenmeteorit am Himmelsfeld entdeckt, gut 30 Tonnen schwer.
Das wirft die stärkste Kuh um
In Europa setzte bereits ab Mitte des 18. Jahrhunderts eine äußerst fruchtbare Zeit für die Meteoritenforschung ein. Zum einen kam es in dichter zeitlicher Abfolge, mitunter im Jahrestakt, zu spektakulären Sichtungen von Boliden und herabstürzenden Gesteinsbrocken. Zum anderen machte die Untersuchung der geborgenen Objekte beachtliche Fortschritte – angetrieben vom zunehmend naturwissenschaftlich orientierten Blick auf die Welt sowie den allmählich besseren Methoden und Instrumenten der Forscher.
Die Serie begann mit einem Meteoritenfall im Oktober 1750 in Nicorps, Frankreich. Gut ein halbes Jahr später, am 26. Mai 1751, sahen sieben Zeugen, wie ein Feuerball bei Hraschina in Kroatien niederging. Noch während das Objekt über den Himmel zog, teilte es sich in zwei Stücke, die wie durch eine brennende Kette miteinander verbunden schienen. Es folgte eine Explosion, dann donnerte eine vorerst undefinierbare Masse auf ein frisch gepflügtes Feld und ließ den Erdboden erzittern. Anfang Juli 1753 verfolgten Menschen in Tabor, unweit von Prag, wie einem Gewitter plötzlich ein Stein entsprang. So wuchs die Sammlung der Berichte über derartige Vorkommnisse ständig, und die zugehörigen Schilderungen wurden mit der Zeit sachlicher, präziser und detailreicher.
Das Muster der Überlieferungen ist naturgemäß stets relativ ähnlich: zunächst ein Zischen, Pfeifen, Grollen in der Luft, dann eine mächtige Explosion, schließlich scheinen die Wolken eine Art Felsen auszuspucken. Solcherart nahm man auch den Meteoritenfall von Albareto bei Modena Mitte Juli 1766 wahr. Gegen fünf Uhr Nachmittag traf der Körper aus dem All mit solcher Wucht auf den Erdboden, dass eine Kuh von den Beinen gerissen wurde. Zwei Frauen klammerten sich an einem Baum fest, um nicht hinzufallen. Schließlich fand man einen schwarzen Gegenstand, der ein etwa einen Meter tiefes Loch geschlagen hatte. Als ein paar Leute aus der Nähe den Stein ausgruben, stellten sie fest, dass er noch warm war. Wie einst in Ensisheim und bei vielen Begebenheiten dieser Art hackten sie auch diesmal den wundersamen Stein in Stücke und trugen sie nach Hause.
Von besonderer Bedeutung ist Albareto, weil es nach dem damaligen Stand der Wissenschaft eine sorgfältige Untersuchung gab. Der Jesuitenpater Domenico Troili archivierte nicht nur Zeugenaussagen des Ereignisses, sondern nahm auch Teile des Steins in Augenschein. Troili beschrieb das Objekt als sehr schwer, magnetisch und teils bedeckt mit einer dunklen Kruste, die für ihn wie Spuren eines Feuers aussah. Weiters prüfte er das Fundstück unter dem Mikroskop und bemerkte: Die Konsistenz erinnere an Sandstein, durchsetzt mit kleinen, leuchtenden Partikeln aus Eisen und Bronzekörnern. Dieses in Meteoriten sehr häufige Material erhielt später die Bezeichnung „Troilit“, womit die historische Rolle des Jesuiten aus Modena bei der Erforschung von Meteoriten gewürdigt wurde.
Innerhalb weniger Wochen verfasste Troili ein 120 Seiten starkes Buch über das analysierte Fragment, in dem er Vermutungen über dessen Herkunft äußerte. Er stellte sich eine gewaltige unterirdische Explosion vor, die das Material in die Luft geschleudert hatte. Der Pater debattierte seine Thesen auch mit anderen Gelehrten seiner Zeit, und zumindest in einem Punkt herrschte Übereinstimmung: Der Stein war gewiss irdischen Ursprungs und durch eine auf der Erde wirkende Kraft emporgewirbelt worden.
Zwei Jahre nach Albareto sauste neuerlich ein extraterrestrischer Brocken zu Boden, der die Wissenschaft auf den Plan rief. Am Nachmittag des 13. September 1768 blieb einigen Erntehelfern in Lucé, Frankreich, der Mund offenstehen, als nach Donnerschlägen aus buchstäblich heiterem Himmel ein Stein aufs Feld fiel und sich ein gutes Stück im Boden eingrub. Die Akademie der Wissenschaften in Paris, die von dem Vorfall unterrichtet worden war, schickte drei Chemiker, um die Sache mit den Methoden strenger Naturwissenschaft zu prüfen. Die Experten, darunter ein Mann namens Antoine-Laurent de Lavoisier, beschrieben ebenfalls eine dünne, schwarze Kruste sowie ein gräulich schattiertes Inneres samt metallischen Körnchen. Vor allem aber nahmen sie die erste chemische Analyse eines Meteoriten vor. Resultat: 55,5 Prozent glasig wirkende Erde, 36 Prozent Eisen, 8,5 Prozent Schwefel.
Später entwickelte Lavoisier eine eigene Theorie über die Entstehung derartiger Objekte. Er vertrat die Ansicht, sie könnten unter besonderen Umständen in der Erdatmosphäre geformt werden. Würden Luftschichten elektrisch aufgeladen, gewissermaßen „entzündet“, könnte sich Staub womöglich zu Brocken aus Gestein und Metall zusammenballen. Auf diese Weise würden solide Körper in der Atmosphäre heranwachsen, aus der sie anschließend zur Erde fielen.
Von besonderem wissenschaftlichen Wert war außerdem ein Fund in Sibirien. Der deutsche Naturforscher Peter Simon Pallas durchstreifte im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts das russische Reich. Im Jahr 1772 machte er Station in einer Stadt namens Krasnojarsk. Während Pallas sich von den Strapazen erholte, schickte er einen Gehilfen auf Erkundungstour. Der schnappte im Dörfchen Ubeisk eine seltsame Geschichte auf: Dort lag ein riesiger Klumpen aus Metall, durchsetzt von rätselhaften Hohlräumen, die teils mit einer gelblichen Substanz gefüllt waren. Die Struktur des Objekts erinnerte ein wenig an einen Schwamm. Pallas beschloss, den mysteriösen, mehr als 700 Kilo schweren Körper zur näheren Untersuchung nach Sankt Petersburg transportieren zu lassen.
Eine mühevolle Prozedur, die sich über vier Jahre hinzog: Während der Wintermonate schleifte man das Trumm durch die Schneelandschaft, im Sommer kam man per Floß auf Flüssen voran. Im Mai 1776 traf die Fracht schließlich in der Kunstkammer von Sankt Petersburg ein. Nicht zuletzt das genaue Studium dieser Materialmischung, (heute heißen Meteoriten dieses Typs „Pallasit“), sollte einige Jahre später zu einem grundlegenden Umdenken über die wahre Herkunft der Meteoriten führen.
Ein brillanter Denker widerspricht Isaac Newton
Ernst Florens Friedrich Chladni, geboren 1756 in Wittenberg, war ein deutscher Physiker, der bereits bahnbrechende Arbeiten auf dem Gebiet der Akustik veröffentlicht hatte, als er sich für Meteoriten zu interessieren begann. Den Anstoß gab vermutlich eine Debatte mit seinem Fachkollegen Georg Lichtenberg, der die damals gängigen Erklärungsmodelle anzweifelte. So vertiefte sich Chladni ins Studium der merkwürdigen Steine, die aus dem Nichts auf die Erde zu fallen schienen.
Wie viele seiner Vorgänger, die Pionierleistungen auf dem Gebiet der Meteoritenkunde erbracht hatten, untersuchte auch Chladni zunächst eine Reihe von hinlänglich dokumentierten Ereignissen. Er schloss historische Darstellungen wie jene von Plinius ebenso wie zeitgenössische in seine Betrachtungen ein, darunter Tabor in Tschechien, Hraschina in Kroatien und einen Vorfall im britischen Sussex Mitte Juli 1771: Tausende von Menschen hatten dort gegen halb elf Uhr abends das Erscheinen eines gigantischen Feuerballs beobachtet, der später seine Bahn von Sussex bis nach Frankreich zog, vorbei an Paris, wo er weitere 50 Kilometer südwestlich in einer heftigen Explosion verschwand. Einige Augenzeugen behaupteten, der Feuerball sei mindestens so hell gewesen wie der Vollmond.
Chladni überlegte unter Berücksichtigung der damals geltenden Gesetze der Physik, wie die Phänomene erklärbar sein könnten. Riefen Nordlichter solche Leuchterscheinungen hervor? War Elektrizität im Spiel? Chladni ging die verschiedensten Ideen durch und schloss eine nach der anderen aus. Er hielt sie alle nicht für überzeugend. Der deutsche Physiker befasste sich insbesondere auch mit dem von Peter Simon Pallas geborgenen Ungetüm aus Eisen, und dieses Fundstück war letztlich titelgebend für sein im April 1794 publiziertes Buch: „Über den Ursprung der von Pallas gefundenen und anderer ihr ähnlicher Eisenmassen und über einige damit in Verbindungen stehende Naturerscheinungen.“
So sperrig die Überschrift am Buchdeckel klang, der Inhalt des Textes war aufsehenerregend und stellte eine Provokation für die zeitgenössische Fachwelt dar. Denn Chladni behauptete: Es gebe nur eine einzige plausible Erklärung für auf die Erde fallende Steine. Sie kämen aus den Weiten des Weltalls und würden als Meteoriten auf unserem Planeten einschlagen.
Im Wesentlichen formulierte Chladni drei Postulate. Erstens: Massen aus Stein oder Eisen stürzen tatsächlich vom Himmel herab. Zweitens: Feuerbälle entstehen, wenn solide Körper in der Erdatmosphäre abgebremst werden. Drittens: Die erwähnten soliden Massen haben ihren Ursprung weit draußen im Kosmos, entweder als kleine Objekte oder als Bruchstücke von Planeten, die zum Beispiel bei Kollisionen im All abgesprengt werden. Wörtlich schrieb er: „Das gesamte Beweismaterial macht es erforderlich, die Ansicht aufzugeben, dass im Weltenraum (Sonnensystem) nur die großen Weltkörper (Planeten, Monde) existieren.“
Diese Ausführungen waren hochgradig visionär, und Chladni befand sich fraglos auf der richtigen Fährte. Dennoch: Die Kollegenschaft war gar nicht begeistert. Sie kritisierte, Chladni stütze sich bei seinen Schlussfolgerungen auf Anekdoten und Ammenmärchen. Schon früher waren die Augenzeugenberichte häufig einfacher Menschen vom Land mit größter Skepsis ins Reich des Aberglaubens verwiesen worden. Man verspottete deren Schilderungen als Hirngespinste und irrationale Folklore, die der Aufmerksamkeit ernsthafter Gelehrter nicht würdig seien. Vor allem jedoch monierten viele Wissenschaftler: Chladnis Thesen widersprächen schlicht den Naturgesetzen. Und an denen sei ja wohl nicht zu rütteln.
Denn trotz aller Errungenschaften der Aufklärung, trotz der zunehmend rationalen Sicht auf die Welt hingen manche Dogmen der Antike mächtig nach, und vermeintlich unumstößliche Gebäude der Physik waren fest in den Köpfen verankert. Zum einen durchdrang die Philosophie des Aristoteles immer noch das Denken: Die Welt sei eine durch und durch göttliche und daher in jeder Hinsicht perfekt. In diesem Modell gab es keinen Platz für hässlich verbeulte, missgestaltete Steine, die durchs All schlingern und unvorhersehbar auf die Erde treffen. Zum anderen vertrug sich die Theorie der Gesteinsbrocken aus dem Kosmos nicht mit der Gravitationslehre von Isaac Newton: Sollten seine Gesetze der Schwerkraft Gültigkeit behalten, musste der Weltraum zwischen den Planeten leer sein. Umherdriftende Felsen hatten darin definitiv nichts verloren. Newton hatte festgeschrieben: Damit die Bewegung der Himmelskörper langfristig stabil bleibe, müsse der Himmel frei sein von sonstiger Materie, ausgenommen vielleicht ein paar Dämpfe oder Gase. Heute wissen wir, dass die Theorie des einstigen Säulenheiligen der Physik nur eingeschränkt richtig ist. Doch damals war eine widersprüchliche Ansicht fast Ketzerei.
Es half alles nichts: So sehr sich viele Zeitgenossen wehrten, Chladni hatte Recht, auch wenn er selbst eine Reihe von Fehlern beging. Der Kern seiner Theorie traf zu: Meteoriten stammen nicht aus Vulkanen und werden auch nicht in der Atmosphäre geboren, sondern aus den Weiten des Alls auf die Erde geschleudert. Aus diesem Grund gilt Chladni heute als Begründer der modernen Meteoritenwissenschaft.
Trotz aller Vorbehalte der Fachwelt hatte Chladni in gewisser Weise aber auch Glück: Hätte ein Verlag gezielt einen Bestseller planen wollen, er hätte keinen besseren Zeitpunkt wählen können als den Erscheinungstermin von Chladnis Werk. Denn kaum war sein Buch veröffentlicht, fielen an zahlreichen Orten weitere Meteoriten auf die Erde. Zwischen 1794 und 1796 landete kosmisches Gestein in Italien, England, Portugal, Indien, Sri Lanka und der Ukraine. Es war, als hätte Chladni seine Schrift punktgenau auf aktuelle Anlässe zugeschnitten.
Abzocke mit gefälschten Meteoriten
Zwei Monate nach dem Erscheinen von Chladnis Buch war das italienische Siena Schauplatz von Meteoritenfällen. Am frühen Abend des 16. Juni 1794 erfüllte Rauch den Himmel in nördlicher Richtung, Funken sprühten, hoch oben zuckten Blitze, gefolgt von den obligatorischen Detonationen. Dann flammte eine Wolke rot auf, und ein Schauer von Steinen ging über einem Vorort von Siena nieder. Augenzeugen gaben später zu Protokoll, dass ringsum Steine auf den Boden hagelten. Manche der Geschosse versengten Blätter auf den Bäumen, eines davon durchdrang angeblich sogar die Hutkrempe eines Buben. Einheimische sammelten die merkwürdigen Steine rasch ein und begannen, sie als Souvenirs an Touristen zu verkaufen. Als der Nachschub zur Neige ging, produzierten sie Fälschungen der Himmelssteine und verhökerten diese.
Siena war Universitätsstadt, weshalb die Gelehrten sogleich von dem Ereignis erfuhren. Der Mathematiker Ambrogio Soldani veröffentlichte innerhalb von drei Monaten ein 288-seitiges Buch darüber, in dem er außerdem seine Korrespondenz mit einem Mineralogen aus Neapel anführte. Dieser Mann mutmaßte, die Steine könnten eventuell einem Vulkan auf dem Mond entsprungen sein.
Im Jahr darauf traf es Wold Cottage, Yorkshire, England. Am 13. Dezember 1795 sah der Landarbeiter John Shipley zu, wie ein Stein aus den Wolken fiel und direkt vor seinen Füßen einschlug. Als der Brocken auf den feuchten Boden klatschte, spritzte Matsch auf Shipleys Kleidung. Einen Monat später erfuhr der Landeigentümer, ein etwas exaltierter Verleger namens Edward Topham, von der Sache und sorgte für öffentliche Aufmerksamkeit. Topham stellte den Stein in London aus und kassierte einen Shilling Eintritt pro Besichtigung. Später ließ er ein Denkmal errichten – bis heute vermutlich das einzige derartige Bauwerk, das einem Meteoriten gewidmet ist.
Dass ein Meteoritenfall in Portugal vom Februar 1796 der Nachwelt erhalten ist, verdanken wir dem Umstand, dass sich zu der Zeit gerade ein britischer Poet und Schriftsteller in der Gegend aufhielt. Er notierte Augenzeugenberichte und merkte an: „Wir hören manchmal, dass solche Phänomene historisch erwähnt sind, aber nie wollen wir daran glauben.“ Im selben Jahr wurde eine ähnliche Episode aus Irland bekannt, die sich bereits 1779 zugetragen hatte. Ein gewisser William Bingley aus Pettiswood, Westmeath County, schilderte einer Zeitschrift, wie ein Stein das Zaumzeug seines Pferdes getroffen habe. Das arme Tier sei augenblicklich ohnmächtig geworden. Überall habe es nach Schwefel gerochen. Bisher habe er niemandem davon erzählt, so Bingley, weil er gefürchtet habe, sich mit der Schauergeschichte lächerlich zu machen.
Aus wissenschaftlicher Sicht bedeutsam war, dass der junge englische Chemiker Edward Charles Howard mehrere Stücke von Meteoritenabstürzen aus dieser Zeit studierte. Howard verglich die chemische Zusammensetzung der Objekte und folgerte: Erstens gebe es äußerst auffällige Übereinstimmungen, beispielsweise einen ungewöhnlich hohen Gehalt des seltenen Elements Nickel. Und zweitens passe die Materialkomposition weder zu Vulkangestein noch zu den in der jeweiligen Gegend üblichen Mineralien.
Auch Ernst Chladnis Fachkollege Georg Lichtenberg publizierte um diese Zeit eine Arbeit über den „Steinregen zu Siena“, in der er Chladnis Interpretation hinsichtlich des Ursprungs der mysteriösen Himmelskörper beipflichtete. Außerdem beauftragte er zwei Studenten, einen Mathematiker und einen Astronomen, zwei Monate lang den Nachthimmel zu überwachen und nach verdächtigen Objekten Ausschau zu halten, die womöglich Chladnis Theorie stützen könnten. Die Studenten traten ihren Wachtposten in Lichtenbergs Garten in Göttingen an. Der Erfolg übertraf alle Erwartungen: Im September und Oktober 1798 beobachteten die Studenten 402 Meteore, 22 davon zogen sogar gleichzeitig übers Firmament. Beeindruckt von diesen Resultaten, notierte Lichtenberg: „Gott möge verhindern, dass solch feurige Körper jemals die Erde streifen.“ Und fügte noch hinzu: „Zumindest hoffe ich, dass mir nichts dergleichen jemals auf den Kopf fallen möge.“
Trotzdem war noch nicht allgemein akzeptiert, dass Meteoriten aus den Tiefen des Kosmos zur Erde gelangen. Das änderte sich erst nach einem weiteren Steinregen 1803. Am 26. April dieses Jahres prasselten nahezu 3.000 Boliden auf L’Aigle in der Normandie. Der französische Innenminister schickte den jungen Physiker Jean-Baptiste Biot in die Region. Biot zeichnete zunächst eine detaillierte Karte des Meteoritenstreufeldes. Er befragte Augenzeugen und stellte mathematische Berechnungen über die Bahn solcher zur Erde fallenden Objekte an. Mitte Juli 1803 trug er seine Erkenntnisse in Paris vor, und dies gilt heute als der große Wendepunkt: Seine Ausführungen wurden als definitiver Beweis für die Tatsache gewertet, dass Steine kosmischen Ursprungs sind und daher auch vom Himmel fallen können. Biot selbst geizte nicht gerade mit Superlativen. Er betrachtete seine Erkenntnisse „ohne Zweifel als das erstaunlichste Phänomen, das jemals von Menschen beobachtet wurde“. Das mochte zwar dezent übertrieben sein, doch war damit das Rätsel über die Herkunft der Meteoriten gewissermaßen offiziell gelöst.