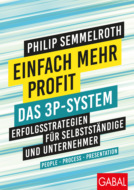Kitabı oku: «Die Zukunft ist menschlich», sayfa 5
Medienmarken als Orientierung
Marken geben Orientierung. Wenn mir das Nachrichtenmagazin Stern gut gefällt, so bin ich geneigt, weitere Blätter, die unter dem gleichen Markendach erscheinen, zu probieren. Und auch die Website interessiert mich vermutlich mehr, wenn ich jahrelang das Heft gelesen habe.
Nachrichten definieren sich darüber, dass sie einen »Neuigkeitswert« haben, also eine Meldung wert sind. Je mehr »Gewimmel« und Wettbewerb, desto effizienter müssen Anbieter arbeiten, um zu erreichen, dass wir ihre Nachrichten anklicken. Das heißt, es werden immer mehr Klicks in immer kürzerer Zeit, die sich der Einzelne für die Auswahl nimmt, angestrebt. Denn dort, wo sich viele Menschen aufhalten, sind attraktive Werbeflächen, die die Webseite finanzieren. So funktioniert das heutige Geschäftsmodell in der Nachrichtenbranche. Im Wettbewerb um die meisten Leser treffen wir daher im digitalen Medium vermehrt auf recht reißerische, laute Schlagzeilen. »Clickbait«, zu Deutsch: Klick-Köder, nennt man das Vorgehen, möglichst viel Neugier mit der Überschrift zu wecken, sodass der Leser hineinklicken will. Folgt man dem Aufreißertitel, landet man allerdings häufig bei journalistisch schwachen bis unbrauchbaren Informationen und hat damit wertvolle Zeit verloren. Der Marke, die dafür verantwortlich ist, tut das sicher nicht gut – zumindest langfristig nicht.
Die Frage ist: Wie gehen wir mit falschen Informationen um? Können wir sie überhaupt erkennen? Können wir bei der Vielfalt des Angebots den Absender und dessen Glaubwürdigkeit immer einschätzen?
Wer sich stets bei der Medienmarke seines Vertrauens aufhält und von der Qualität der Information nicht enttäuscht wird, fühlt sich selbst beim flüchtigen Lesen gut informiert und wird dort mehr Zeit verbringen. Die Nutzungsstatistiken zeigen aber, dass wir zunehmend Informationen »googeln« und damit auf beliebigen Seiten landen, die der Algorithmus uns vorschlägt.
Worauf klicken Sie in der Ergebnisliste Ihrer Online-Suche? Jeder Einzelne sollte seinen eigenen Medien- und Nachrichtenkonsum hinterfragen. Geht es um echte Information? Wenn Unterhaltung und Information ineinanderfließen, ist es manchmal schwer, das eine vom anderen zu unterscheiden. Bereits in klassischen Medien, ob Print oder TV, markiert das Wort »Anzeige« oder »Produktplatzierung« in der oberen Ecke den Hinweis für den Leser oder Zuschauer, dass ein Beitrag bezahlt, sprich: nicht journalistisch recherchiert und aufbereitet wurde.
Während klassische Zeitungsverlage ihre Auflage kaum halten können, gewinnen Social-Media-Kanäle mit sogenannten Influencern millionenfach Abonnenten. Jeder kann jederzeit seinen Kanal in den sozialen Medien wie YouTube, Instagram oder Facebook oder seinen Audio-Nachrichtenkanal als Podcast starten und sich der Öffentlichkeit stellen. Authentische Kommunikation vom selbst auserkorenen Meinungsmacher. Fühlen wir uns so gut informiert?
Influencer sind inzwischen ebenso verpflichtet, ihren Beitrag zu markieren, wenn sie bezahlt wurden. Die oftmals sehr jungen Persönlichkeiten werden inzwischen professionell vom Marketing bekannter Marken eingesetzt, um etwa die junge Zielgruppe authentisch von neuen Produkten zu überzeugen. Tatsächlich ist die Glaubwürdigkeit eines Influencer-Beitrags hoch, insbesondere wenn ein Produkt sowohl positiv wie negativ besprochen wird. Also eben keine klassische Werbung ist, in der nur die hochglanzpolierte Seite eines Produktes gezeigt wird, wie etwa der Burger, der auf dem Foto perfekt aussieht, aber nicht dem Produkt gleicht, das uns im Schnellrestaurant über den Tresen gereicht wird. Selbst wenn der Influencer seinen Beitrag als Werbung markiert, ist dieser immer noch überzeugender als die einseitige, nur positive Darstellung eines Produkts.20 Authentizität einer »echten« Person, der ich vertraue, scheint sich auszuzahlen. Hauptsache, ich fühle mich auch ehrlich informiert.
In Zeiten beliebig vieler Absender und nahezu unendlicher Möglichkeiten kann jeder sein eigener Sender sein und »auf Sendung« gehen. Dem Nutzer fällt es schwer auszuwählen, woran man sich orientieren und wem man Glauben schenken darf. Ein Beispiel: Vielleicht haben Sie vom Fall Cambridge Analytica im US-Wahlkampf 2016 von Hillary Clinton gegen Donald Trump gehört? Kurz nach Trumps Sieg meldete sich die Technologiefirma und verlautbarte, dass sie Trump zum Sieg verholfen habe. Sie hatte (wie man heute weiß, illegal) Profildaten von 50 Millionen Amerikanern auf Facebook erhalten, diese ausgewertet und entsprechend einem gefundenen Suchraster gezielt Nachrichten ausgespielt, die unentschiedene Wähler überzeugen sollten, Donald Trump zu wählen.21 Ein Vorfall in solchem Ausmaß kann bedeutenden Einfluss auf unsere Demokratie haben.22 Mit der ethischen Frage werden wir uns später noch beschäftigen.
Auch wenn die Aussage des Unternehmens vor allem einem Werbeeffekt diente und allem Anschein nach übertrieben war, so ist das Szenario real: Es liegen jede Menge Daten über einen Menschen vor, der digital, sei es in sozialen Medien wie Facebook, in Messengern oder einfach in Apps, aktiv ist. Mit jedem Like, jedem Beitrag, jeder Reaktion steigt das Wissen im Netz über den Einzelnen. Technisch ist es ein Leichtes, die Daten zu teilen, sie zu analysieren und je nach Zielgruppe eine andere Werbung auszuspielen. Sie erinnern sich an das Wenn-dann-Prinzip von oben? Dies ist nichts anderes. Vereinfacht gesagt, suchte der Algorithmus in den Profildaten nach Hinweisen auf Unentschlossenheit oder andere relevante Merkmale und dann griff »Wenn unentschlossen, dann Meldung xy einblenden«. Das heißt für Sie als Nutzer digitaler Dienste, genauer hinzusehen, zu hinterfragen und im Detail zu lesen, was Ihnen an Informationen dargeboten wird. Seien Sie kritisch und reflektieren Sie das Gelesene im eigenen Kontext. Setzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand ein.
Datenanalyse: ein Zukunftsfeld in nahezu allen Märkten
Wenn Sie Berichte oder Stellenausschreibungen lesen, stellen Sie fest, wie groß die Nachfrage nach Datenexperten ist. Im Februar 2019 meldete zum Beispiel SAP, der größte Softwarehersteller Europas, die Entlassung von über 4000 Mitarbeitern und gleichzeitig die massive Suche nach neuen Mitarbeitern – mit anderen Digitalkompetenzen in den Feldern Künstliche Intelligenz, Cloud Computing und Internet der Dinge. Genau aus diesem Grund: Es gibt Unmengen an Daten. Diese intelligent auszuwerten und zu nutzen ist ein Markt der Zukunft und eine ganz wesentliche Veränderung aller Märkte, in denen wir uns bewegen – inklusive der Softwareindustrie selbst.
Die Frage ist, wie wir diese datengetriebene Zukunft positiv für den Menschen gestalten. Jeder Einzelne sollte die Gelegenheit haben, gut und objektiv informiert zu sein. Einerseits ist Bildung relevant: Jedes Kind – ebenso wie jeder Erwachsene – muss verstehen und sich bewusst machen, was es heißt, Datenspuren zu hinterlassen. Dabei sollte nicht die rein negative Sicht auf die Dinge überwiegen, sondern schlicht ein Bewusstsein geschaffen werden, dass man bewusst entscheiden kann, in welchen Kanälen man sich wie engagiert.
Ich lasse es mir etwa nicht nehmen, mit meiner Familie in Syrien in Kontakt zu sein, beschäftige mich allerdings mit den entsprechenden Einstellungen der Privatsphäre und stelle bspw. keine Fotos meiner Kinder ins Netz. Natürlich gibt es ein Risiko, dass meine Daten abgelauscht werden, aber hier halte ich es mit einer ganz persönlichen Risikoabwägung: Wie groß ist das Risiko im Verhältnis zu meinem persönlichen Bedürfnis, in Kontakt zu sein? Entsprechend entscheide ich, was ich wo teile.
Damit Sie selbst eine Haltung für Ihren Umgang mit dem Digitalen einnehmen können, werden Sie später einen Einblick in die Möglichkeiten der Datenanalyse erhalten. Dies soll keine Angst machen, sondern Bewusstsein dafür schaffen, dass wir mit unseren persönlichen Daten Spuren hinterlassen und bewusst damit umgehen sollten. Gleichermaßen möchte ich Sie an aktueller Forschung zum Thema teilhaben lassen.
Noch viel wichtiger ist aber für alle, die Verantwortung für einen Datenfundus tragen, wie sie damit verfahren. Der Marktforscher unterliegt seit jeher besonderen Regeln, denen er sich verpflichtet, und zwar nicht nur den geltenden Datenschutzgesetzen, sondern auch strengen und berechtigten Standesregeln.23 So werden bspw. persönliche Daten immer getrennt von Aussagen gespeichert und anonym analysiert. Marketing, also das Bewerben etwa eines Produktes, ist stets streng von der Forschung getrennt und einem Marktforscher gar nicht erlaubt. Diese Regeln machen vollkommen Sinn, da sie eindeutig festlegen, dass derjenige, der das Wissen über eine Zielgruppe hat, zwar generelle Ableitungen festhalten darf, aber auf keinen Fall sein besonderes Wissen über, sagen wir mal, Lieschen Müller ausnutzen darf. Der Fall Cambridge Analytica hätte in der Marktforschung nicht stattfinden können. Ein Technologieunternehmen fühlt sich solchen Richtlinien allerdings nicht verpflichtet.
In einem öffentlich geförderten Forschungsprojekt untersuchten wir den Umgang mit Daten genauer24 und haben eines gelernt: Wer bewusst Daten teilt (etwa in Umfragen), empfindet die (anonyme) Analyse der Daten als unbedenklich. Ebenso verhält es sich, wenn ein Problem gelöst werden soll und etwa der Techniker Zugriff auf die Haustechnik erhält, um die Heizung oder die Internetverbindung wieder in Gang zu bringen. Im neuen SmartHome, also dem vernetzten Zuhause, werden eine Menge Informationen gesammelt (wann wird wo Licht angeschaltet, die Waschmaschine oder Heizung angestellt usw.). Wenn diese mit einem Dienstleister geteilt werden sollen, damit er einen Schaden behebt, ist auch hier das Teilen in Ordnung. Darüber hinaus nicht. Der Nutzen, also hier das Lösen eines Problems, muss immer klar gegeben sein.
Am sensibelsten sind Finanzdaten, wie etwa Kontoinformationen. Knapp dahinter rangieren Gesundheitsdaten, die ebenfalls hoch sensibel sind.25 Am unkritischsten empfinden wir den Namen unseres Haustiers, die sensibelste Information dagegen ist das Passwort. Überlegen Sie: Haben Sie schon einmal selbst ein Passwort vergeben? Und halten Sie ein Haustier? Haben Sie den Namen Ihres Tiers schon einmal in einem Passwort verwendet? Ich habe mich dabei schon erwischt und befinde mich dabei in guter Gesellschaft.26
Betrachten wir das Thema Gesundheitsdaten genauer. Erinnern Sie sich noch an Ihr Gefühl, als Sie zu Beginn von der intelligenten Toilette hörten, die Ihre Daten automatisch an den Arzt sendet? Wie sehen die Menschen also die Weitergabe von Gesundheitsdaten? Wenn wir in Zukunft durch das Auswerten unserer Daten bessere Therapien für Krankheiten erwarten könnten, wäre der Nutzen sehr groß. So stimmen die Menschen der Weitergabe ihrer Gesundheitsdaten zu diesem Zweck mehrheitlich zu. Kritisch wird allerdings der Aspekt gesehen, als Person identifiziert zu werden. Nur wenn die Wahrscheinlichkeit, als Person erkannt zu werden, ganz gering ist, teilen die Menschen Gesundheitsinformationen. Was beim Hausarzt für den persönlichen Check-up vielleicht noch in Ordnung ist, stößt auf ein großes Hindernis, wenn es darum geht, diese Gesundheitsdaten anderweitig zu teilen. Es kommt hier wesentlich auf den Kontext und den Empfänger an: So sind Menschen mehrheitlich bereit, ihre Gesundheitsdaten mit wissenschaftlichen Institutionen wie Universitäten oder Unikliniken zu teilen, lehnen aber eine Weitergabe an Versicherungsunternehmen oder private Wirtschaftsunternehmen, die einen Nutzen daraus ziehen, deutlich ab. Ebenso ist von Bedeutung, um welche Art von Krankheit es geht: Informationen zur generellen Gesundheit, physische oder auch chronische Krankheiten werden tendenziell eher geteilt als mentale Krankheiten, zu denen die meisten generell keine Informationen weitergeben wollen.27
Sollten Sie gefragt werden, ob Sie Ihre Gesundheitsdaten teilen, denken Sie gut darüber nach und informieren Sie sich. Wem wollen Sie diese für welchen Zweck weitergeben? Dient es vielleicht der Gesellschaft? Ist der Service kostenlos, dann zahlen Sie oftmals mit Ihren Daten. Das sollte Ihnen bewusst sein. Und zu guter Letzt: Vertrauen Sie dem Empfänger Ihrer Daten? Damit werden wir uns noch detaillierter beschäftigen. Dies gilt für digitale Gesundheits-Apps und Fitnesstracker ebenso wie für Institutionen. Machen Sie sich die Mühe, die Dateneinstellungen genau anzuschauen und Vereinbarungen zu lesen oder nachzufragen. Seriöse und gute Anbieter werden es Ihnen leicht machen, diese zu finden. Alle anderen löschen Sie vielleicht besser gleich von Ihrem Smartphone. Denn das geht ganz leicht und ist für die digitalen Märkte eines der größten Risiken. Sie verschwinden von der Bildfläche, als Datenpunkt und als Kunde. Und Sie hoppen einfach zum nächsten Anbieter, dem Sie in Sachen Datenschutz mehr vertrauen. (Wie sich unser Anspruch an Marken im digitalen Zeitalter ändert, darauf schauen wir in Kapitel 3 genauer, und von der Gesundheit in Zeiten der Digitalität sprechen wir noch in Kapitel 4.)
Nun haben wir viel auf Online-Angebote oder Apps geschaut. Natürlich geht die Digitalisierung deutlich weiter. Manches Mal manifestiert sie sich sogar in einem Gegenüber: einem Roboter, der menschenähnlich agieren soll. Und wir fragen uns, ob so die digitale Zukunft aussieht.
Roboter statt Mensch
Das menschliche Gehirn ist eben nicht zum Auswendiglernen von Sachverhalten, sondern für das Lösen von Problemen optimiert.28
Gerald Hüther
Man sieht sie überall, die Roboter. Nicht nur auf Fotos, sondern auch im Praxiseinsatz – zumindest testweise. Was denken Sie und wie fühlen Sie sich, wenn Sie mit einem konfrontiert werden? Befinden sich Mensch und Roboter auf Augenhöhe?
China führte uns gerade vor, dass Roboter den Stuhl des Nachrichtensprechers übernehmen können.29 Wird vielleicht im nächsten Schritt nicht nur das gedruckte Magazin, die Zeitung und ihr Produktionsprozess, sondern auch der Sprecher digitalisiert? Ist das digitale Pendant vergleichbar mit dem realen Sprecher? Lassen wir Kulturunterschiede zwischen dem asiatischen Kulturraum und unserem beiseite und beschränken uns auf Ihre persönliche Wahrnehmung. Der Roboter liest brav die Weltnachrichten vor. Kein Versprecher, keine Gefühlsregung. Welche Eigenschaften vermittelt Ihnen der Roboter? Was erwarte ich von einem Sender und seinem Nachrichtensprecher? Ist es nur Gewohnheit, dass ich mir keinen Roboter vorstellen kann?
Lassen Sie uns darüber nachdenken, welche Auswirkungen diese Art der Digitalisierung auf unsere Wahrnehmung eines Anbieters hat.
Bundeskanzlerin trifft Sophia
Sophia ist ein menschenähnlicher Roboter. Gebaut vom Hongkonger Unternehmen Hanson Robotics gilt er – oder besser sie oder gar es? – aktuell als eine der fortschrittlichsten Entwicklungen hinsichtlich des Aussehens, Verhaltens und Reaktionsvermögens. Man schaut durch eine transparente Schädelplatte in sein Gehirn, das aus vielen Drähten und Platinen besteht. Das Gesicht ist bestmöglich als hübsche Maske nachgebaut, der Oberkörper steht regungslos, aber bekleidet mit einem Standardoutfit, bestehend aus Shirt und Jacke. Das Gesicht dreht sich dorthin, wo er eine Stimme vernimmt. Man nimmt leichte Veränderungen der Gesichtszüge wahr, die den Ausdruck von Emotionen vermitteln wollen.
Im Sommer 2018 traf Bundeskanzlerin Merkel auf den nachgebauten Menschen Sophia und plauderte mit ihm.30 Spricht die Kanzlerin, schaut Sophia dorthin. Sophia nimmt auf, was sie hört, und man kann zusehen, wie sie es verarbeitet. Es dauert, bis eine Antwort kommt. Und die Antwort ist entweder ein Abspulen von Gelerntem oder – keine passende Antwort.
Selbst wenn die Maschine in Zukunft noch schneller wird und mehr lernt, so bleibt sie doch eine Antwortmaschine auf Fragen. Keine wahre Emotion, keine Absurdität in den Antworten, wie sie vielleicht vom Menschen kämen. Keine menschliche Emotion oder gar Unberechenbarkeit. Höchstens ein Algorithmus, der arbeitet und irrt oder nicht weiterweiß.
Wenn man das Video von diesem »Gespräch« mit offenen Augen anschaut, stellt man fest, wie weit entfernt der Computer-Mensch vom realen Menschen ist. Es macht womöglich Angst, zu sehen, dass hier ein Mensch mit seinen Antworten nachgebaut wird. Aber auf Augenhöhe ist die Maschine noch nicht und wird es sehr lange nicht sein.
Die Frage ist ja, in welchen Anwendungen macht ein solcher Computer-Mensch Sinn? Positiv ist, dass man gleich erkennt, dass es sich um einen Computer handelt, der Mensch hier also nicht im Ungewissen bleibt. Wir werden später noch sehen, dass das bisweilen schon nicht mehr selbstverständlich ist.
In Japan wird mit Robotern für den Check-in-Prozess im Hotel experimentiert.31 Für das sogenannte Hospitality-Business, also Gastfreundschaft, finde ich diese Idee persönlich befremdlich. Und Sie? In welchen Lebenssituationen möchten wir von einem Computer bedient werden? Natürlich kann man über die reine Kostensicht argumentieren, dass der Roboter viel günstiger ist und Routinefragestellungen bearbeiten kann. Die Frage ist, ob das Gegenüber, solange es ein Mensch ist, also etwa der Gast im Hotel, den Service schätzt oder beim nächsten Mal einen anderen Anbieter wählt.
Gunter Dueck prägte den Begriff des »Bildschirmrückseitenberaters« als prägnante Umschreibung für alle Jobs, die früher oder später überflüssig werden.32 Er meint damit all jene, die heute vor dem Bildschirm sitzen und Formulare für den Kunden ausfüllen, während der Kunde wiederum auf die Rückseite des Bildschirms schaut. Viele dieser Formulare werden in der Zukunft wohl direkt online dem Kunden bereitgestellt und von ihm selbst ausgefüllt werden. Sofern keine Beratung, soziale Interaktion oder menschliche Zuwendung notwendig ist, werden diese Aufgaben zukünftig von der Maschine erledigt. Dies trifft den Bankberater, die »Frau vom Amt«, die Kassiererin im Supermarkt usw.
Die Frage ist: Wo wird die menschliche Zuwendung wertgeschätzt? Oder wo wird sie womöglich sogar zum Differenzierungsmerkmal?
Ersetzt die Maschine den Menschen?
Der Mensch ist Etwas, das überwunden werden soll.
Friedrich Nietzsche (1844–1900)
Kaum geht es in einem Zeitschriften- oder Buchtitel um Digitalisierung, muss der Roboter als Aufmacher herhalten. Er ist das Sinnbild der Digitalisierung und uns Menschen beschleicht die Angst: Sieht so das Morgen aus und wird der Mensch in dieser technisierten Zukunft bedeutungslos? Das ist eine berechtigte Frage.
In vielen Technologie- und Digitalisierungsdiskussionen geht es vorrangig darum, wer digital höher, schneller, weiter springen kann, um bisherige Aufgaben des Menschen von nun an maschinell zu lösen. Die Technologie steht so sehr im Vordergrund, dass man meinen könnte, der Mensch wurde aus den Augen verloren, ja, als ginge es darum, den Menschen zu überwinden. So manche digitale Neuigkeit wirkt, als würde sie schlicht in den Markt eingeführt, »weil man kann«. Weil es technisch machbar ist, nicht weil jemand – ein Mensch – darauf gewartet hat.
Ob eine Innovation sinnvoll und erfolgreich ist, hängt jedoch maßgeblich vom Menschen ab. Er entscheidet, was Innovationen, insbesondere auch digitale Innovationen, erfolgreich macht und wo sie an Grenzen stoßen. Die Messlatte hierfür ist vor allem, ob sie einen relevanten Nutzen für den Menschen haben und ob wir die Effektivität (= das Richtige tun) im Blick haben und vor die Effizienz setzen (= die Dinge richtig bzw. immer schneller und günstiger tun).
Soll die Maschine dem Menschen dienen oder umgekehrt? Vermutlich beantworten wir diese Frage alle gleich mit »Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen« – vorausgesetzt, Sie, verehrte Leserin, verehrter Leser, sind ein Mensch. ;-) Aber davon gehe ich einmal fest aus, sonst würde mir dieses Buch nicht so am Herzen liegen.
Warum nur diskutieren wir dann das Maschinenzeitalter so vehement? Warum sorgen wir uns so sehr, dass die technologische Singularität33 eintrifft, in der sich Maschinen mit künstlicher Intelligenz selbst so verbessern, dass sie dem Menschen überlegen werden könnten? Aus meiner Sicht wird dies nie eintreten, allein schon weil Maschinen selbst nichts verstehen und sie darauf angewiesen sind, dass wir Menschen es ihnen beibringen. Es sei denn, wir bewegen uns in einem Science-Fiction-Szenario.
Ich denke, es liegt daran, wie wir über Digitalisierung reden. Denjenigen zu belächeln, der die digitale Welt als Neuland bezeichnet, ist einfach. Zu erklären, was sie denn nun eigentlich ausmacht, deutlich schwerer. Ich bin überzeugt, wir brauchen mehr Aufklärung und Verständnis, was Digitalisierung, insbesondere für den Einzelnen, genau bedeutet.
Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden.
Dieser Satz wurde vielfach zitiert, u. a. von Ossi Urchs und Tim Cole in dem lesenswerten Buch »Digitale Aufklärung« aus dem Jahr 2013.34 Und wir glauben das sofort. Ist unser Leben doch heute schon von digitalen Geräten und Funktionen durchdrungen. In Zeitungsartikeln, Fernsehbeiträgen oder den sozialen Medien begegnen uns jede Menge Fachbegriffe, die sich nicht selbst erklären, und vermeintliche Experten schauen düster genug drein, dass Sie schnell glauben, die Maschine würde uns Menschen alsbald überholen und überflüssig machen. Viele in der heutigen Gesellschaft fühlen sich schlicht abgehängt von den neuen technologischen Möglichkeiten und ergeben sich intuitiv einem der beiden Reflexe: Schockstarre oder Flucht.
Dies gilt gerade für uns Deutsche: Aus 30 Jahren Erfahrung in Digitalisierung und Forschung würde ich sagen, wir Deutsche befinden uns zu großen Teilen in Schockstarre oder auf dem Rückzug. »Ich muss das nicht mehr lernen«, »Ich bin zu alt« oder »Ich will das nicht« sind typische Aussagen, sobald ein noch unbekanntes Gerät oder neuartiger Dienst auf dem Markt erscheint. Und während vieles Einzug in unseren Alltag findet, wir Geräte und Services passiv nutzen, entwickeln wir allzu selten selbst eine digitale Neuheit oder passen selbst etwas unseren Wünschen an. Manch einer glaubt, die Digitalisierung sei wie ein Schnupfen und gehe schon wieder vorbei. Dabei sind die Anzeichen eindeutig: Sie bleibt und schreitet immer schneller voran.
Ich will nicht sagen, dass wir willkürlich die Arme ausbreiten sollten, um die Digitalisierung bedenkenlos willkommen zu heißen. Eine gesunde Skepsis und ein Hinterfragen ist ebenso angebracht wie ein gesundes Selbstbewusstsein als Mensch, indem wir uns auf unsere Menschenwürde besinnen. Aber wie soll man das bewerkstelligen, bei dieser Geschwindigkeit? Wer hätte gedacht, dass schon zehn Jahre nach seiner Einführung fast drei Viertel der Nutzer sich ein Leben ohne Smartphone (übersetzt heißt es treffenderweise das »schlaue Telefon«) nicht mehr vorstellen können?35
Wie wäre es, wenn wir den Spieß umdrehen und den Menschen bei allen neuen Entwicklungen in den Mittelpunkt stellen? Stellen wir uns einmal vor, es würde eben nicht zwingend alles digitalisiert, was technisch digitalisiert werden kann, sondern nur das, was auch dem Menschen nutzt. Dabei will ich hier bewusst weniger auf die Prozessoptimierungen der ersten Welle schauen, die Routineaufgaben automatisieren, sondern vielmehr auf neu entstehende digitale Innovationen.
Betrachten wir die Konsumentenmärkte: Hier herrscht nach wie vor Angebot und Nachfrage, sogar noch dynamischer als bisher. Modekollektionen der großen Textilhandelsunternehmen wechseln inzwischen wöchentlich und folgen damit schnellstens den Vorlieben ihrer Kundschaft. In ersten Pilotprojekten wird der Pulli heute schon im Ladenlokal gestrickt und kann gleich mitgenommen werden, im 3D-gedruckten Turnschuh der Zukunft wird für Sie individuell Fußbett und Sohle hergestellt. Dies ist ein erstes Ergebnis der Digitalisierung im Produktionsprozess, bei dem individualisierte Produkte möglich werden.
Digitale Produkte ohne Nutzen dagegen werden nicht lange am Markt bestehen, weil keiner sie kauft, herunterlädt und – selbst kostenlos (Sie erinnern sich? Sie zahlen mit Ihren Daten) – nicht nutzt. Ich bin fest überzeugt, dass diese Quote im digitalen Kosmos noch deutlich höher liegt, wenn in der Konsumgüterindustrie (also Produkte wie Zahnpasta, Schokolade oder Dosensuppen) mindestens drei von vier neu eingeführten Produkten floppen.36 Mein Tipp liegt bei mindestens 90 %, also neun von zehn Ideen, die in den Markt kommen, gehen meist sang- und klanglos unter. Wenn die Dynamik weiter ansteigt, werden wir schnell auch 99 % erreichen oder mehr. Irgendwann wird nur noch jede tausendste App ein wahrer Erfolg, die genug Menschen erreicht, um wirtschaftlich bestehen zu können. Warum? Weil man technologisch vieles umsetzen kann, worauf aber leider kein Mensch gewartet hat. Die »Jede Woche eine App«-Philosophie ist nicht nachhaltig. Vielmehr sollten sich Macher von Apps vorab damit beschäftigen, was dem Menschen wirklich dient, statt einfach in die Tasten zu hauen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.