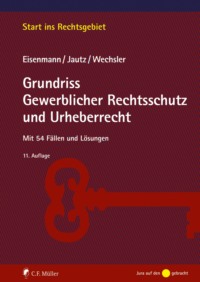Kitabı oku: «Grundriss Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht», sayfa 2
Abkürzungsverzeichnis
| a.A. | anderer Auffassung |
| a.a.O. | am angegebenen Ort |
| a.F. | alte Fassung |
| Abb. | Abbildung |
| AbzG | Abzahlungsgesetz |
| AEUV | Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union |
| AGB | Allgemeine Geschäftsbedingungen |
| Alt. | Alternative |
| ANEG | Gesetz über Arbeitnehmererfindungen |
| BAG | Bundesarbeitsgericht |
| BB | Betriebs-Berater (Fachzeitschrift) |
| BDSG | Bundesdatenschutzgesetz |
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
| BGH | Bundesgerichtshof |
| BGHZ | Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen |
| BMJ | Bundesministerium der Justiz |
| BT | Deutscher Bundestag Drucksache |
| DesignG | Designgesetz |
| DPMA | Deutsches Patent- und Markenamt |
| DSGVO | Datenschutz-Grundverordnung |
| DVO | Durchführungsverordnung |
| ECRL | E-Commerce-Richtlinie |
| EG | Europäische Gemeinschaft |
| EPA | Europäisches Patentamt |
| EPO | Europäische Patentorganisation |
| EPÜ | Europäisches Patentübereinkommen |
| EU | Europäische Union |
| EuG | Gericht der Europäischen Union |
| EuGH | Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften |
| EUIPO | Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum in Alicante |
| EWGV | Vertrag zur Begründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft |
| EWR | Europäischer Wirtschaftsraum |
| f. | ein(e) folgende(r) |
| ff. | mehrere folgende |
| G | Gesetz |
| GebrMG | Gebrauchsmustergesetz |
| GG | Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland |
| GEMA | Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte |
| ges. gesch. | gesetzlich geschützt |
| GeschGehG | Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen |
| GGVO | Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung |
| GMVO | Gemeinschaftsmarkenverordnung |
| GPÜ | Gemeinschaftspatentübereinkommen |
| GRUR | Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Fachzeitschrift) |
| GÜFA | Gesellschaft zur Übernahme und Wahrnehmung von Filmaufführungsrechten mit beschr. Haftung |
| GVL | Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten |
| GWB | Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen |
| HA | Haager Abkommen |
| HalblSchG | Halbleiterschutzgesetz |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| HS | Halbsatz |
| HWG | Heilmittelwerbegesetz |
| IHK | Industrie- und Handelskammer(n) |
| IuKDG | Informations- und Kommunikationsdienstegesetz |
| i.V.m. | in Verbindung mit |
| LFGB | Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch |
| MaMoG | Markenrechtsmodernisierungsgesetz |
| MarkenG | Markengesetz |
| MD | Magazin Dienst |
| MMA | Madrider Markenabkommen |
| n.F. | neue Fassung |
| NJW | Neue Juristische Wochenschrift (Fachzeitschrift) |
| o.g. | oben genannt |
| OLG | Oberlandesgericht |
| OMPI | französisch, vgl. WIPO |
| PatKostG | Patentkostengesetz |
| PMA | Patent- und Markenamt |
| PaMitt | Mitteilungen der deutschen Patentanwälte |
| PCT | Patent Cooperation Treaty |
| PAngVO | Preisangabenverordnung |
| PVÜ | Pariser Verbandsübereinkunft |
| RBÜ | Revidierte Berner Übereinkunft |
| RfStV | Rundfunkstaatsvertrag |
| RG | Reichsgericht |
| RL | Richtlinie der E(W)G |
| Rn. | Randnummer |
| RS | Rechtssubjekt |
| s. | siehe |
| sog. | so genannt |
| StGB | Strafgesetzbuch |
| StPO | Strafprozessordnung |
| TMG | Telemediengesetz |
| TRIPS | Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property |
| u.a. | und andere |
| UH | Urheber |
| UKlaG | Unterlassungsklagengesetz |
| UMV | Unionsmarkenverordnung |
| UrhG | Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte |
| u.U. | unter Umständen |
| UWG | Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb |
| VerlG | Gesetz über das Verlagsrecht |
| VG | Verwertungsgesellschaft |
| VO | Verordnung |
| WahrnG | Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten |
| WIPO | World Intellectual Property Organization |
| WRP | Wettbewerb in Recht und Praxis (Fachzeitschrift) |
| WTO | World Trade Organization |
| WUA | Welturheberrechtsabkommen |
| www. | World Wide Web im Internet |
| ZIP | Zeitschrift für Wirtschaftsprivatrecht und Insolvenzpraxis (Fachzeitschrift) |
| ZPO | Zivilprozessordnung |
| ZPÜ | Zentralstelle für private Überspielungsrechte |
| ZUM | Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht (Fachzeitschrift) |
Teil 1 Allgemeine Grundlagen zum Urheberrecht und zum Gewerblichen Rechtsschutz
A. Rechtsgrundlagen
1
Das Immaterialgüterrecht bezeichnet als Sammelbegriff diejenigen Rechtsgebiete, die den Schutz des geistigen Eigentums und somit der immateriellen Güter regelt.
Dabei ist das Urheberrecht geregelt im Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz = UrhG) geregelt.
Unter dem Gewerblichen Rechtsschutz versteht man herkömmlicherweise technische gewerbliche Schutzrechte wie
| - | das Patent, geregelt im Patentgesetz (PatG) und |
| - | das Gebrauchsmuster, geregelt im Gebrauchsmustergesetz (GebrMG). |
Auch die folgenden nichttechnischen gewerblichen Schutzrechte werden herkömmlicherweise dem Gewerblichen Rechtsschutz zugeordnet:
| - | das eingetragene Design, geregelt im Designgesetz (DesignG), |
| - | die Kennzeichenrechte, geregelt im Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG), |
| - | das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), und |
| - | das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG). |
Der Gewerbliche Rechtsschutz ist ein bedeutsamer Teil dessen, was man gemeinhin als Wirtschaftsrecht bezeichnet. Gerade auf diesem Gebiet war und ist, um die Ziele der Europäischen Union (EU) zu erreichen, eine Rechtsvereinheitlichung in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten erforderlich. Letzteres gilt – wenn auch bisher in etwas eingeschränkterem Maße – auch für das Urheberrecht.
Dieser europäische Harmonisierungsprozess ist bei den in diesem Grundriss zu behandelnden Rechtsgebieten insgesamt gesehen weit fortgeschritten. Der europäische Gesetzgeber hat eine Vielzahl von Gemeinschaftsnormen geschaffen. Bei der Darstellung der einzelnen Rechtsgebiete wird kurz auf die diesbezüglichen europäischen Grundlagen hingewiesen werden. Eine detaillierte Ableitung aus den jeweiligen EU-Normen würde den Rahmen eines Grundrisses sprengen. Ausgangspunkt für unsere Arbeit ist letztlich also das nationale deutsche Recht.
Was nun das Verhältnis des deutschen Rechts zum europäischen Unionsrecht angeht, so besteht hier zunächst eine generelle, alle Gesetze betreffende Grundproblematik, deren Handhabung Vielen von uns bekannt ist. Daher hierzu nur ganz kurz und plakativ Folgendes:
Es stellen sich zwei Hauptfragen: Welches Recht ist anzuwenden, das Unionsrecht oder das jeweilige nationale Recht der einzelnen Mitgliedstaaten? – Wie sieht es mit der Gerichtsbarkeit aus?
Das Unionsrecht hat Vorrang gegenüber den einzelnen nationalen Rechten der Mitgliedstaaten; es geht diesen vor. Dieser Anwendungsvorrang gilt nicht nur für die EU-Verordnungen – diese gelten unmittelbar in den Mitgliedstaaten –, sondern auch für die EU-Richtlinien. Jedoch müssen Richtlinien als Teil des sekundären Unionrechts in nationales Recht umgewandelt werden.
Auf dieser Grundlage erklärt sich, dass die nationalen Gerichte, bei uns letztlich der Bundesgerichtshof (BGH), Unionsrecht als innerstaatliches Recht anzuwenden haben. Strittige Rechtsfragen über Gültigkeit und Auslegung von EU-Normen können deutsche Gerichte, letztlich also der BGH, den europäischen Gerichten, letztlich also dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH), zur Vorabentscheidung vorlegen. Wir sehen also: Was europäische Normen angeht, hat der EuGH Auslegungskompetenz in letzter Instanz. Der Urteilsspruch selbst erfolgt hingegen durch die nationalen Gerichte.
Mittels dieses Vorabentscheidungsverfahrens soll durch den EuGH die Einheitlichkeit der Anwendung des EU-Rechts gewährleistet werden.
Hieraus erklärt sich, dass als höchstrichterliche Rechtsprechung einmal der EuGH, einmal der BGH zitiert wird.
B. Schutzgegenstand
2
Der Schutzgegenstand liegt sowohl beim Urheberrecht als auch beim Gewerblichen Rechtsschutz auf geistigem bzw. immateriellem Gebiet. Es geht um Rechte, die sich auf den schöpferischen Geist oder erfinderische Tätigkeit beziehen. Plakativ spricht man häufig vom „geistigen Eigentum“.
Da es sich hier nicht um den Schutz von materiellen Gütern handelt – wie etwa beim Eigentum –, sondern um den Schutz von immateriellen Gütern, pflegt man diese Rechtsgebiete auch als Immaterialgüterrechte zu bezeichnen.
Das Urheberrecht schützt Geistesschöpfungen, Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst (§ 2 I UrhG).
Beim Gewerblichen Rechtsschutz schützt die Rechtsordnung die geistige gewerbliche Leistung.
| - | Beim Patent: Schutz der erfinderischen gewerblichen Leistung auf dem Gebiet der Technik. |
| - | Beim Gebrauchsmuster: Schutz der erfinderischen gewerblichen Leistung auf dem Gebiet der Technik. |
| - | Beim eingetragenen Design: Schutz der gewerblichen Gestaltungsleistung. |
| - | Bei den Kennzeichenrechten: Schutz von gewerblichen Bezeichnungen als Marketingleistung. |
| - | Beim UWG: Schutz der unternehmerischen Leistung, aber auch Schutz der Verbraucher und der Allgemeinheit, dadurch, dass bestimmte geschäftliche Handlungen als „unlauter“ und damit unzulässig zu qualifizieren sind. Dieses Lauterkeitsrecht ist – im Grundsatz – als Sonderdeliktsrecht anzusehen. |
| - | Beim Schutz von Geschäftsgeheimnissen: Schutz von Informationen. |
Vgl. hierzu die folgende Übersicht:
Abb. 1: Gegenstand der Sonderschutzrechte

[Bild vergrößern]
C. Standort in der Gesamtrechtsordnung
3
Welchem der beiden großen Rechtskreise gehören das Urheberrecht und die Rechte des Gewerblichen Rechtsschutzes an? Dem Privatrecht, bei dem sich die Beteiligten gleichberechtigt gegenüberstehen (Koordination), oder dem öffentlichen Recht, bei dem der Bürger dem Staat untergeordnet ist (Subordination)?
Beispiele:
Unternehmer U geht vor gegen
| 1. | Unternehmer A, weil dieser einen Gegenstand, für den U ein Patent, ein Gebrauchsmuster oder ein eingetragenes Design hat, unbefugt gewerbsmäßig herstellt (§§ 9, 139 PatG, §§ 11, 24 GebrMG, §§ 38, 42 DesignG); |
| 2. | Unternehmer B, weil dieser die für U eingetragene Marke „Orizur“ widerrechtlich benutzt (§ 14 MarkenG); |
| 3. | Unternehmer C, weil dieser in seiner Werbung behauptet, seine Säfte schmecken besser als die des U (§§ 6,3 I, 8 I UWG); |
| 4. | Unternehmer D, weil dieser seinen künstlerisch gestalteten Werbeprospekt unbefugt nachahmt (§ 97 UrhG). |
In allen vier Fällen stehen sich U einerseits, A, B, C und D andererseits gleichberechtigt gegenüber: keiner ist dem anderen untergeordnet. Ergebnis also: Das Urheberrecht und die gewerblichen Schutzrechte gehören grundsätzlich dem Privatrecht an.
Im Rahmen des Privatrechts unterscheidet man bekanntlich das allgemeine und das besondere Privatrecht. Das allgemeine Privatrecht gilt für alle Bürger; es ist das bürgerliche Recht. Das Sonderprivatrecht gilt nur für bestimmte Personenkreise, z.B. für Kaufleute, für Arbeitnehmer. Wie nun das Handelsrecht das Sonderprivatrecht der Kaufleute, das Arbeitsrecht das der Arbeitnehmer darstellt, so ist auch der Gewerbliche Rechtsschutz Sonderprivatrecht, ebenso wie das Urheberrecht.
Aus dieser systematischen Stellung der genannten Schutzrechte als Sonderprivatrecht ergibt sich eine bedeutsame Erkenntnis: Sie sind im Grundsatz Spezialnormen, leges speciales, im Verhältnis zu den allgemeinen Normen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), den leges generales. Die lex specialis hat bekanntlich Vorrang vor der lex generalis. Dem BGB kommt daher nur lückenausfüllender Charakter zu. Diese Erkenntnis ist vor allem wichtig in Bezug auf den Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, ein sonstiges Recht i.S. von § 823 I BGB.
Beispiel:
Unternehmer A stellt eine Sache, auf die U ein Patent hat, gewerbsmäßig her. Hierbei wird neben § 9 PatG auch das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, ein sonstiges Recht im Sinne des § 823 I BGB, verletzt. Die letztere Vorschrift kommt hier als lex generalis nicht zur Anwendung, da wir in § 9 PatG eine Sondervorschrift haben.
Drücken wir es einmal anders aus: Das Konkurrenzproblem Sonderschutzrechte – BGB ist nach dem Prinzip der Subsidiarität zu lösen. Die Regeln des BGB sind subsidiär. Sie dürfen im Rahmen der Sonderschutzrechte nicht angewendet werden. Ausnahmen hiervon sind nur dann zulässig, wenn ergänzend Lücken zu schließen sind, die durch die Sonderschutzrechte nicht gedeckt und dennoch regelungsbedürftig sind. Für die Annahme derartiger Ausnahmefälle bedarf es jedoch konkreter Anhaltspunkte (BGH, GRUR 2009,871 – Ohrclips).
4
Wie sich in den Sonderprivatrechtsbereichen des Arbeits- und des Handelsrechts einige Gebiete finden, die dem öffentlichen Recht angehören (z.B. das Arbeitsschutzrecht sowie die Pflichten zur Anmeldung beim Handelsregister und zur Führung von Handelsbüchern), so gibt es auch bei den gewerblichen Schutzrechten Bereiche, die öffentliches Recht sind. Es sind dies zum Beispiel die zur Entstehung des Patent-, Gebrauchsmuster-, eingetragenen Design- und Markenrechts erforderliche Mitwirkung des Deutschen Patent- und Markenamtes oder die Strafbarkeit bei vorsätzlicher Verletzung der gewerblichen Schutzrechte. Auch im Urheberrecht und im UWG finden sich Teilbereiche öffentlichen Rechts, insbesondere strafrechtliche Vorschriften.