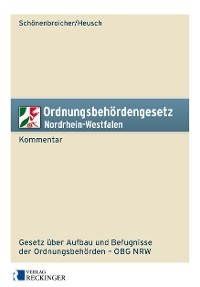Kitabı oku: «Ordnungsbehördengesetz Nordrhein-Westfalen – Kommentar», sayfa 8
III. Spezialgesetzliche Zuständigkeiten, Subsidiarität, Absatz 2
1. Allgemeines
73
Abs. 2 enthält eine Regelung, die man gesetzgebungstechnisch als pure Selbstverständlichkeit ansehen könnte, denn nach der allgemein anerkannten juristischen Methodenlehre gehen die speziellen Gesetze immer den allgemeinen Vorschriften vor. Außerdem ist es eigentlich Aufgabe der Gesetzgeber der speziellen Vorschriften, Regelungen über die Anwendbarkeit des OBG und über die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden zu treffen. Insofern könnte man Abs. 2 auch als eine Art einfach-gesetzgeberischer Zuständigkeitsusurpation des OBG-Gesetzgebers ansehen. Rietdorf führt als Grund für die Vorschrift an, mit ihr sei ein „entscheidender, im Interesse der Rechtsstaatlichkeit liegender Schritt getan, den Anwendungsbereich der Generalklausel möglichst klein zu halten“[232].
74
Allerdings stellt sich die Frage, ob das richtig ist: Wenn ein Fachgesetzgeber zwar Verhaltenspflichten normiert, aber keine spezielle Ermächtigungsgrundlage zum Eingreifen bereitstellt, dann ist man wieder bei der ordnungsbehördlichen Generalklausel (§ 1 Abs. 1 und § 14, siehe § 1 Abs. 2 Satz 2), was gesetzgebungstechnisch sicher kein Nachteil sein muss. Wie auch immer: Abs. 2 (und Abs. 3) verdeutlicht den Anspruch des OBG-Gesetzgebers, Grundsatzgesetzgebung zu betreiben und prägende Grundfestlegungen auch bezüglich der Gesetzgebungsarbeit der „Fachgesetzgeber“ zu treffen.
75
Aufgaben nach Abs. 2 Satz 1 können den Ordnungsbehörden durch Bundes- oder Landesgesetz bzw. Verordnungen übertragen werden. Abs. 2 gilt für Vorschriften des Bundes- und Landesrechts[233]. Die Festlegung von konkreten Behördenzuständigkeiten durch Bundesgesetz ist indes nach der Föderalismusreform I in der Regel nicht mehr möglich[234]; sie liegt im Übrigen nicht im wohlverstandenen staatlichen Interesse des Landes. Es ist daher auch rechtspolitisch erwünscht, wenn „alte“ direkte Zuständigkeitsbestimmungen im Bundesrecht nach und nach durch Landesvorschriften abgelöst werden, unabhängig von der Konnexitätsproblematik nach Art. 78 Abs. 3 LV. Zur Zuständigkeitsfestlegung durch das Land bei Bundesrecht vgl. auch § 5 LOG.
76
Voraussetzung für die Anwendbarkeit des OBG ist, dass es sich um Gesetzgebungsakte der Eingriffsverwaltung (nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr) handelt (Sonderordnungsrecht). Es darf nicht um Gesetzgebung auf dem Feld der Leistungsverwaltung gehen[235]. Aus dem Bereich des speziellen besonderen Gefahrenabwehrrechts sind die Eingriffsgrundlagen von besonderer Bedeutung, also die spezialgesetzlichen Generalklauseln und speziellen Eingriffsvorschriften. Die Ordnungsbehörden führen ihre Maßnahmen also zunächst nach den (ggf.) spezialgesetzlich erlassenen Aufgaben- und Eingriffsnormen sowie den diese begleitenden und näher ausgestaltenden Fachnormen durch. Nur wenn und soweit spezialgesetzliche Vorschriften fehlen oder eine abschließende Regelung nicht enthalten ist, treffen die Ordnungsbehörden die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nach dem OBG Abs. 2 Satz 2.
77
Es muss für jedes Rechtsgebiet und für jeden Sachverhalt im Einzelnen untersucht und entschieden werden, ob – erstens – eine abschließende oder teilabschließende spezielle Eingriffsgrundlage vorliegt und ob und inwieweit – zweitens – die allgemeinen Vorschriften des OBG heranzuziehen sind, weil spezialgesetzliche Regelungen in dem einschlägigen Fachgesetz fehlen (etwa hinsichtlich der Störereigenschaft oder der Austauschbefugnis). Diese Feststellungen können äußerst komplizierte Prüfungen notwendig machen, zumal angesichts der Zersplitterung des Besonderen Verwaltungsrechts[236]. Die Abgrenzung der Vorschriften und die genaue Festlegung der Geltungsbereiche im Einzelfall richtet sich nach der allgemeinen juristischen Methodik und nicht maßgeblich nach den (ohnehin offenen) Vorstellungen oder Anordnungen des OGB-Gesetzgebers. Insofern erscheint es zumindest schief, wenn behauptet wird, es sei im Allgemeinen davon auszugehen, dass die spezialgesetzlichen Vorschriften abschließende Regelungen enthielten[237].
78
Richtig ist vielmehr, dass aus Sicht des Rechtsanwenders im Gefahrenabwehrrecht stets sorgfältig zu prüfen ist[238]:
–ob und wo ein bestimmter Sachverhalt spezialgesetzlich geregelt ist;
–ob das Spezialgesetz tatsächlich eine einschlägige Regelung (also vor allem eine Verhaltenspflicht) für den vorliegenden Sachverhalt enthält und ob, falls dies nicht der Fall ist, aus diesem Grund eine entsprechende Sperrwirkung bei der Anwendbarkeit des OBG anzunehmen ist[239];
–ob das Spezialgesetz eine spezielle Eingriffsgrundlage enthält (Beispiel § 61 BauO NRW); falls das Spezialgesetz keine spezielle Eingriffsgrundlage enthält: ob die Anwendbarkeit des § 14 gesperrt ist, weil eine spezielle Ermächtigungsgrundlage (verfassungsrechtlich) gegeben sein muss, der einfache Gesetzgeber eine solche aber nicht erlassen hat;
–falls eine spezialgesetzliche Eingriffsgrundlage vorliegt (etwa § 61 BauO NRW): ob die weiteren allgemeinen Vorschriften des OBG zur Anwendung kommen (etwa zur Störerhaftung oder zur Austauschbefugnis). Dies ist der Fall, wenn und soweit es sich um eine Tätigkeit auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr (Sonderordnungsrecht) handelt und das Spezialgesetz keine eigenen speziellen Regelungen enthält.
79
Bei Abs. 2 Satz 2 ist zu berücksichtigen, dass es Gesetze gibt, in denen der Gesetzgeber ausdrücklich auf die Anwendbarkeit des OBG verwiesen hat, wie bei §§ 60 und 61 BauO NRW. Bei vielen anderen Vorschriften fehlt eine Verweisung. Es kommt dann auf die Auslegung an; so hat das OVG festgestellt, dass bei auf § 33 GewO gestützten Auflagen über die Verteilung von Spielgeräten in Spielhallen das OBG anwendbar ist[240].
2. Materien im Einzelnen
80
Beispielhaft und ohne jeden Anspruch auf Vollzähligkeit bzw. auf erschöpfende Behandlung der Spezialnormen (dazu vgl. die entsprechenden aktuellen Fachkommentierungen, soweit solche vorliegen) sei auf folgende Materien des Bundes- und Landesrechts hingewiesen (mit Hinweisen auf relevante Rechtsvorschriften bzw. in der Verwaltungspraxis aktuelle Rechtsfragen):
Arzneimittelrecht: Gefahrenabwehrmaterie; Vorrangigkeit des § 69 AMG ist zu beachten[241].
Bauordnung: Vorrangige Spezialermächtigung ist § 61 BauO. § 14 ist insoweit subsidiär anwendbar, als es im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben um Verstöße gegen Vorschriften nichtbaurechtlicher Art geht, die unterbunden werden sollen[242]. Ansonsten sind OBG-Vorschriften anwendbar.
Bergrecht: Anwendbarkeit des Polizeirechts nach Entlassung aus der Bergaufsicht[243].
Bestattungen: Ordnungsbehördliche Bestattungspflicht nach § 8 Abs. 1 Satz 2 BestG[244]. Nach § 78 JustG haben die Ordnungsbehörden die Pflicht, das zuständige Amtsgericht zu unterrichten, wenn sie von einem Todesfall Kenntnis erhalten, bei welchem gerichtliche Maßregeln zur Sicherung des Nachlasses angezeigt erscheinen können.
Bundesbodenschutzgesetz: Ordnungsverfügungen zur Durchsetzung der Verpflichtungen aus §§ 4 und 7 ergehen nach § 10 Abs. 1 Satz 1 BBodSchG[245].
Feuerschutzrecht (FSHG NRW): Die Gemeinden und Kreise sollen bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben weder als Ordnungsbehörden noch als Sonderordnungsbehörden handeln[246]; es findet sich auch keine Verweisung im FSHG. Gleichwohl erfüllt die nach §§ 1 und 9 FSHG NRW zu unterhaltende Feuerwehr Aufgaben der Gefahrenabwehr (Brandbekämpfung etc.)[247].
Gaststättenrecht ist gewerbliches Ordnungsrecht; § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GastG will das menschliche Zusammenleben ordnen, soweit es sozial relevant ist, nach außen tritt und das Allgemeinwohl zu beeinträchtigen geeignet ist[248]. Dem dient auch die allgemeine Sperrzeit[249].
Gewerberecht: Wichtig die Vorschriften zu Spiel, Sex, etc., §§ 33 ff. GewO.
Glücksspielrecht: Glücksspielstaatsvertrag[250] mit eigenen Ermächtigungsgrundlagen (Untersagungsverfügungen nach § 9 Abs. 1 Satz 2 und 3 GlüStV)[251], Zuständigkeiten der örtlichen Ordnungsbehörden nach §§ 19 und 20 der Bekanntmachung des Ersten Staatsvertrages etc.[252].
Hafensicherheit: Hafensicherheitsgesetz (HaSiG) NRW vom 20. Oktober 2007[253].
Heilpraktikerrecht: Grundsätzlich Gefahrenabwehrmaterie mit Anwendbarkeit des § 14[254].
Kampfmittelräumung: Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, die von Kampfmitteln ausgehen, ist eine Aufgabe der Gefahrenabwehr, die den örtlichen Ordnungsbehörden obliegt. Das Land unterhält zur „Unterstützung“ der örtlichen Ordnungsbehörden einen staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienst bei den Bezirksregierungen Arnsberg und Düsseldorf[255].
Kinder- und Jugendschutz: Rechtsgrundlage ist das SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe – des Bundes, dieses dient insbesondere der Begrenzung staatlicher Eingriffe auf Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für das Kindeswohl (Art. 6 GG)[256], notfalls auch gegen die Eltern. Wenn aus England berichtet wird, „Käfigkämpfe“ neunjähriger Jungen vor Erwachsenen, die wie Erwachsenen-Boxkämpfe inszeniert seien, seien dort zulässig und die Polizei sehe wegen der Erlaubtheit dieser Veranstaltungen (angeblich wurden „Lizenzen erteilt“) keinen Grund zum Einschreiten[257], so wäre dies nach deutschem Recht ein Grund für die zuständigen Jugendämter bzw. die Polizei, derartige Veranstaltungen sofort zu untersagen bzw. abzubrechen (Gefahr für das Kindeswohl: Zurschaustellung des Kindes als Objekt abartiger Gelüste von Erwachsenen, Gefahr für seine seelische und körperliche Entwicklung)[258].
Landesforstgesetz: Siehe etwa § 6 a (betreffend Abfälle)[259].
Landeshundegesetz vom 18. Dezember 2002 (vgl. § 15 Landeshundegesetz) und die dazu ergangene ordnungsbehördliche Durchführungsverordnung vom 19. Dezember 2003[260]: Nach § 1 sind Gefahrenabwehr und Gefahrenvorsorge Zweck des Gesetzes. Die Gesetzgeber des Bundes[261] und der Länder haben diese Materie weitgehend spezialgesetzlich geregelt (hochgezont)[262], weil auf das OBG gestützte gefahrenabwehrende Tätigkeiten als nicht ausreichend empfunden wurden[263]. Im Hintergrund standen u. a. das Martyrium und der grauenhafte Tod des siebenjährigen Volkan im Juli 2000 in Hamburg[264].
Landes-Immissionsschutzgesetz: Spezialregelung zur Bekämpfung verhaltens- (nicht anlagen-)bezogenen Lärms. Ergänzt etwa durch die Freizeitanlagenlärm-Richtlinie von 2006[265].
Sperrungsverfügungen nach dem Medienstaatsvertrag: Probleme der Verhältnismäßigkeit[266].
Medizinproduktegesetz: Untersagung der Anwendung von Medizinprodukten nach § 28 MPG[267].
Melderecht: Meldebehörden sind die Gemeinden als örtliche Ordnungsbehörden, § 1 Meldegesetz NRW.
Nichtraucherschutzgesetz: Gefahrenabwehrmaterie, Anwendbarkeit des OBG, insbesondere § 14 bezüglich behördlicher Eingriffsmöglichkeiten[268]. Das Gesetz bezweckt den wirksamen Schutz der Bürger vor den erheblichen Gesundheitsgefahren durch Rauchen in der Öffentlichkeit[269]. Insoweit entwickelt sich seit einigen Jahren ein komplett neues Rechtsgebiet zu zahlreichen Einzelfragen, etwa hinsichtlich der arzneimittelrechtlichen Behandlung von E-Zigaretten und der Beurteilung des Rauchens von getrockneten Früchten und „Shiazo-Steinen“[270].
Psychische Beeinträchtigungen: Bekämpfung der Gefahren, die von psychisch gestörten Gewalttätern ausgehen, nach dem Bundesgesetz zur Therapierung und Unterbringung psychisch gestörter Gewalttäter vom 22. Dezember 2010[271]; Zuständigkeiten in NRW: Regelung der Zuständigkeiten in der Verordnung vom 3. Januar 2011[272]. Zuständigkeiten der örtlichen Ordnungsbehörde etwa nach §§ 9 Abs. 3 und 14 PsychKG; hier stellen sich Fragen der Zuständigkeitsabgrenzung zur Polizei[273]: Findet die Polizei einen Geisteskranken in hilfebedürftigem Zustand und veranlasst seine Überführung in ein psychiatrisches Krankenhaus, so benachrichtigt sie auch die Ordnungsbehörde, damit diese wegen der Unterbringung das Erforderliche veranlassen kann[274].
Rettungsgesetz NRW: Nach § 6 Abs. 1 RettG NRW ist Rettungsdienst Gefahrenabwehraufgabe.
Seuchenrecht, Viehseuchenrecht: Spezielle Eingriffsgrundlagen etwa in § 17 ff. TierSG.
Straßen- und Wegerecht: Eingriffsgrundlage bei Überschreitung des Gemeingebrauchs (Störung): § 22 Satz 1 StrWG NRW. Laut OVG besteht, soweit anwendbar, eine Sperre bei der Anwendung des § 14[275].
Tierkörperbeseitigung: Gefahrenabwehrmaterie, Anwendbarkeit des OBG, teils schwierige Festlegungen betreffend richtiger Eingriffsgrundlage[276]. Vergleiche hinsichtlich der Tierseuchenbekämpfung die Zuständigkeitsfestlegungen in der entsprechenden Zuständigkeitsverordnung des Landes vom 27. Februar 1996 mit Zuständigkeiten der örtlichen Ordnungsbehörden und Kreisordnungsbehörden.
Tierschutzgesetz: Wichtig in der Praxis etwa das Tierbetreuungsverbot nach § 16a Satz 1 und Satz 2 TierschutzG[277].
Versammlungsrecht[278]: Zuständigkeit der Polizei-, nicht der Ordnungsbehörden. Das Verhältnis des Ordnungs- und vor allem Polizeirechts zum Versammlungsgesetz ist äußerst kompliziert, dogmatisch zum Teil ungeklärt und rechtspolitisch seit Langem umstritten[279].
Waffenrecht ist speziell geregeltes öffentliches Sicherheitsrecht. Vorschriften des allgemeinen Ordnungsbehördenrechts sollen (nur) ergänzende Anwendung finden[280].
Wasserrecht: Vergleiche etwa § 138 LWG. § 90 a Abs. 3 LWG zum Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen zur Gewässerrandstreifen-Bewirtschaftung[281].
IV. Absatz 3
81
Abs. 3 ist noch stärker als Ausprägung des Versuchs der Grundsatzgesetzgebung zu sehen als Abs. 2. Wenn andere Aufgaben als solche der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr den Ordnungsbehörden zugewiesen sind, haben diese „insoweit“ alle Zuständigkeiten nach dem OBG; insbesondere handeln sie durch Verfügung, und das Aufsichtsregime des OBG – Sonderaufsicht – findet Anwendung[282]. Der Gesetzgeber dürfte das OBG 1956 auch als eine Art vorweggenommenes Verwaltungsverfahrensgesetz (mit den entsprechenden verfassungsrechtlichen Garantien) betrachtet haben. Es kam ihm darauf an, die Verwaltung insgesamt möglichst eng an das OBG zu binden, und zwar auch auf Rechtsfeldern und in Fallgestaltungen, in denen es gar nicht um Gefahrenabwehr ging.
Schönenbroicher
§ 2 Vollzugshilfe der Polizei
Die Polizei leistet den Ordnungsbehörden Vollzugshilfe nach den Vorschriften der §§ 47 bis 49 des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG NW).
I. Allgemeine Abgrenzung: Zuständigkeit der Polizei und der Ordnungsbehörden
1
§ 2 erhielt 1980 seine jetzige Fassung[283]. Die zuvor in Satz 1 enthaltene Regelung zur Zuständigkeit der Polizei für die Gefahrenabwehr („Die Polizei hat zur Gefahrenabwehr in eigener Zuständigkeit nach pflichtgemäßem Ermessen die notwendigen unaufschiebbaren Maßnahmen zu treffen.“) wurde gestrichen, weil dieses zum Regelungskreis des Polizeigesetzes gehöre. Ebenso wurde zugunsten der jetzigen Fassung § 13, der früher Regelungen zur Vollzugshilfe enthielt, neu gefasst. Nachdem der Gesetzgeber die Voraussetzungen der Vollzugshilfe der Polizei (und ihre entsprechende Verpflichtung) schon in §§ 47 ff. PolG ausdrücklich geregelt hat, dürfte § 2 eher deklaratorische Bedeutung haben.
2
Die Polizei ist nach § 1 Abs. 1 Satz 3 PolG originär zuständig, die unaufschiebbar notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu treffen. Die Polizei hat die Zuständigkeit (der Begriff „Recht“ ist nicht falsch, bezeichnet aber nicht zutreffend die Zusammenhänge) des ersten Zugriffs, sie darf unaufschiebbare Maßnahmen treffen, um Gefahren abzuwehren und Störungen zu beseitigen, und sie darf diese Maßnahmen so lange aufrechterhalten, bis die noch erforderlichen Maßnahmen von der sachlich zuständigen Behörde getroffen sind[284]. In der Wissenschaft wird dies plastisch so ausgedrückt, dass der Einsatz uniformierter, unmittelbar dem Land NRW zuzuordnender Polizeikräfte auf Eil- und Notfälle „vor Ort“ beschränkt werden soll, während Gefahrenlagen, für die eine solche Eillage nicht besteht, der dezentralen und „bürokratischen“ Bearbeitung durch die allgemeinen, vorrangig im Bereich der kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften angesiedelten Ordnungsbehörden – gefahrenabwehrrechtliche Schreibtischverwaltung – vorbehalten bleiben[285]. Die allgemeinen örtlichen Ordnungsbehörden haben auch das Recht des ersten Zugriffs zur Wahrnehmung von gefahrenabwehrrechtlichen Zuständigkeiten anderer Verwaltungsbehörden bei Gefahr im Verzug (§ 6)[286].
3
Mit der Änderung des POG 2007 wurden die Bezirksregierungen aus dem dreizügigen hierarchischen Aufbau der staatlichen Polizeiorganisation herausgenommen und es wurden drei selbständige Landesoberbehörden im Bereich der Polizei eingerichtet (§ 6 LOG)[287]. Aus mehreren Gründen war dies nicht unumstritten und wird auch noch einer sorgfältigen Evaluierung und mglw. Revision bedürfen, insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit der zivilen Führung der Polizei. Wie genau die Aufsichtsbefugnisse bei der Vielzahl polizeilicher Tätigkeiten (es geht nicht nur um die Einsätze) im Verhältnis der Ausgangsbehörden zu den Landesoberbehörden und dem Ministerium beschaffen sind, erscheint zum Teil offen, weil §§ 5 und 13 a POG und die dazu erlassene Zuständigkeitsverordnung recht unklar formuliert sind. An erstinstanzlichen Aufsichtspflichten der obersten Landesverwaltung über mehrere Dutzend Ausgangsbehörden, trotz Existenz von drei Landesoberbehörden und entgegen dem in § 6 LOG angeordneten Instanzenzug, dürfte kaum ein wohlverstandenes staatliches Interesse bestehen, weder in staatsorganisationsrechtlicher noch in politischer Hinsicht.
II. Schreibtischarbeit hier – Unaufschiebbarkeit dort
4
Unaufschiebbar ist eine Maßnahme dann, wenn die Schadenswirkung nach vernünftiger Einschätzung als unmittelbar bevorstehend angesehen werden kann, ein Tätigwerden der Verwaltungsbehörde aber zu spät kommen könnte[288]. Beispiele: Verbot des Verkaufs von Lebensmitteln, die offenkundig[289] schwerwiegende gesundheitliche Schädigungen zur Folge haben können; Aufgreifen verwirrter Personen durch die Polizei[290]. Eine originäre Zuständigkeit kommt danach insbesondere außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeiten der Ordnungsbehörden in Betracht, etwa nachts, an Wochenenden und Feiertagen[291].
5
Die gefahrenabwehrende verwaltungsmäßige „Schreibtischarbeit“ ist Sache der Ordnungsbehörden, soweit der Polizei nicht ausdrücklich spezialgesetzlich solche Zuständigkeiten zugewiesen sind bzw. soweit sich eine Zuständigkeit nicht zwingend aus dem allgemeinen Pflichtenkreis der Polizei ergibt[292]. Insoweit sind für die Gefahrenabwehr in erster Linie die allgemeinen Ordnungsbehörden zuständig, die Polizei darf nur tätig werden, wenn diese nicht oder nicht rechtzeitig einschreiten können[293]. Straftatenverhütung und vorbeugende Bekämpfung von Straftaten sind eigene, originäre Aufgaben der Polizei, welche nicht unter den Subsidiaritätsgrundsatz (§ 1 Abs. 1 Satz 2 PolG) fallen[294].
6
Bei der Beurteilung der Frage, ob eine vorrangige Not- oder Eilkompetenz der Polizei gegeben ist, kommt es, was die Erreichbarkeit und Handlungsmöglichkeiten der an sich zuständigen Behörde angeht, auf die Verhältnisse des Einzelfalls und den Erkenntnisstand im Zeitpunkt der Anordnung der Maßnahme durch die Polizei an. Die getroffene Maßnahme kann nur dann erfolgreich beanstandet werden, wenn offensichtlich von unzutreffenden Voraussetzungen ausgegangen worden ist, die im Zeitpunkt der Entscheidung bereits erkennbar waren[295]. An Abenden oder in der Nacht wird man in der Regel nicht von einem durchgehend einsatzbereiten ordnungsbehördlichen Außendienst ausgehen können. Es dürfte etwa bei abendlichen und nächtlichen Nachbarstreitigkeiten um Ruhestörungen, auch angesichts des mitunter erheblichen Konflikt- und Gefährdungspotentials, regelmäßig von der Zuständigkeit der Polizei auszugehen sein[296], zumal es nicht die Aufgabe des rechtsschutzsuchenden Bürgers sein kann, umfangreiche Ermittlungen zu Ämteröffnungszeiten anzustellen. Es ist nach der beabsichtigten Maßnahme zu differenzieren, etwa, ob ein vorübergehender Platzverweis oder ein (dauerndes) Aufenthaltsverbot verhängt werden soll; u. a. kann auch eine Handlungsermächtigung der Polizei als Bote oder kraft Mandatierung in Betracht kommen[297]. Richtig dürfte eine ordnungsbehördliche Praxis sein, wonach bei Lärmbelästigungen etwa durch Partylärm nach den üblichen Dienstzeiten (ca. 16 bis 17 Uhr) stets von der Zuständigkeit der Polizei auszugehen ist. Die Polizei ordnet dann das Abstellen des Störungszustandes vor Ort an. Die Ahndung (nach Ermessen) im Wege des Bußgeldverfahrens nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz und LImSchG erfolgt dann wiederum seitens der zuständigen Ordnungsbehörde[298].