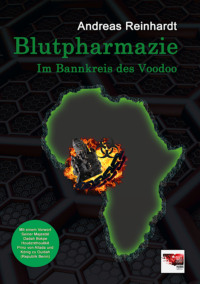Kitabı oku: «Blutpharmazie - Im Bannkreis des Voodoo», sayfa 2
Ihr Ahnen, ich lege mein Schicksal in eure Hände.
Kapitel 3
Hexen, Hexen
- Ein Freund in den Bergen -
Das eigenhändig restaurierte Bauernhaus inmitten ungezähmt anmutender Kulturpflanzen empfing ihn in der einladenden Atmosphäre, die ihm so wichtig war. Ob Steinwände, Kamin oder Mobiliar, alles atmete Natur und Harmonie. Der Weltbürger in ihm war unverkennbar, fanden sich doch auf den ersten Blick rituelle Masken, Figuren und Stoffe aus West- und Zentralafrika genauso, wie traditionelle Waffen und Keramiken aus China oder Japan. Zügig nahm Bonifacius die Holzstufen ins Obergeschoss, wo eine erfrischende Dusche auf ihn wartete. Viel Zeit blieb nicht, hatte sich doch ein väterlicher Freund zum Frühstück angemeldet.
Der sympathische Duft frisch gemahlenen spanischen Kaffees zog durchs ganze Haus und wies dem Gastgeber schließlich den Weg zurück und in die gemütliche Küche, wo Pablo gerade das gemeinsame Frühstück vorbereitete. Es gehörte zum gewohnten Ritual der so unterschiedlichen Männer, mehrmals in der Woche zum Essen zusammenzukommen, sofern sich der umtriebige Weltenbummler in seiner Wahlheimat aufhielt. Selbstredend wusste der in die Jahre gekommene Bergbauer nichts vom Doppelleben des Anderen, und vermutlich hätte auch das nichts an ihrer besonderen Beziehung geändert. Dass Pablo hier so frei ein und aus gehen konnte, sprach jedenfalls eine deutliche Sprache. Natürlich blieb zu erwähnen, dass zwischen den vergleichsweise wenigen Menschen in den andalusischen Bergen generell großes Vertrauen herrschte und Haustüren selten abgeschlossen wurden. Die Begrüßung fiel wie immer herzlich aus, ohne überschwänglich zu sein. Wie auf Kommando stürmte allerdings der riesige ungarische Hirtenhund Pablos herbei, um ungleich aufgeregter seinen Anteil an der Wiedersehensfreude einzufordern. In aller Ruhe wurden die Frühstücksutensilien nach draußen gebracht, um einen rustikalen Holztisch vor dem Haus zu decken.
Die beiden saßen bereits eine Weile in geselliger Stille beisammen, und Pablo goss gerade Kaffee nach, als Bonifacius nachdenklich das Gespräch suchte: »Was weißt du über Hexen?«
Der Angesprochene schaute ihn einige Sekunden stirnrunzelnd an – nicht etwa aus Überraschung wegen der Frage, sondern weil er über eine gehaltvolle Antwort nachdachte. »Zu dem Thema gibt es viel zu sagen und viel zu wissen. Hexen kennt man ja auf der ganzen Welt. Bestimmt haben sie ihren Platz in jeder Kultur von Grönland bis Japan. Und in früheren Zeiten hätte wohl niemand ihre Existenz geleugnet. Aber in der Welt von heute, mit moderner Wissenschaft und Technik-Hokuspokus, werden Hexen lieber als Ammenmärchen abgetan. Wie sie aussehen, was sie bezwecken oder wie groß ihre magischen Kräfte sind, das wissen wir nur noch aus Gruselfilmen.«
Daraufhin beugte sich der alte Mann der Berge ein Stück weit über den Tisch, so als war das Folgende nicht für jedermanns Ohren bestimmt: »Lange bevor kultureller Austausch zwischen den Völkern dieser Welt stattfand, gab es schon übereinstimmende Hexenbeschreibungen. Wenn die also nie existiert haben, wie ist dann so etwas möglich?«
Betrübt ließ er sich zurücksinken und streichelte den noch jungen Hütehund, der ihm nur selten von der Seite wich. »So oder so, „Hexe“ ist ein missbrauchter Begriff.«
Eine Feststellung, die unbedingt eine Nachfrage lohnte: »Was meinst du?«
Pablo trank seinen Kaffee und lächelte bitter. »Menschen tun alles, um nur nicht die Verantwortung für eigene Taten übernehmen zu müssen. Sie brauchten schon immer einen Sündenbock für ihre Verfehlungen und Ängste. 'Ich wurde versucht', 'etwas hat mich gezwungen' oder 'sie hat meinen Mann verhext'. Die beschuldigten Frauen waren angeblich unmoralisch, böse und wollten die Menschen verderben. Wo immer ein ungewöhnlicher Todesfall auftrat, eine Epidemie ausbrach oder Felder verdorrten, mussten der Teufel und seine Hexen am Wirken sein. Aber in Wahrheit liegt alles, was der Mensch Hexen je an Grausamkeiten und Perversionen angedichtet hat, in seiner eigenen Seele begründet. Und sollte es tatsächlich Hexen geben, also Frauen mit magischen oder übersinnlichen Fähigkeiten – woran ich persönlich nicht zweifle – werden sie aus guten Gründen nicht in Erscheinung treten. Wie viele Frauen sind alleine schon deshalb als Hexe gequält, verstümmelt und verbrannt worden, weil sich Männer von ihrer Schönheit angezogen fühlten und Ehefrauen aus Eifersucht zur Anklägerin wurden. Andere landeten auf dem Scheiterhaufen, nur weil ihr Umgang mit Kräutern Kranke heilte. Mit der Inquisition in Europa hat die christliche Kirche jedenfalls so viel unschuldiges Leben vernichtet, wie es tatsächliche Hexen sicher nie getan hätten oder hätten tun können.«
Für Bonifacius war es an der Zeit, nachdenklich zu nicken. »Einverstanden, aber nehmen wir mal an – rein hypothetisch – es würde Hexen geben, ein Teil von denen wäre den Menschen feindlich gesonnen und würde ihnen Schaden zufügen wollen. Aus welchem Grund?«
Ihn traf ein argwöhnischer Blick. »Danach will ich aber wissen, weshalb dich das Thema so interessiert. - Also gut, in dem Fall wäre es wahrscheinlich Daseinszweck der Hexe, die menschliche Moral, gesellschaftliche Regeln und Tabus in Frage zu stellen – ja selbst die Naturgesetze. Sie würde Unruhe stiften, um Menschen auf die Probe zu stellen, um sie vom rechten Weg abzubringen. Es geht um das ewige Spiel Gut gegen Böse. Vermutlich wären solche Hexen nur die Handlanger und Vollstrecker noch mächtigerer dunkler Kräfte, so wie Soldaten politischen Zielen dienen und Staatsräson auf Kommando durchsetzen. – So, mein Freund, jetzt bist du dran«, endete Pablo fordernd.
»Mir geht es um die Hexe als Symbol. Ich hatte letzte Nacht einen heftigen Traum. Hexen spielten darin eine wichtige Rolle. Sie haben mich attackiert. Ich will wissen, was dahintersteckt.«
Der Gast hatte begonnen, eine frisch abgeschnittene Scheibe Bauernbrot üppig mit Schinken, Käse, Tomate und Kräutern zu belegen, wobei er an jeder einzelnen Zutat genüsslich roch. »Ich bin ja kein Traumdeuter, aber die über Jahrhunderte hinweg weitergegebenen Ammenmärchen vom Bösen und Schlechten in der Gestalt von Hexen sind tief in unser Unterbewusstsein eingegraben. Schau dir die hysterische Angst vor dem Wolf an. Nicht anders. Träumt man also von Hexen und Wölfen, stehen die für Bedrohung, Ängste, Gefahr. Für einige Menschen sollen Träume ja wie ein mystisches Tor über Zeit und Ort hinweg sein. Manche Leute behaupten sogar, es sind komplexe göttliche Botschaften.«
Das animierte den Gastgeber zu einem befreienden Auflachen: »Also zu denen gehöre ich.«
Pablo ließ sich anstecken: »So wie ich.«
Der Tisch war so reich mit appetitlichen Lebensmitteln der Region gedeckt, dass das Gelage bis in den Vormittag hinein andauerte. Man sprach über Gott und die Welt, was für beide Seiten einmal mehr erquicklich war. Ein Fremder mochte den Spanier aufgrund der mangelnden Schulbildung vielleicht für einen unwissenden Bauern mit Viehbestand halten, doch sein um zwei Generationen jüngerer Freund wusste es besser. Der wusste um die Lebensweisheit und kannte die anspruchsvolle Büchersammlung des Ehrenmannes – gelesen, verstanden und um umfassende Kommentare bereichert.
Und eben dieser Mann formulierte einen ergänzenden Gedanken: »Was ich nicht weiß ist, wann und unter welchen Umständen die Hexenverfolgung in Europa genau endete. Auch ein spannender Punkt.«
Der geschichtsinteressierte Journalist war gerne bereit für Aufklärung zu sorgen, wobei der Begriff „Aufklärung“ ihm ein wohliges Lächeln entlockte: »Den Anfang vom Ende dieser menschenverachtenden Barbarei verdankt Europa wohl dem preußischen König Friedrich Wilhelm I. Im Geiste der „Aufklärung“ und seines frühen Verständnisses für Rechtsstaatlichkeit, musste ihm ab 1714 jedes Gerichtsurteil zur Bestätigung vorgelegt werden, das auf Hinrichtung und Folter – auch wegen Hexerei und Ketzerei – lautete. Er widerrief die meisten dieser Urteile. Sein Sohn Friedrich II. schaffte bei Amtsantritt 1740 nicht nur Hinrichtung und Folter bei zunächst noch wenigen Ausnahmen ganz ab, auch Hexenprozesse wurden verboten. Damit bezog er als erster christlicher Herrscher in Europa eindeutig Stellung für religiöse Toleranz und gegen die gewalttätige Dogmatik der Kirche. Preußen setzte fortan auf die angeborene Fähigkeit zur Vernunft und zum Verständnis für Sitte und Ethik, aber auch auf die Verpflichtung zum verantwortungsvollen Handeln gegenüber der Gemeinschaft. Davon sollte das preußische Menschenbild geprägt sein.«
»Das wird die anderen gekrönten Häupter und Päpste aber gar nicht amüsiert haben«, feixte Pablo, »der drohende Verlust wichtiger Machtinstrumente.«
»Nicht amüsiert?«, kam Bonifacius erst so richtig auf Betriebstemperatur, »das dürfte den edlen Herren den puren Angstschweiß auf die Stirn getrieben haben. Neid und Missgunst waren zweifellos auch im Spiel, denn der preußische Staat bot eine beispiellose Alternative an – einen modernen Verwaltungs- und Rechtsstaat, der jedem seiner Bürger die selben Rechte wie Pflichten zugestand und auferlegte.«
Die Augen seines Gegenübers wurden zu lauernden Schlitzen: »Und wie passt dieses preußische Menschenbild zu Begriffen wie „Obrigkeitshörigkeit“ oder „Kadavergehorsam“?«
»Gar nicht«, kam die prompte Antwort, »gern bemühte Propagandabegriffe, die der Realität nicht gerecht werden. Alles hatte sich dem Gesetz und den sittlichen Geboten Gottes unterzuordnen. Selbst die Könige hatten sich dem zu unterwerfen. Befehlsverweigerung aus Gewissensgründen war in der preußischen Armee durchaus keine Seltenheit. Und Obrigkeitshörigkeit traf auf die preußische Gesellschaft nicht mehr oder weniger zu, als auf andere Mächte in Europa und anderswo zu jener Zeit.«
»Warum legt ein Mann deiner Generation so viel Wert auf diese Dinge?«, wollte Pablo unbedingt wissen, den die wissende Leidenschaft beeindruckte.
Wieder folgte die Erklärung ohne Zögern: »Um es mit den Worten eines deutschen Historikers zu sagen: 'Es geht um Gerechtigkeit, es geht um die Einübung von Respekt. Ein humanes Verhalten gegenüber Mitmenschen schließt auch ein humanes Verhalten gegenüber den Toten, gegenüber unserer Vergangenheit ein'. – Meine Mutter war Kongolesin, aber mein Vater war Deutscher. Ich bin es mir und meinen Ahnen schuldig. Preußen und das Deutsche Kaiserreich waren weit ab von gesellschaftlicher und politischer Perfektion, keine Frage. Aber man muss diese beiden Staaten in ihrer Gesamtheit und mit gebührendem Respekt betrachten, so wie man es auch anderen Nationen und deren Geschichte zugesteht. Das ist meine feste Überzeugung.«
»Die Bürde des Verlierers zweier Weltkriege. Die Wahrheit wird vom Sieger diktiert«, kommentierte der Zuhörer nicht ohne Mitleid.
Kompromissloser Ernst ersetzte endgültig die Leichtigkeit: »Interessiert mich nicht, ich ziehe Tatsachen vor. Wie hast du so treffend gesagt, die Wahrheit wird schließlich vom Sieger diktiert. Es reicht schon ein kompetent wirkender Erzähler, der nicht den Fehler begeht, zu sehr ins Detail zu gehen. Dann muss nur noch an einen anerzogenen Schuldkomplex appelliert werden. Unter solchen Umständen überlässt der Mensch das Denken schnell anderen. Stimmungsmache und Meinungsdoktrin aus der Feder von Vormündern im Deutschland des 21. Jahrhunderts, nicht etwa Ende des 18. Jahrhunderts in Preußen.«
»Siehst du, deshalb liebe ich es hier in den Bergen, fernab von Propaganda und einer beliebigen Welt der Verschwendung. Hier hat alles noch einen Sinn. Die Nachbarn werden mit Respekt behandelt, es gibt keine geistlose Hektik, und man lebt von und mit der Natur.«
Bonifacius hatte seinen entspannten Gesichtsausdruck derweil zurückgewonnen: »Meiner Meinung nach können wir die Herausforderungen der Zukunft nicht dadurch meistern, dass wir eine globalisierte Industrie- und Informationsgesellschaft verteufeln oder vor ihr zurückschrecken. Aber die Menschen müssen lernen, sie ernsthaft zum Wohle aller und in besserem Einklang mit der Natur zu nutzen. Denn ohne Vernunft und Weisheit richtet es uns seelisch und körperlich zugrunde.«
»Na genau aus dem Grund machst du dich morgen als investigativer Journalist auf den Weg in die Welt, richtig?«, gab Pablo in rhetorischer Manier zurück, während er vom Tisch aufstand und noch einige Oliven als Wegzehrung an sich nahm.
Sein Augenzwinkern signalisierte ein Hintergrundwissen, dass er nicht im Entferntesten besaß. Er wusste nicht, dass Bonifacius in geheimer Mission ins Voodoo-Land Benin fliegen würde, um die Hintergründe einer geheimnisvollen Seuche zu untersuchen, die jüngst im Norden des Landes ausgebrochen war. Auch wusste er nicht, dass sein Freund es im Auftrag einer Geheimgesellschaft namens „Wächter der Schöpfung“ tun würde. Primär ging es nicht darum zu recherchieren, zu befragen und die erhaltenen Informationen in erhellenden Artikeln aufzubereiten. Die Umstände rund um diese humanitäre Katastrophe waren sehr viel komplexer als offiziell verlautet. Womöglich war das Szenario gezielt herbeigeführt worden. Also würde der Mann, welcher Pablo gerade so vertraut gegenübersaß, dessen Codename „Shango“ lautete, die Hintergründe aufdecken, alle Verantwortlichen entlarven und sie ihrer gerechten Strafe zuführen. So lautete die Mission. Dies war das Credo der „Wächter der Schöpfung“.
Kapitel 4
Verdächtige Seuche in Benin
- Wächter der Schöpfung -
Der Konstantin Verlag hatte seinen Hauptsitz am Rande Berlins, in einem mehrstöckigen Gebäude, das der Fassade nach eine spätmittelalterliche Burg hätte sein können. Tatsächlich aber war die Anmutung einem prägenden Baustil der wilhelminischen Zeit geschuldet – dem romantischen Historismus, sandsteingewordene Verehrung eines vermeintlich helden- und tugendreichen Zeitalters. Ursprünglich das Zuhause der öffentlichen Verwaltung in Deutschem Kaiserreich, Weimarer Republik und Drittem Reich, ging das imposante Bauwerk schließlich in das Eigentum des unabhängigen Konstantin Verlages über. Wie zuvor auch, war ein romantischer Anspruch vor allem auf die Fassade beschränkt. Im öffentlichen Tagesgeschäft erschloss sich das am ehesten im faktenbasierten investigativen Arbeiten der Journalisten für die verschiedenen Redaktionen im Hause sowie in der allgemeinen Immunisierung gegen äußere Einflussnahme. Das damit verknüpfte inoffizielle Tätigkeitsfeld hingegen spielte sich entsprechend der Aktivitäten in geheimen Stockwerken unterhalb des Verlagshauses ab. Dort hatte die Geheimgesellschaft der „Wächter der Schöpfung“ ihren Mittelpunkt.
Bonifacius Kidjo wusste um seine tragende Rolle als Speerspitze dieser unsichtbaren Organisation, besonders auf dem afrikanischen Kontinent. Er wusste um deren Entstehungsgeschichte, kannte die Vita jedes der acht Gründungsmitglieder bis ins Detail. Hier unten, verborgen vor den allzu wissbegierigen Blicken destruktiver Machtmenschen in den Reihen einer weltweit agierenden Gegnerschaft, war er zum Außenagenten ausgebildet worden und wurde er auf seine Missionen eingestimmt. Gegründet 1904 in der Reichshauptstadt Berlin unter dem Eindruck des grausam niedergeschlagenen Aufstandes der Herero und anderer angestammter Völker in Deutsch-Südwestafrika sowie einer entfesselten Kolonialherrschaft europäischer Mächte insgesamt, hatten sich damals die Liebe zum eigenen Vaterland und die tiefe Demut vor den Geboten weltumspannender Humanität gegenseitig bedingt. Daraus war in der Folge ein internationales Netzwerk entstanden, geweiht dem Kampf zum Wohle der Menschheit, zum Schutz der Schöpfung.
Sich diesem Wissen hingebend, blieb Bonifacius auf dem Hauptgang vor einem großen Ölgemälde aus dem Jahr 1907 stehen. Detailgenau war die verschworene Gemeinschaft um den Verleger Armin Konstantin dargestellt – links und rechts neben einem brennenden Kamin im Sitzungszimmer des damaligen Konstantin Verlages stehend. Blicke und Körperhaltung entsprachen dem entschlossenen Wirken zu Lebzeiten. Es war dieses leidenschaftliche Engagement, wie es vor dem Hintergrund noch immer herrschender und stetig zunehmender Unvernunft und Gier globaler Protagonisten unverändert vonnöten war. Kaum zu glauben, machte sich „Shango“ schmerzhaft bewusst, dass selbstzerstörerische Zustände, wie sie vor über einhundert Jahren geherrscht hatten, auch heute noch im Trend lagen. Konventionelles Wettrüsten für die Vorherrschaft auf den Weltmeeren oder die menschenverachtende Entwicklung von Giftgas damals, ungehemmte nukleare, chemische und biologische nebst konventioneller Aufrüstung gegenwärtig. Aber andererseits war es ja auch nie aus der Mode gekommen, ferne Völker und Länder in Geiselhaft zu nehmen, um eine moderne Interpretation der Sklaverei und Ausbeutung zu praktizieren. Im Zeitalter von Hochindustrialisierung, Digitalisierung, technischer Perfektionierung und ökologischer Luftschlösser lagen die Erfordernisse und Begehrlichkeiten klar auf der Hand. Wie ein Rauschgiftsüchtiger lechzte das Irrenhaus des Konsums nach immer mehr „Stoff“ in Form von Rohstoffen.
Was den medizinischen Fortschritt und insbesondere die Entwicklung neuer Medikamente für eine maximal leistungsfähige Bevölkerung in hochindustrialisierten Volkswirtschaften betraf, so stand die anhaltende Ausbeutung von Menschen auf einem ganz eigenen Blatt. Wo Bestimmungen und Gesetze selbst Tierversuche empfindlich einschränkten, musste man eben andernorts aktiv werden, gerne in fernen Ländern, die einstmals Kolonialgebiete gewesen waren – ohne ausreichende Kontrollinstanzen, mit willfährigen beziehungsweise korrupten Regierungen und Persönlichkeiten, empfänglich für Geldzuwendungen. Bei Bedarf stand dort selbst Menschenversuchen nichts im Weg.
Bonifacius sah sich jeden der acht Persönlichkeiten auf dem Gemälde eingehender an. Zeitlebens hatten diese sich als Produkt und Nutznießer des preußischen Erbes betrachtet. Die hervorragende Bildung verdankten sie schließlich einem beispiellosen Bildungssystem, das mit Einführung der allgemeinen Unterrichtspflicht im Jahr 1717 seinen Anfang genommen hatte.
Der Universitätsprofessor der Chemie Erich Beck, auf dem Gemälde unmittelbar links neben dem Kamin stehend – von kleiner zierlicher Statur mit wallendem weißen Haupthaar und ernst durch eine kleine runde Brille blickend – hatte sich noch darauf stützen können, dass die weltweit maßgeblichen Bücher der Chemie in deutscher Sprache verfasst waren.
Direkt neben ihm war der jüdische Jurist Dr. Heinrich Rosenthal verewigt. Dem erfolgreichen Mitinhaber einer Anwaltskanzlei – nicht größer als der Professor aber dafür beleibter und mit dunklem Haarkranz – war sein Temperament anzusehen. Üppiger Schnauzbart und stechende kleine Augen, ebenfalls hinter einer Brille, unterstrichen den Eindruck. Er hatte in seinem Beruf von einem beispiellosen Rechtsstaat profitieren können. Gewaltenteilung zwischen Parlament, Reichskanzler und Justiz, das Bürgerliche Gesetzbuch von 1900, welches aufgrund der Ausgewogenheit und Effizienz nach und nach von zahlreichen Staaten in großen Teilen übernommen worden war.
An Größe überragt wurden die beiden von einer blondhaarigen schlanken Gestalt hinter ihnen. Es war der Verleger Armin Konstantin. Als Herausgeber auch regierungskritischer Schriften und Artikel zur Innen- und Außenpolitik, hatte dieser sich auf weitreichende Presse- und Informationsfreiheit verlassen können – für seine spitze Feder ein unerlässlicher Verbündeter. Sogar einen Gerichtsprozess gegen Kaiser Wilhelm II., geführt wegen Majestätsbeleidigung und Verleumdung, hatte er gewonnen.
Als nächstes identifizierte Bonifacius den jugendlich erfolgreichen Kaufmann Werner Schönbrunn, den international renommierten Erfinder Friedrich August Weber sowie den adligen Kunstmäzen Karl Tiberius Freiherr von der Tannen. Komplettiert wurde die illustre Gemeinschaft durch einen kaiserlichen Diplomaten namens Konsul Ernst Graf Schliefen und den Generalleutnant Karl von Seitz – beide verdient und im Jahr 1904 bereits außer Dienst.
Mit der Geheimgesellschaft „Wächter der Schöpfung“ hatten diese Persönlichkeiten ein gewichtiges Vermächtnis hinterlassen.
Die unaufgeregte Stimme mit Respekt gebietendem Unterton war wie eine Glocke zur nächsten Runde: »Hier bist du mal wieder. Irgendwann werde ich es dir schenken.«
»Und? Dann komme ich womöglich nicht wieder«, gab der Gesuchte mit ernster Miene zurück und drehte sich zu der Sicherheitschefin von Anfang sechzig um, die ihre reife Attraktivität wie ein Markenzeichen vor sich hertrug.
Nach einem letzten flüchtigen Blick auf das Gemälde steuerte Katrin Kaster zügig auf den Zielort zu, und Bonifacius beeilte sich sie einzuholen.
»„KK“, wie wär‘s zur Abwechslung mal mit einer Haartönung?«, frotzelte er.
»Und gebe die Farbe der Weisheit auf? Wie wär‘s zur Abwechslung mal mit Humor, „Shango“?«, parierte sie trocken, und beide grinsten verhalten.
Im größten Konferenzraum begrüßte der Verleger und Urenkel des Verlagsgründers Armin Konstantin, Andreas Konstantin, seinen Agenten mit festem Händedruck. Er gehörte dem aktuellen Rat der Acht an und würde die Patenschaft für die bevorstehende Mission innehaben. Dazu gehörte auch die Missionseinführung. Auf dem langen Sitzungstisch warteten drei Umschläge mit Unterlagen auf ihre Benutzung. Auf dem Weg dorthin griff Bonifacius sich noch eine Flasche Fruchtsaft von einem Beistelltisch.
Die Unterlagen wurden von allen entnommen, und Konstantin verlor keine Zeit: »Wie Sie sicher aus der Presse wissen, ist in Benin vor vier Wochen eine unbekannte Seuche ausgebrochen, die sich innerhalb von wenigen Tagen ausgebreitet hat. Wir haben es dabei mit einem Krankheitserreger zu tun, der die Gefährlichkeit von Ebola bei weitem übertrifft.«
»Geht es genauer, die Medien hier wie dort lassen bisher keine Details dazu verlauten«, war die scheinbar ungerührte Antwort darauf.
»Ein kurzer Vergleich: Als tödlichster Vertreter unter den Ebolaviren gilt bisher das Zaire-Ebolavirus, beziehungsweise sein Unterstamm „Mayinga“ mit einer statistischen Sterblichkeitsrate von neunzig Prozent. In Benin sprechen wir aktuell von einem Superkiller, der unseren Quellen zufolge mit einer Wahrscheinlichkeit von annähernd einhundert Prozent tödlich verläuft. Hinzu kommt, die Inkubationszeit für Ebola liegt normalerweise bei zwei bis einundzwanzig Tagen, und nach Ausbruch der Krankheit sind die Opfer dann nach spätestens sechzehn Tagen tot – geschwächt von Dehydrierung, gestorben an schweren inneren und äußeren Blutungen sowie Kreislaufkollaps. Jetzt unser Superkiller: Der soll eine Inkubationszeit von maximal sechs Tagen haben. Die Opfer sterben nach Ausbruch der Krankheit innerhalb von acht Tagen. Der Krankheitsverlauf entspricht zum Teil dem des herkömmlichen Ebola – hohes Fieber und wässriger Durchfall plus die schweren Blutungen. Allerdings treten keine schweren Kopf- und Muskelschmerzen auf. Und anstelle der Bläschen und Ausschläge zeigt sich noch ein ganz neues Krankheitsbild. Ab dem dritten Tag bilden sich an Armen, Beinen und Hals offene Wunden, eitrig und übelriechend, die sich schnell ausbreiten und zu Gewebeverlust führen. Das Opfer wird regelrecht aufgefressen.«
Mit Hilfe eines Tischprojektors warf die Sicherheitschefin ein Foto an die Wand, welches ein weibliches Opfer im Endstadium dieser verheerenden Krankheit zeigte. Die Augen glasig und leer, war der ganze Körper eine einzige Wunde aus sich zersetzendem Fleisch.
Nur langsam und mit wackligen Knien war Bonifacius imstande, sich zu erheben. Der Anblick war nichts, was er auch nur annähernd je gesehen hätte – nicht im realen Leben. Und eben das ließ ihn schaudern. Er hatte es zwei Nächte zuvor in seinem Traum gesehen, genau das, neben Hexen, Amazonen und dunkelster Magie. Ein Zufall? Wohl kaum.
»Es hat was von einem biologischen Kampfstoff«, kommentierte er sichtlich schockiert.
Daraufhin schauten sich die Sicherheitschefin und das Ratsmitglied kurz an, bevor Andreas Konstantin die Schlagzahl erhöhte: »Gut möglich. Eine biologische Waffe, geschaffen aus Ebola plus unbekannt. So könnte es sein, zumal eine weitere wichtige Information die ist: Als das Ebolafieber 1976 zum ersten Mal nahe des kongolesischen Flusses Ebola ausbrach, wurde man der sich anschließenden Epidemie kaum Herr. Nach vielen Recherchen stellte man endlich fest, dass mangelndes Desinfizieren und Sterilisieren sowie ausbleibende Quarantäne in einem Krankenhaus die Katastrophe ausgelöst hatten. Unter Einbeziehung dieser Erkenntnisse ist Ebola seither erfolgreicher einzudämmen gewesen. Aber was wir jetzt in Benin vorfinden, lässt sich auf die Art nicht erfolgreich eindämmen. Wie es aussieht, wird dieses Virus nicht nur über Körperflüssigkeiten und direkten Körperkontakt, sondern auch durch Tröpfcheninfektion weitergegeben. Und offenbar geben es auch infizierte Personen weiter, die selber noch gar keine Symptome aufweisen. Das würde kurz gesagt bedeuten, Ärzte- und Katastrophenteams vor Ort haben so gut wie keinen Reaktionsspielraum mehr. Der neue Erreger ist zu schnell.«
Die Art und Weise, wie sich der Referent in seinem Sessel zurücksinken ließ, zeugte zweifelsohne von Alarmstimmung, gab dem Agenten jedoch auch das Gefühl, dass Entscheidendes noch immer zurückgehalten wurde.
Abgeklärt ergriff Katrin Kaster das Wort: »Wir denken, es ist absolut verständlich und richtig, dass alle Involvierten von Regierung bis Weltgesundheitsorganisation das Ausmaß der Epidemie herunterspielen. Eine weltweite Massenpanik hätte unvorhersehbare globale Folgen.«
„Shango“ nickte nur verhalten: »Wenn es eine echte zeitnahe Chance gibt, die Seuche örtlich zu begrenzen oder zurückzudrängen, dann ja. Gibt es eine solche Chance?«
»Damit kommen wir genau zu dem Teil der Geschichte, der uns hellhörig werden ließ«, fuhr Konstantin fort, als hätte er auf diesen Einwurf bereits gewartet. »Als Glück im Unglück scheint sich nämlich das Ausbruchsgebiet zu erweisen. Betroffen ist der Nationalpark von Pendjari – ein UNESCO-Biosphärenreservat zwischen der Atakora-Bergkette und der Grenze zu Burkina Faso – außerdem noch angrenzende Jagdgebiete und Ackerbauflächen. Die ersten Opfer in diesem dünn besiedelten Gebiet waren die Landbevölkerung, Wildhüter, Ökotouristen und Hobbyjäger. Vermutlich durch Jäger und Touristen gelangte der Krankheitserreger bis nach Natitingou, der Hauptstadt des Departement Atakora mit 35.000 Einwohnern. Dass das betroffene Departement eine geringe Bevölkerungsdichte hat und darüber hinaus geographisch abgelegen ist, half sicher dabei, den Supergau zu verhindern.«
Komm schon, Mann, ich will nicht wissen was hilfreich wahr, sondern was so zwingend ist, dass die „Wächter der Schöpfung“ mich da runter schicken. Vielleicht ist es ja sogar der Schlüssel zu meiner Traumbotschaft.
»Für uns entscheidend ist aber das sehr schnelle Eingreifen des US-Pharmaunternehmens ERHC, das sich in Afrika bereits seit über zwanzig Jahren auf dem Gebiet der Krankheits- und Arzneimittelforschung engagiert. Deren offizielles Leitmotiv ist es, dort zu forschen, zu testen und zu entwickeln, wo entsprechende Medikamente den betroffenen Menschen auch helfen sollen. Dieser Grundsatz ist im Übrigen auch in den Buchstaben ERHC enthalten: „Environmental Research for Human Care“, also übersetzt so viel wie „Umweltforschung zum Wohle des Menschen“. - Diese Leute haben strengste Quarantäne-Bestimmungen im nördlichen Teil des Departement durchgesetzt, die von beninischem und französischem Militär umgesetzt werden. Alle Zugangswege einschließlich des Luftraumes wurden hermetisch abgeriegelt. Nun zum spannendsten Teil: Die ERHC hat einen experimentellen Impfstoff eingesetzt, der noch nach Krankheitsausbruch wirksam zu sein scheint. Die Quarantäne soll so lange bestehen bleiben, bis keine Neuerkrankungen mehr gemeldet werden und alle verbliebenen Opfer geheilt sind.«
Kaster und Konstantin sahen zu, wie ihr Agent sich erhob, um sich seine Meinung ziellos auf und ab gehend zu bilden. Als er sich mit dem Rücken an eine der Wände gelehnt hatte, suchte er abwechselnd Blickkontakt zu den Gesprächspartnern: »Es dauert doch Monate, bis man genügend Impfstoff kultivieren und herstellen kann – vorausgesetzt man hatte vorher ausreichend Zeit, um Herkunft, Charakter und Wirkungsweise des Erregers zu entschlüsseln. Im Fall der ERHC würde das also heißen, man hätte schon viel länger von der Existenz exakt dieses Erregers gewusst. Und dann ginge es in Benin nicht um eine neue Krankheit. Und warum greift diese Seuche gerade dort um sich, wo verhältnismäßig wenig Menschen leben und kaum Bevölkerungsaustausch stattfindet? Das Departement Atakora ist ja nicht gerade ein internationaler Knotenpunkt. Außerdem, na ja ohne Experte zu sein, ich würde so einen Erreger eher im Regenwaldgebiet des Kongobeckens vermuten – Demokratische Republik Kongo, Kamerun, …«
»… oder Gabun«, führte der Verlagschef zu Ende. »Ja, das hat uns auch beschäftigt. Und siehe da, unser Netzwerk in Benin hat uns Informationen geliefert, wonach das besagte Pharmaunternehmen nicht nur eine Afrikazentrale in Benins Wirtschaftszentrum Cotonou unterhält, sondern auch kleinere Niederlassungen und Büros in Ländern des Kongobeckens – nicht unter der Firmierung ERHC, wohlgemerkt. In einer halboffiziellen Unternehmensinformation heißt es knapp, man sei dort bereits vor drei Jahren auf dieses neuartige Virus gestoßen. Man sei außerdem in der Holzwirtschaft vor Ort aktiv, quasi als stiller Teilhaber. So wolle man die Chance nutzen, in neu erschlossenen Gebieten nach unbekannten tropischen Heilpflanzen und Krankheitserregern zu forschen …«
»Mit Verlaub, das stinkt doch zum Himmel«, fiel Bonifacius ihm höhnisch auflachend ins Wort. »Zum Wohle der Afrikaner rodet ein US-Pharmariese afrikanischen Regenwald. Wer kauft denn so was?!«
»Na zunächst einmal jeder, der davon profitiert«, übernahm Katrin Kaster das Wort. »Folgenden Vorfall haben wir recherchiert: In einem der Holzfäller-Camps tief in den Regenwäldern Gabuns – die Einheimischen nennen das Gebiet Bienenwald und meiden es, weil angeblich nie ein Mensch von dort zurückgekehrt ist – ist der jetzt wieder aktive Erreger erstmals ausgebrochen. Alle Infizierten sind damals noch vor Ort verstorben. Aufgrund der akuten und absolut tödlichen Ansteckungsgefahr hat man Leichen und Camp restlos verbrannt und das Gebiet zur Todeszone erklärt – inklusive Nachrichtensperre. Zuvor hatte die ERHC noch Blut- und Gewebeproben entnommen, um mit der Erforschung beginnen zu können. – Wir haben die Geschichte mit unseren Kontaktleuten in Benin und Zentralafrika abgeglichen. Es ist tatsächlich passiert, und die ERHC hat diese Information unter dem Eindruck der aktuellen Krisensituation auch so an die Regierung Benins und die WHO kommuniziert – als Geheimdossier.«