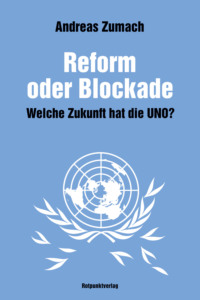Kitabı oku: «Reform oder Blockade», sayfa 6
Wie viele Menschen müssen weltweit geimpft werden?
Aber wie viele Menschen müssen überhaupt geimpft werden? Das hat ein zweites Forscherteam um Wei Wang von der Fudan-Universität in China untersucht. Dabei gingen sie von drei Gruppen aus, die besonders dringend geimpft werden müssen: Angehörige sogenannter »systemrelevanter Berufe« im Gesundheitssystem und anderen Bereichen, Risikogruppen wie Alte und Vorerkrankte und die Menschen, die besonders leicht zu Multiplikatoren der Infektion werden können, weil sie, wie zum Beispiel Lehrer, täglich für viele Stunden auf engem Raum mit vielen anderen Menschen zusammenkommen.
Ausgehend von diesen Auswahlkriterien, kommen die Wissenschaftler in ihrer Mitte Dezember 2020 veröffentlichten Studie auf eine prioritär zu impfende Zielgruppe von 5,2 Milliarden Menschen. Rechnet man diejenigen ab, die bereits eine Corona-Infektion hinter sich haben, bleiben noch 4,78 Milliarden Personen übrig. Diese sind aber global nicht gleich verteilt. Der größte Teil lebt in Asien, rund 2,8 Milliarden vordringlich zu Impfende. Europa und Amerika folgen mit je 700 Millionen, und in Afrika gehören 500 Millionen zur priorisierten Zielgruppe.
Doch vielen ärmeren Ländern, in denen die große Mehrheit dieser vordringlich zu impfenden Menschen leben, fehlen die Mittel, um genügend Impfstoff zu kaufen. Vor allem die neuartigen mRNA-Vakzine von Biontech/Pfizer und von Moderna, die unter allen bislang bekannten Impfstoffen mit 94- bis 96-prozentiger Effektivität die wirkungsvollsten sind, kosten 37 bis 79 US-Dollar pro doppelte Dosis, sind also sehr teuer. Bis auf Brasilien und Indonesien hatte bis Dezember 2020 kein Land mit mittleren und geringen Einkommen Vorbestellungen für Impfstoffe getätigt. Doch diese Staaten vertreten 85 Prozent der Weltbevölkerung.
Die COVAX Facility der WHO erhielt von den 190 beteiligten Staaten bis Ende 2020 nur rund fünf Milliarden US-Dollar. Lediglich 500 Millionen US-Dollar dieser Summe kamen von der EU, die sich zugleich für über 25 Milliarden US-Dollar Impfdosen zum Schutz der eigenen Bevölkerung sicherte. Um die angestrebten zwei Milliarden Impfstoffdosen bis Ende 2021 zur Verfügung stellen zu können, würde die COVAX Facility 2021 weitere 6,8 Milliarden US-Dollar benötigen. Dabei sollen 800 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung fließen, 4,6 Milliarden in die Bereitstellung von Impfstoffen für ärmere Länder und 1,4 Milliarden in die Lieferunterstützung.
»Diese Pandemie ist erst zu Ende, wenn sie für alle zu Ende ist«
Bei den Maßnahmen im Rahmen der »globalen Impfstrategie gegen die Corona-Pandemie«, deren Existenz seit der WHO-Generalversammlung im Mai 2020 vor allem von westlichen Regierungen behauptet wird, gab es nach Feststellung der Wissenschaftler der Johns-Hopkins-Universität zumindest bis Anfang 2021 »erhebliche Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage einerseits und dem medizinisch-ökonomisch Notwendigen andererseits«. Die Probleme bei der Verteilung, der Zulieferung und dem Zugang bestimmten, »wie effektiv diese Impfungen den Verlauf der Corona-Pandemie beeinflussen können«.
Das egoistische Verhalten, das die reichen Industriestaaten zumindest bis Anfang 2021 demonstrierten, stieß auf deutliche Kritik selbst bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der die 37 am weitesten entwickelten Industriestaaten der Erde angehören. »Einige Länder haben viel zu viel Impfstoff, andere haben gar nichts«, monierte Generalsekretär Angel Gurría Mitte Dezember 2020. »Warum denken wir nicht an die fünf Milliarden Menschen in ärmeren Ländern?«
Gurría, der vor seiner Funktion als OECD-Generalsekretär Außen- und Finanzminister in Mexiko war, forderte eine »gerechtere Verteilung« der Impfstoffe. »Das wäre klug für alle. Denn dieses Virus wird erst besiegt sein, wenn es überall auf der Welt besiegt ist.« Ähnlich äußerte sich die Nichtregierungsorganisation Medico International, die sich seit Jahrzehnten für eine global gerechtere und von wirtschaftlichen Profitinteressen unabhängigere Gesundheitspolitik engagiert. »Die Corona-Pandemie ist erst zu Ende, wenn sie für alle zu Ende ist«, erklärt Medico-Sprecherin Anne Jung Anfang Januar 2021 in einem Interview mit der Berliner tageszeitung (taz).
Doch Plädoyers für eine global solidarische und auch aus wohlverstandenem Eigeninteresse kluge Politik gingen Anfang 2021 zumindest in einigen EU-Staaten weitgehend in einem Chor nationalegoistischer Stimmen unter. Das lag auch daran, dass die Infektions- und Todeszahlen in der zweiten Corona-Welle ab Oktober 2020 wieder deutlich angestiegen waren. Trotz mehrfach verschärfter Lockdown-Maßnahmen war bis Mitte März 2021 keine relevante Entspannung absehbar. Und bei den ab Ende Dezember 2020 angelaufenen Impfmaßnahmen hatte es zahlreiche Pannen gegeben. Vor diesem Hintergrund gerieten selbst die Regierungen Deutschlands, Frankreichs und anderer Staaten, die wesentlich mitverantwortlich sind für das unsolidarische Verhalten der EU gegenüber ärmeren Ländern, innenpolitisch in die Kritik, sie hätten sich noch nicht nationalegoistisch genug verhalten, weil sie nicht schnell genug eine ausreichende Zahl von Impfdosen für die eigenen Bürger beschafft hätten. Wirtschaftsliberale Parteien und Politiker, die in der Vergangenheit die Vergabe von Lizenen für die Produktion preiswerter Generika zur Versorgung von Menschen in armen Ländern immer grundsätzlich als »Eingriff in den freien Markt« abgelehnt hatten, forderten auf einmal, einheimische Pharmaunternehmen zur Vergabe von Lizenzen für die Herstellung ihres Corona-Impfstoffs an andere Unternehmen zu verpflichten, um so die Gesamtproduktion zu erhöhen zwecks Versorgung der einheimischen Bevölkerung.
Profitiert das Klima von der Corona-Pandemie?
Die Corona-Pandemie hat die Herausforderung der globalen Erwärmung 2020 in den Schatten gestellt. Zugleich hatte die Pandemie einen positiven Effekt auf den Klimawandel, zumindest kurzfristig. Wegen der Maßnahmen und Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie gingen Industrieproduktion, Handelsverkehr, Flugreisen und auch die Nutzung von Autos erheblich zurück. In der Folge sank auch der weltweite Ausstoß von fossilem Kohlendioxid im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Milliarden Tonnen auf 34 Milliarden Tonnen – oder um den Rekordwert von 7 Prozent. Für den größten Teil des Rückgangs war der Transportsektor verantwortlich. Die Emissionen aus dem Straßen- und Luftverkehr lagen im Dezember 2020 noch um bis zu 40 Prozent unter dem Niveau des Vorjahrs.
Besonders groß war der Rückgang in den Industriestaaten. Spitzenreiter waren die USA und die EU mit einem Minus von 12 beziehungsweise 11 Prozent. Auf Platz drei bei den stärksten Emissionsrückgängen landete Indien mit einem Minus von 9 Prozent. China als einer der größten Emittenten von fossilem CO2 weltweit verzeichnete dagegen nur einen Rückgang um 1,7 Prozent. Damit die Zahlen im Pariser Klimaabkommen erreicht werden, müsste der globale Ausstoß von fossilem CO2 zwischen 2020 und 2030 jedes Jahr um zwei Milliarden Tonnen zurückgehen.
Die große Frage ist, ob die positive Entwicklung des Corona-Jahres 2020 anhält. Oder ob sich wieder ein Negativtrend entwickelt, so wie das nach dem zeitweisen Rückgang der fossilen CO2-Emissionen infolge der globalen Finanz- und Bankenkrise 2007/08 der Fall war. Nach einem vorübergehenden Rückgang stiegen die Emissionen, als es der Wirtschaft wieder besser ging, allein 2010 um 5 Prozent an. Die weitere Entwicklung in den nächsten Jahren wird sehr davon abhängen, ob die billionenschweren staatlichen Corona-Hilfen und -Subventionen, die allein in den USA und in der EU beschlossen und zum Teil bereits ausgezahlt wurden, zu einer Wiederaufnahme und Fortsetzung von bislang üblichen klima-und umweltschädlichen Produktionsweisen und Mobilitätsverhalten führen. Oder ob die große, historische Chance dieser Pandemie für eine ökologische Transformation hin zu nachhaltigen, energieeffizienteren und damit klima- und umweltfreundlicheren Formen von Produktion, Handel und Mobilität genutzt wird.
Corona, Ebola – Gesundheit als Ware statt öffentliches Gemeingut
Die Corona-Pandemie hat die schon lange bestehenden Unzulänglichkeiten vieler nationaler Gesundheitssysteme, die Krise der globalen Gesundheitspolitik und den Reformbedarf der für diese Politik zuständigen UNO-Organisation WHO verschärft. Zugleich wurden diese Probleme wie nie zuvor einer breiten Weltöffentlichkeit deutlich. Darin liegt zumindest die Chance auf grundlegende Veränderungen und Verbesserungen, die über den – vielleicht gelingenden – Sieg über das Corona-Virus hinausgehen. Gesundheitsversorgung ist ein öffentliches, für alle Menschen erschwingliches Gemeingut und keine an Profitlogik orientierte Ware. Es geht darum, die Weltgesundheitsorganisation durch politische, strukturelle und finanzielle Reformen in ihrer Handlungsfähigkeit und ihre Unabhängigkeit von Pharmakonzernen zu stärken.
Die Ebola-Epidemie als Warnsignal
Die gravierenden Defizite globaler und nationaler Gesundheitspolitiken wurden bereits 2014 durch den bis dato schwersten Ausbruch einer Ebola-Epidemie seit Entdeckung dieses heimtückischen Virus im Jahr 1976 sehr deutlich. Bis Ende Januar 2015 erkrankten vor allem in den drei westafrikanischen Staaten Sierra Leone, Liberia und Guinea fast 23’000 Menschen an Ebola; 9200 dieser infizierten Personen starben.
Die Epidemie führte zu massiven Rückschlägen für die Volkswirtschaften dieser drei Staaten, die sich nach schweren inneren Unruhen und Bürgerkriegen gerade erst wieder einigermaßen stabilisiert hatten. Das Entwicklungsprogramm der UNO (United Nations Development Programme, UNDP) bezifferte Mitte Oktober 2014 die wirtschaftlichen Folgen für die Haushalte seit Ausbruch von Ebola im März des Jahres. Laut UNDP sank in Guinea das Einkommen im Schnitt bereits um 12,7 Prozent, in Sierra Leone um 29,7 Prozent und in Liberia um 35 Prozent. In Sierra Leones Seuchengebieten lagen ein halbes Jahr nach Ausbruch von Ebola bereits 40 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe brach; in Liberia waren es außerhalb der Hauptstadt Monrovia sogar 60 Prozent. Ernten wurden nicht eingeholt, lokale Märkte geschlossen. Und es gab einen dramatischen Preisanstieg, beim Grundnahrungsmittel Maniok in Monrovia um 150 Prozent.
Im Laufe des Jahres 2015 stieg die Zahl der Hungernden in Liberia, Sierra Leone und Guinea nach Angaben des für die internationale Nahrungsmittelhilfe zuständigen Welternährungsprogramms der UNO (World Food Programme, WFP) von 2,3 Millionen Menschen auf über drei Millionen. Erst mit der langsamen Eindämmung der Ebola-Epidemie in den folgenden Jahren sank auch die Zahl der Hungernden wieder. Ende 2019 galt Ebola als überwunden. Doch Anfang 2021 wurden in Guinea und in der Demokratischen Republik Kongo neue Ebola-Fälle registriert. Die WHO warnte vor einer Ausbreitung auf die Nachbarländer.
Das Versagen der Weltgesundheitsorganisation
Dass die Ebola-Epidemie im Jahr 2014 außer Kontrolle geriet und so viele Opfer forderte, lasteten viele Gesundheitsexperten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf an. Mit über 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Genfer Zentrale sowie in 150 Länder- und Regionalbüros ist die WHO die größte der achtzehn Sonderorganisationen des UNO-Systems. Ihr Budget ist das zweitgrößte nach dem regulären Haushalt der UNO. Gegründet wurde die WHO 1948. Mit Ausnahme Liechtensteins gehören ihr sämtliche UNO-Mitgliedstaaten an. Die Schweiz trat der WHO bereits Jahrzehnte vor der Aufnahme des Landes in die UNO im Jahre 2002 bei.
Laut ihrem Gründungsauftrag soll die WHO internationale Gesundheitsfragen koordinieren und Regierungen der Mitgliedstaaten beim Ausbau ihrer öffentlichen Gesundheits- und Fürsorgedienste beraten und unterstützen. Insbesondere soll die WHO globale Krankheiten ausrotten, und dies nicht zuletzt, indem sie die Normen für medizinische Ausbildung und wissenschaftliche Forschung sowie für das öffentliche Gesundheitswesen aufstellt und die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung dieser Normen unterstützt.
Doch gemessen an diesem Auftrag, habe die WHO in der aktuellen Ebola-Krise versagt, monierten die Kritiker. Die WHO habe den Ernst der Lage zu spät erkannt, zu spät Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung der Ebola-Epidemie zu verhindern, und die Koordination internationaler Hilfskampagnen nur zögerlich initiiert.
Zu den schärfsten Kritikern gehörte die internationale Nichtregierungsorganisation Médecins Sans Frontières (MSF, Ärzte ohne Grenzen), die selbst rund 20’000 Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger in die von Ebola am meisten betroffenen drei westafrikanischen Staaten entsandte. Bereits im März 2014 wies MSF die WHO darauf hin, dass sich seit Dezember 2013 das Ebola-Virus in Guinea unkontrolliert ausbreite. Schon damals warnte die Organisation vor einer »Epidemie nie dagewesenen Ausmaßes«. Doch die WHO spielte die Gefahr zunächst herunter.
Erst Monate nach Ausbruch der Krankheit, als sich auch in Guineas Nachbarländern Sierra Leone und Liberia immer mehr Menschen mit dem Ebola-Virus infiziert hatten, nahm die WHO endlich ihre Verantwortung wahr. Am 8. August 2014 rief WHO-Generaldirektorin Margaret Chan wegen der Ebola-Epidemie den Internationalen Gesundheitsnotstand aus.
»Wir sind frustriert, weil wir seit Monaten mit der WHO darüber reden, dass mehr gemacht werden muss. Und diese Sachen passieren nicht, obwohl wir seit Monaten darauf hinweisen, dass es passieren muss«, äußerte der Geschäftsführer der deutschen MSF-Sektion, Florian Westphal, im September 2014 in einem Interview mit dem deutschen ARD-Fernsehen seine Enttäuschung über die Zurückhaltung der WHO.
»Ungeachtet von Anforderungen durch Ärzte ohne Grenzen, ist die WHO nicht vor Juli aufgewacht«, kritisierte auch der belgische Mikrobiologe Peter Piot, der das Ebola-Virus 1976 im damaligen Zaire mit entdeckte, das Versagen der Weltgesundheitsorganisation.
Selbst ehemalige Angestellte der WHO übten öffentlich Kritik an der viel zu späten Reaktion der WHO. Petra Dickmann, einstige Mitarbeiterin des Robert Koch-Instituts im Zentrum für Biologische Sicherheit der WHO, erklärte im September 2014 gegenüber dem deutschen ARD-Fernsehen: »Ärzte ohne Grenzen sind vor Ort und haben viel Erfahrung vor Ort. Die haben lange gesagt: Hier passiert etwas, was nicht normal ist. Das ist etwas, was wir vorher nicht erlebt haben. Die haben lange schon die Trommel geschlagen. Wir haben ihnen zu spät zugehört. Und ich denke, dass die internationale Gemeinschaft und auch die Weltgesundheitsorganisation sehr spät darauf reagiert hat.« Darüber hinaus kritisierte Dickmann, dass die Weltgesundheitsorganisation, statt das Personal in den betroffenen Ländern aufzustocken, sogar »relativ zügig wieder Personal abgezogen« habe. »Und das war mit Sicherheit ein Fehler.«
Auch bereits in der Zeit vor dem Ebola-Ausbruch wurden den zuständigen WHO-Regionalbüros in Afrika zahlreiche Stellen gestrichen, die Teams verkleinert.
Die Genfer WHO-Zentrale und ihre Generaldirektorin Chan reagierten bis Anfang 2015 nicht auf diese konkreten Kritikpunkte. Stattdessen versuchte man, die Flucht nach vorn zu ergreifen. Nachdem die WHO im August 2014 mit mehrmonatiger Verspätung endlich den internationalen medizinischen Notstand ausgerufen hatte, erklärte ihr Sprecher Pieter Desloovere: »Ich denke nicht, dass wir mit dem Finger aufeinander zeigen sollten: Wer hat zu spät reagiert, wer hat schon reagiert, wer nicht? Ich denke wirklich, wir sollten jetzt nach vorne schauen, darauf, was jetzt passieren kann, um die Epidemie einzudämmen.«
Erst Ende Januar 2015 räumte Generaldirektorin Chan erstmals zumindest einige Versäumnisse ein. Die WHO müsse ihr »Krisenmanagement verbessern«, erklärte Chan auf einer Sitzung des Exekutivrats der WHO in der Genfer Zentrale. Die Verfahren zur Rekrutierung von Einsatzkräften bei einem Ausbruch von Seuchen seien »zu langsam«. Darüber hinaus sollten sich alle Staaten intensiver auf solche Krisen vorbereiten und Spezialteams als Teil ihres Gesundheitssystems aufbauen. »Ich dränge darauf, dass wir die Ebola-Krise als eine Gelegenheit nutzen, unsere Systeme zu stärken«, betonte Chan. Zugleich behauptete die Generaldirektorin, die von ihr geführte WHO habe bei der Bekämpfung von Ebola »die Trendwende geschafft und das Schlimmste verhindert«.
Corona-Schlagabtausch zwischen USA, WHO und China
Auch nach Beginn der Corona-Pandemie, die nach bisherigem Stand der Erkenntnis im November 2019 auf einem Markt im chinesischen Wuhan ausbrach, wurde die WHO zunächst heftig kritisiert. Schärfster Kritiker war der damalige US-Präsident Donald Trump. Er warf der WHO vor, sie sei eine »Marionette« Chinas. Peking habe über den Ursprung des Virus und die Umstände seines Ausbruchs »gelogen« und die WHO habe diese Lügen weiterverbreitet, behauptete Trump. Auch habe die WHO es nach der Verbreitung des Virus über die Grenzen Chinas hinaus Anfang 2020 versäumt, vor internationalen Reisen zu warnen. Daher seien »China und die WHO gemeinsam verantwortlich für die weltweite Verbreitung des Virus«. Zeitweise behauptete Trump, das Corona-Virus sei aus einem »chinesischen Labor zur Herstellung biologischer Waffen« entwichen. Trump vollzog den Austritt der USA aus der WHO. Bis zum Ende seiner Amtszeit bezeichnete er das Corona-Virus als »China-Virus«. Damit versuchte der US-Präsident vergeblich, von der eigenen, in jeder Hinsicht verantwortungslosen und katastrophalen Politik zur Bekämpfung der Corona-Pandemie abzulenken, die er unter anderem als »harmlose Erkältungskrankheit« oder als »Erfindung der Demokraten« im Präsidentschaftswahlkampf abtat.
Trumps krasse Falschbehauptungen und Lügen sind längst widerlegt und können getrost als reine Propaganda abgelegt werden. Es gab allerdings zumindest in der Anfangsphase der Pandemie Anlass zu Kritik an China und zu Unzufriedenheit mit der WHO-Führung unter Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bereits im November 2019 traten in der chinesischen Stadt Wuhan Fälle einer bis dahin unbekannten Lungenerkrankung auf. Doch erst am 31. Dezember 2019 meldete Peking diese Fälle an die WHO. Vor diesem Datum, aber auch danach wurden chinesische Ärzte und Gesundheitsexpertinnen sowie Journalistinnen und Journalisten, die frühzeitig vor dem Virus gewarnt und Vertuschungsmanöver der eigenen Regierung kritisiert hatten, mundtot gemacht. Dennoch fand der WHO-Generaldirektor bei seiner ersten Pressekonferenz zum Thema am 23. Januar 2020, nach seinem Pekinger Treffen am 28. Januar 2020 mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und auch bei allen weiteren öffentlichen Erklärungen bis Anfang März 2020 stets nur lobende Worte für die Maßnahmen der chinesischen Führung zur Bekämpfung des Corona-Virus. Das trug dem Generaldirektor den Vorwurf »zu großer Gutgläubigkeit« gegenüber Peking und Rücktrittsforderungen ein. Verteidiger des Generaldirektors weisen darauf hin, er habe bei seinen internen Gesprächen mit chinesischen Regierungsvertretern deutliche kritische Worte gefunden, bei seinen öffentlichen Erklärungen aber darauf Rücksicht nehmen müssen, dass China inzwischen neben den USA das gewichtigste Mitglied der WHO sei. Anfang Januar 2021 äußerte sich der Generaldirektor »sehr enttäuscht« darüber, dass die chinesische Regierung die Einreise einer Expertendelegation der WHO, die die Ursprünge des Pandemieausbruchs 2019 untersuchen soll, immer wieder verzögerte. Mitte Januar 2021 durfte die Delegation endlich einreisen, allerdings nur unter erheblichen Restriktionen. Ob unter diesen Umständen die offenen Fragen jemals geklärt werden können, bleibt abzuwarten.
Die Probleme in der Anfangsphase der Corona-Pandemie weisen auf ein grundsätzliches Dilemma der WHO hin, das auch bei früheren Epidemien und Pandemien schon auftrat. Die WHO hat bis heute keinerlei Handhabe, um nach Auftreten einer bis dato unbekannten Krankheit in einem Mitgliedsland dort eigenständige, von der jeweiligen Regierung unabhängige Nachforschungen über diese Krankheit und ihre Ursachen anzustellen.
Notwendig wären neue, rechtsverbindliche Befugnisse für die WHO, wie sie der Präsident Südkoreas Moon Jae-in bei der Generalversammlung im Mai 2020 vorschlug. Am wichtigsten wäre die Stationierung ständiger WHO-Beobachter in allen 194 Mitgliedsländern mit uneingeschränkten Kompetenzen zur Informationsbeschaffung bei Regierungsbehörden wie bei nichtstaatlichen Akteuren. Doch hätte die lautstark nach Reformen der WHO rufende Trump-Administration die dauerhafte Anwesenheit von internationalen Beobachtern im eigenen Land akzeptiert? Auf die Gefahr hin, dass diese dann möglicherweise Informationen über die krankheits- und epidemiefördernden Mängel im US-Gesundheitssystem sammelten? Wahrscheinlich nicht. Die Trump-Administration stimmte bereits bei der WHO-Generalversammlung im Mai 2020 gegen eine Resolution mit der Forderung, mit einer »unparteiischen, unabhängigen und umfassenden Evaluierung« die Reaktion auf die Corona-Pandemie zu untersuchen – und zwar nicht nur in China, sondern »weltweit«, damit auch in den USA.